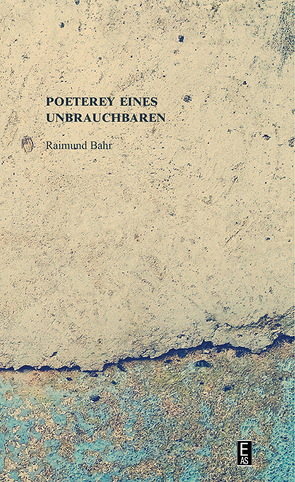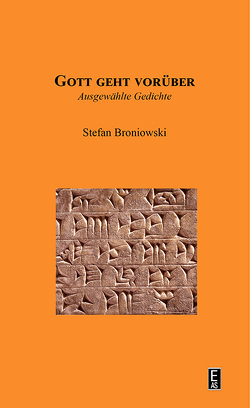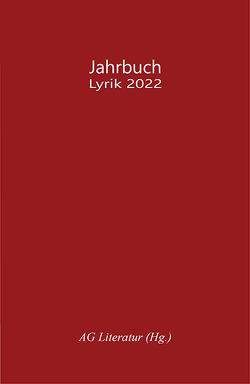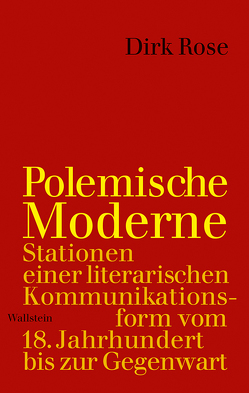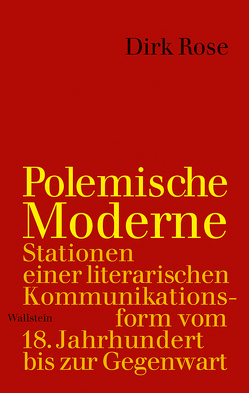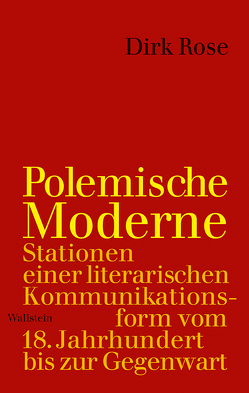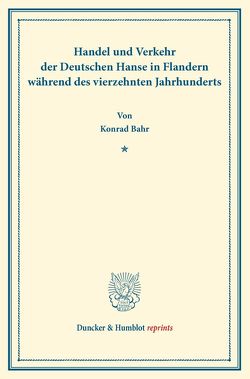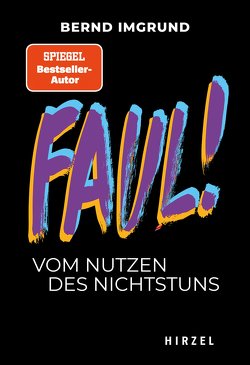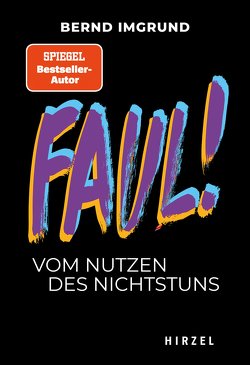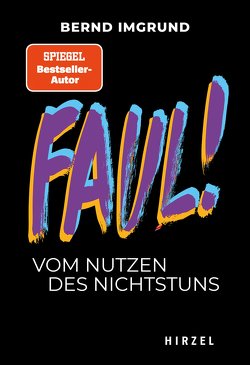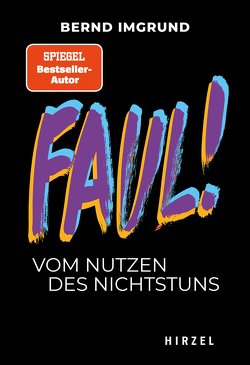Poeterey eines Unbrauchbaren
Raimund Bahr
Im nunmehr siebten Lyrikband legt der Autor nicht eine abschließenede Arbeit vor, sondern öffnet seinen Blick für das noch nicht Gesagte, für das, was selbst nach Jahren noch im Denken eines „Poeten“schlummert, sich Bahn brechen will, jeden Tag aufs Neue.
Der Band sieben seiner Lyrik besteht aus etwa fünfzig Gedichten, die aufzeichnen, was ihm begenete, äußere Erscheinungen und innere Zustände. Auf seinen Wegen durch die Welt fand er Bilder, die sich keiner Konzeption fügen mussten, sondern sich frei entfalten durften durch sein Denken hindurch.
Die Natur wird dabei zum Symbol verlorener erotischer Kraft. Die Abende sind nicht mehr düster, sondern heiter, als spiegelten sie eine Sehnsucht nach Vergänglichkeit. Die Formen sind jene der Jugendzeit. Nach all den Experimenten kehrt das Langgedicht in seine Arbeit zurück. Wechselt sich ab mit kurzen Passagen. Manchmal nur ein Gedanke. Aber in allem ist immer noch die Suche nach einer eigenen Sprache präsent, auf die er sich vor Jahrzehnten begeben hat. Um ihretwillen kann es kein Ende der Poeterey geben, nicht der deutschen und auch nicht die eines Unbrauchbaren, egal welcher Herkunft er sei und wie gut die Zeit es mit ihm gemeint hat.
Und der Band ist zuletzt eine Hommage an die wichtigsten Autor/inn/en seiner Leseerfahrung. Es gibt zahlreiche innere Bezüge zu den Traditionslinien, die ihn zu dem Autor gemacht haben, der er heute ist, nicht um sich mit fremden Federn zu schmücken, sondern seinen Idolen seine Referenz zu erweisen.