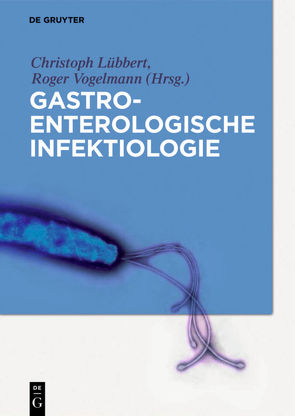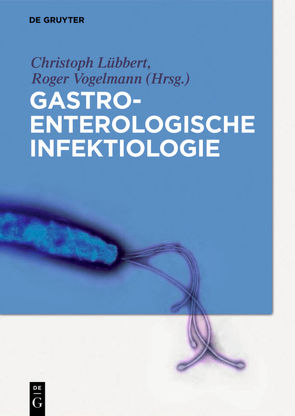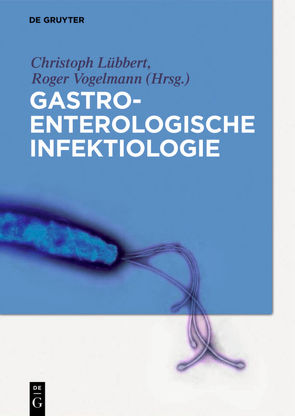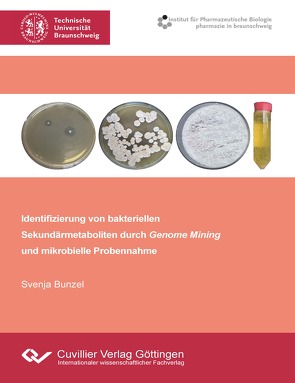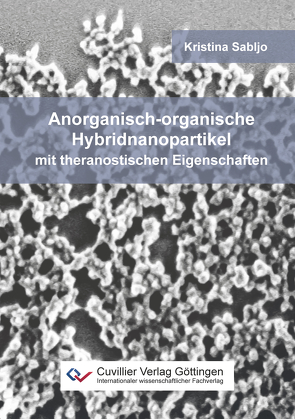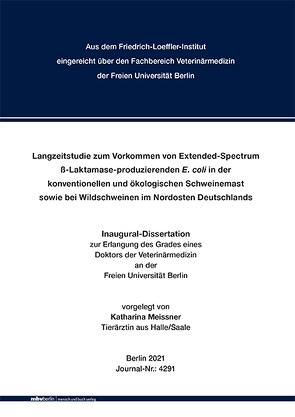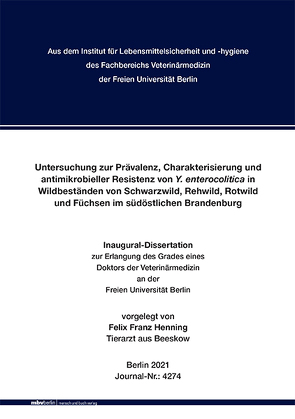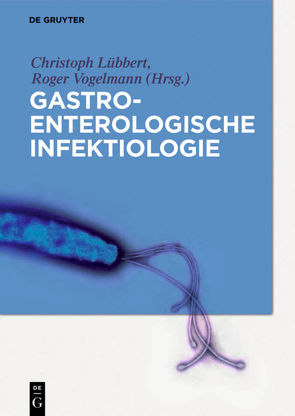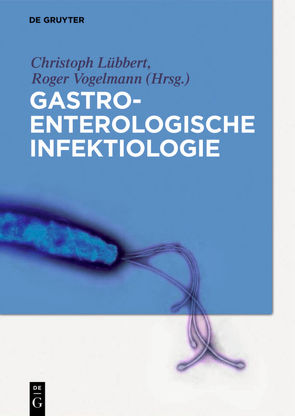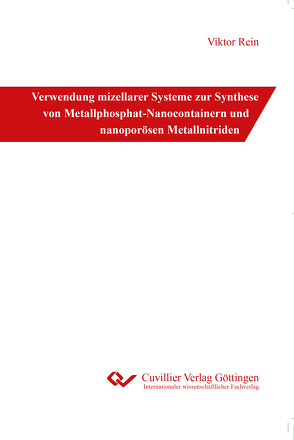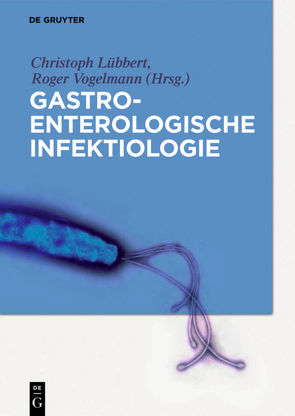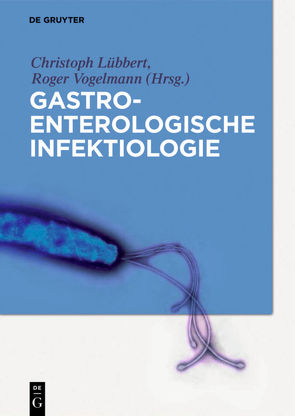
Infektionskrankheiten sind ein stetig wichtiger werdender Bestandteil der Gastroenterologie, werden in der Fort- und Weiterbildung aber bislang noch häufig vernachlässigt. Die gastroenterologische Infektiologie erfährt derzeit einen rasanten Bedeutungszuwachs durch die weitreichenden Resistenzprobleme infolge des häufig ungezielten Einsatzes von Antibiotika (insbesondere MRGN), der zunehmenden Herausforderung einer alternden Bevölkerung mit steigender Komorbidität und Infektionsanfälligkeit sowie durch die besonderen Herausforderungen von migrationsassoziierten Infektionskrankheiten. Komplexe Interventionen in der Hochleistungsmedizin mit ihren spezifischen Infektionsrisiken stellen besondere Anforderungen an das Komplikationsmanagement und die Infektionsprävention. Nicht zuletzt dürfte auch die Mikrobiomforschung neue Ansätze für das Krankheitsverständnis und die Therapiemöglichkeiten von gastrointestinalen Infektionen generieren, wie der bereits als Behandlungsoption bei rezidivierender Clostridium difficile-Infektion etablierte fäkale Mikrobiomtransfer zeigt.
Aktualisiert: 2023-05-29
Autor:
Viola Andresen,
Daniel C. Baumgart,
Tony Bruns,
Matthias Ebert,
Tim Eckmanns,
Hans-Jörg Epple,
Christina Forstner,
Christoph-T. Germer,
Daniel Gotthardt,
Beate Grüner,
Stefan Hagel,
Werner Heinz,
Max Hilscher,
Theresa Hippchen,
Mario Hoenemann,
Andreas Jansen,
Annabelle Jung,
Gernot Keyßer,
Maximilian Kittel,
Jens M. Kittner,
Jörg Krebs,
Peter Layer,
Bernhard Lembcke,
Uwe G. Liebert,
Norman Lippmann,
Stefan Löb,
Ansgar W. Lohse,
Florian Lordick,
Christoph Lübbert,
Carolin F. Manthey,
Verena Moos,
Reinier Mutters,
Michael Neumaier,
Joachim Richter,
Arne Rodloff,
Jonas Rosendahl,
Ulrich Rosien,
Jörn M. Schattenberg,
Ingolf Schiefke,
Stefan Schmiedel,
Thomas Schneider,
Klaus Schröppel,
Arno Siebenhaar,
Peter Sothmann,
Ulrich Spengler,
Andreas Stallmach,
Eduard F. Stange,
Gertraud Stocker,
Niels Teich,
Roger Vogelmann,
Jan Wehkamp,
Thomas Weinke
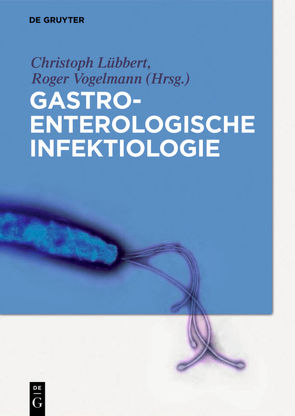
Infektionskrankheiten sind ein stetig wichtiger werdender Bestandteil der Gastroenterologie, werden in der Fort- und Weiterbildung aber bislang noch häufig vernachlässigt. Die gastroenterologische Infektiologie erfährt derzeit einen rasanten Bedeutungszuwachs durch die weitreichenden Resistenzprobleme infolge des häufig ungezielten Einsatzes von Antibiotika (insbesondere MRGN), der zunehmenden Herausforderung einer alternden Bevölkerung mit steigender Komorbidität und Infektionsanfälligkeit sowie durch die besonderen Herausforderungen von migrationsassoziierten Infektionskrankheiten. Komplexe Interventionen in der Hochleistungsmedizin mit ihren spezifischen Infektionsrisiken stellen besondere Anforderungen an das Komplikationsmanagement und die Infektionsprävention. Nicht zuletzt dürfte auch die Mikrobiomforschung neue Ansätze für das Krankheitsverständnis und die Therapiemöglichkeiten von gastrointestinalen Infektionen generieren, wie der bereits als Behandlungsoption bei rezidivierender Clostridium difficile-Infektion etablierte fäkale Mikrobiomtransfer zeigt.
Aktualisiert: 2023-05-29
Autor:
Viola Andresen,
Daniel C. Baumgart,
Tony Bruns,
Matthias Ebert,
Tim Eckmanns,
Hans-Jörg Epple,
Christina Forstner,
Christoph-T. Germer,
Daniel Gotthardt,
Beate Grüner,
Stefan Hagel,
Werner Heinz,
Max Hilscher,
Theresa Hippchen,
Mario Hoenemann,
Andreas Jansen,
Annabelle Jung,
Gernot Keyßer,
Maximilian Kittel,
Jens M. Kittner,
Jörg Krebs,
Peter Layer,
Bernhard Lembcke,
Uwe G. Liebert,
Norman Lippmann,
Stefan Löb,
Ansgar W. Lohse,
Florian Lordick,
Christoph Lübbert,
Carolin F. Manthey,
Verena Moos,
Reinier Mutters,
Michael Neumaier,
Joachim Richter,
Arne Rodloff,
Jonas Rosendahl,
Ulrich Rosien,
Jörn M. Schattenberg,
Ingolf Schiefke,
Stefan Schmiedel,
Thomas Schneider,
Klaus Schröppel,
Arno Siebenhaar,
Peter Sothmann,
Ulrich Spengler,
Andreas Stallmach,
Eduard F. Stange,
Gertraud Stocker,
Niels Teich,
Roger Vogelmann,
Jan Wehkamp,
Thomas Weinke
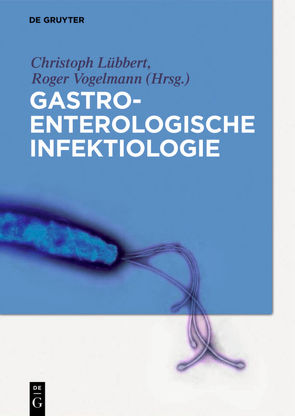
Infektionskrankheiten sind ein stetig wichtiger werdender Bestandteil der Gastroenterologie, werden in der Fort- und Weiterbildung aber bislang noch häufig vernachlässigt. Die gastroenterologische Infektiologie erfährt derzeit einen rasanten Bedeutungszuwachs durch die weitreichenden Resistenzprobleme infolge des häufig ungezielten Einsatzes von Antibiotika (insbesondere MRGN), der zunehmenden Herausforderung einer alternden Bevölkerung mit steigender Komorbidität und Infektionsanfälligkeit sowie durch die besonderen Herausforderungen von migrationsassoziierten Infektionskrankheiten. Komplexe Interventionen in der Hochleistungsmedizin mit ihren spezifischen Infektionsrisiken stellen besondere Anforderungen an das Komplikationsmanagement und die Infektionsprävention. Nicht zuletzt dürfte auch die Mikrobiomforschung neue Ansätze für das Krankheitsverständnis und die Therapiemöglichkeiten von gastrointestinalen Infektionen generieren, wie der bereits als Behandlungsoption bei rezidivierender Clostridium difficile-Infektion etablierte fäkale Mikrobiomtransfer zeigt.
Aktualisiert: 2023-05-29
Autor:
Viola Andresen,
Daniel C. Baumgart,
Tony Bruns,
Matthias Ebert,
Tim Eckmanns,
Hans-Jörg Epple,
Christina Forstner,
Christoph-T. Germer,
Daniel Gotthardt,
Beate Grüner,
Stefan Hagel,
Werner Heinz,
Max Hilscher,
Theresa Hippchen,
Mario Hoenemann,
Andreas Jansen,
Annabelle Jung,
Gernot Keyßer,
Maximilian Kittel,
Jens M. Kittner,
Jörg Krebs,
Peter Layer,
Bernhard Lembcke,
Uwe G. Liebert,
Norman Lippmann,
Stefan Löb,
Ansgar W. Lohse,
Florian Lordick,
Christoph Lübbert,
Carolin F. Manthey,
Verena Moos,
Reinier Mutters,
Michael Neumaier,
Joachim Richter,
Arne Rodloff,
Jonas Rosendahl,
Ulrich Rosien,
Jörn M. Schattenberg,
Ingolf Schiefke,
Stefan Schmiedel,
Thomas Schneider,
Klaus Schröppel,
Arno Siebenhaar,
Peter Sothmann,
Ulrich Spengler,
Andreas Stallmach,
Eduard F. Stange,
Gertraud Stocker,
Niels Teich,
Roger Vogelmann,
Jan Wehkamp,
Thomas Weinke
Aufgrund der steigenden Vorkommen resistenter bzw. multiresistenter Pathogene ist es notwendig neue Therapeutika mit antibiotischer Aktivität zu entdecken. Ein großes Potential besitzen die Bodenbakterien als Bildner neuer Antibiotika, allen voran die Gram-positiven Streptomyceten. Sie bilden u.a. Nicht-ribosomale Peptide (NRP). Um neuartige NRP zu entdecken, kann ein Genome Mining Ansatz verfolgt werden.
In dieser Arbeit wurde ein neuartiges biosynthetisches Gencluster, welches für 2 Nicht-ribosomale Peptidsynthetasen codiert, identifiziert. Da in dem Cluster mehrere clusterspezifische Regulatoren und Gene für Selbstresistenzen enthalten sind, wurde angenommen, dass das NRP eine antibiotische Wirksamkeit besitzt. Ziel der Arbeit ist es das gebildete NRP zu identifizieren und isolieren.
Aktualisiert: 2022-12-22
> findR *
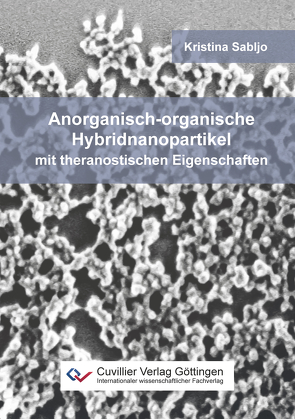
Nanomaterialien haben in der Medizin zu enormem Fortschritt bei der gezielten Wirkstofffreisetzung und für die multimodale Diagnostik geführt. Zu diesem Zweck befasst sich die vorliegende Arbeit mit der Synthese und Charakterisierung von neuartigen anorganisch-organischen Hybridnanopartikel. Diese bestehen formal aus einem anorganischen Metallkation (z. B. [ZrO]²⁺, Gd³⁺) und einem funktionellen organischen Anion. Durch dessen Variation können verschiedene Funktionalitäten eingeführt werden, wodurch die vorgestellten Hybridnanopartikel therapeutische und/oder bildgebende Eigenschaften aufweisen. Dies ermöglicht den Einsatz zur Behandlung von Tumoren, bakteriellen Infektionen sowie entzündlichen Erkrankungen. In Kombination mit einer Fluoreszenzsonde kann dabei die Wirkstoffabgabe detektiert werden. Des Weiteren werden Hybridnanopartikel vorgestellt, die durch Radiomarkierung die Einsetzbarkeit als nukleare Bildgebungssonde in der Positronen-Emissions-Tomographie ermöglicht. Das therapeutische Anwendungspotential der Hybridnanopartikel wurde im interdisziplinären Dialog mit Biologie und Medizin durch ausgewählte in vitro- und in vivo-Studien überprüft.
Aktualisiert: 2023-01-01
> findR *
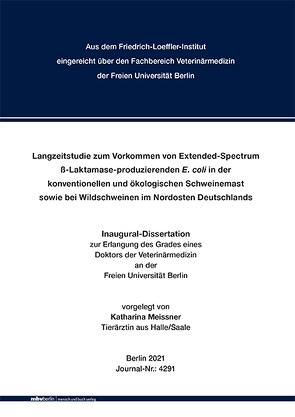
Die von Februar bis Dezember 2018 in Mecklenburg-Vorpommern durchgeführte Longitudinalstudie sollte das Vorkommen von ESBL-bildenden E. coli in konventionellen und ökologischen Schweinemastbetrieben vergleichend darstellen. Insgesamt nahmen an der Studie drei konventionelle und vier ökologisch wirtschaftende Betriebe teil. Einer der Ökobetriebe (Betrieb 4) war auf zwei Standorte verteilt, die als zwei separate epidemiologische Einheiten angesehen wurden. Des Weiteren wurden im Herbst/Winter 2018/2019 Kotproben von Wildschweinen aus der Nähe von Greifswald gesammelt und diese auf ihren ESBL-Status untersucht.
In allen Mastbetrieben wurden ESBL-positive E. coli, insbesondere vom CTX-M-Typ, gefunden, sodass die Studie erwartungsgemäß bestätigt, dass Antibiotika-Resistenzen in der Schweinemast weit verbreitet sind und sowohl konventionelle als auch Biobetriebe betreffen. Die Ergebnisse der bakteriologischen Untersuchung zeigten, dass der prozentuale Anteil ESBL-positiver Buchten bei den konventionellen Betrieben mit 55,2 % größer war als bei den ökologischen Betrieben mit 44,8 % (p < 0,001). Die Betrachtung der einzelnen Betriebe verdeutlichte, dass der prozentuale Anteil ESBL-positiver Buchten bei den konventionellen Betrieben sehr ähnlich war (54,3 - 61,9 %), während bei den ökologisch wirtschaftenden Betrieben eine große Variation zwischen 7,7 und 84,2 % vorlag. Es ergaben sich Hinweise, dass die Herkunftsbetriebe einen großen Einfluss auf das Vorkommen von ESBL-bildenden E. coli in den Mastbetrieben haben können.
Die Resistenztestung mittels Resistenz-Screeningtest zeigte, dass der Anteil von Buchten mit multiresistenten E. coli bei den konventionellen (28,6 %) und ökologisch wirtschaftenden (31,5 %) Betrieben ähnlich war. Die Anteile an Buchten mit Ciprofloxacin-resistenten E. coli waren bei den ökologisch wirtschaftenden Betrieben (17,3 %) sogar größer als bei den konventionellen Betrieben (9,2 %) (p = 0,007). Jedoch lässt sich anhand der Beobachtungen in Bezug auf Multi- und Ciprofloxacinresistenz der einzelnen Betriebe ableiten, dass nicht in jedem Fall ein hoher Anteil an ESBL-positiven Mastgruppen einen hohen Anteil an multiresistenten oder Ciprofloxacin-resistenten Gruppen bedingt, sondern betriebsspezifische Variationen möglich sind.
Bei der Untersuchung von frischen Kotproben eines Betriebsbesuches mittels Real-Time PCR wurde beobachtet, dass nur bei den ökologisch wirtschaftenden Betrieben SHV-12-Typpositive Isolate gefunden wurden. Somit lässt sich annehmen, dass die im Vergleich mit den konventionellen Schweinebetrieben hohen Anteile an SHV-positiven Isolaten durch Einträge von Wildvögeln in die Ausläufe bedingt sein könnten.
In einer weiterführenden VITEK 2 Compact Untersuchung wurden Isolate von Schweinen aus der Endmast eingesetzt. Die Analyse zielte darauf ab, potentiell auf den Menschen übertragbare Resistenzen durch das Lebensmittel Fleisch zu identifizieren. Auffällig waren hier insbesondere Resistenzen gegen Cefepim (Cephalosporin der 4. Generation), Ciprofloxacin und Moxifloxacin (Fluorchinolone) sowie Piperazillin (Acylaminopenicillin), welche bei lebensmittelliefernden Tieren verboten sind als auch gegen Aztreonam (Monobactam), das ebenfalls in der EU nicht als Tierarzneimittel zugelassen ist. Dies zeigt, dass ein grundlegendes Umdenken im Umgang mit Antibiotika nötig ist, da vermutlich bedingt durch Co-Resistenz durch die Verwendung von Antibiotika, die nicht als „critically important for human treatment“ oder Reserveantibiotika gelistet sind, sich Resistenzen gegenüber diesen für die Humanmedizin wichtigen Wirkstoffen eingestellt haben.
Darüber hinaus wurden die Isolate einer Mastgruppe, die mehrfach beprobt wurde und Isolate von Lokalisationen, wo unterschiedliche Mastgruppen eingestallt worden waren, mittels MICRONAUT-S untersucht und die Resistenzprofile verglichen. Dabei zeigten einige Isolate ein identisches Resistenzmuster, während die meisten Isolate ein unterschiedliches Resistenzverhalten aufwiesen. Dies deutet darauf hin, dass es nicht nur einen dominanten Stamm zu geben scheint, der zwischen allen Mastschweinen innerhalb der gleichen Gruppe zirkuliert oder zwischen unterschiedlichen Mastgruppen der gleichen Lokalisation übertragen wird, sondern auch mehrere Stämme vorhanden sein könnten.
Von den untersuchten Wildschweinkotproben konnte ein Isolat (0,8 %; 1 von 121) als ESBL-bildender E. coli identifiziert werden. Dieses Isolat zeigte mittels VITEK 2 Untersuchung Resistenzen gegen Ampicillin, Piperazillin, Ampicillin/Sulbactam und die Cephalosporine Cefuroxim, Cefotaxim und Cefpodoxim. Das Isolat trug das ESBL-Gen blaCTX-M-1 und gehörte zum Sequenztyp 101. Da CTX-M-1 bei Lebensmittel liefernden Tieren als auch bei Menschen gefunden werden kann, erscheint ein Eintrag aus beiden Quellen in die Umwelt mit Übertragung auf Wildschweine möglich. Mithilfe der in silico Analyse wurden drei Plasmide identifiziert. Die Lokalisation der Resistenzgene blaCTX-M-1 und mphA auf dem IncN-Plasmid hat wahrscheinlich zu ihrer weiten Verbreitung beigetragen. In jedem Fall ist der Nachweis ESBL-bildender E. coli bei Wildschweinen Besorgnis erregend, weil er die Verbreitung der Keime in der Umwelt anzeigt.
Aktualisiert: 2022-07-14
> findR *
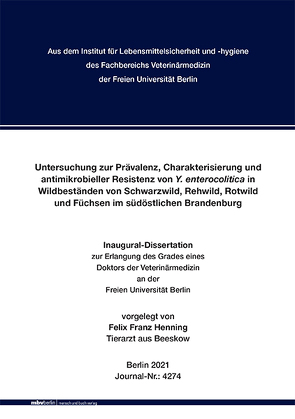
Die Yersiniose, welche neben Y. pseudotuberculosis hauptsächlich durch Y. enterocolitica ausgelöst wird, tritt nach Infektionen mit Campylobacter und Salmonella als dritthäufigste bakterielle Magen-Darm-Erkrankung beim Menschen in Deutschland auf. Seit 2001 ist die Yersiniose, nach Infektionsschutzgesetz, eine meldepflichtige Erkrankung, welche vornehmlich alimentär durch den Verzehr von kontaminiertem, rohen oder unzureichend erhitztem Schweinefleisch auf den Menschen übertragen wird. Während umfangreiche Daten zu Prävalenzen in Nutztieren vorliegen, wurde das Vorkommen von Y. enterocolitica bei Wildtieren in Deutschland bisher nur wenig untersucht.
Ziel dieser Studie war, die Prävalenz von Y. enterocolitica bei unterschiedlichen Wildtierarten im südöstlichen Brandenburg zu bestimmen, die Isolate hinsichtlich ihres Bio-/Serotyps zu charakterisieren und ihre antimikrobielle Resistenz zu ermitteln.
Zu diesem Zweck wurden im Zeitraum von 2015 bis 2017 insgesamt 782 Tonsillenpaare von erlegtem Rehwild (316), Schwarzwild (310), Rotwild (110) und Füchsen (46) aus den Landkreisen Oder-Spree, Dahme-Spreewald und Spree-Neiße entnommen und im Labor untersucht. Die Proben wurden nach einer 14tägigen Kälteanreicherung in PSB auf CIN-Agar kultiviert und verdächtige Kolonien isoliert. Die Spezieszugehörigkeit wurde mittels PCR identifiziert und durch MALDI-TOF bestätigt. Weiterhin wurden die Serotypen der Stämme mittels PCR nach Garzetti et al. (2014) bestimmt und die Stämme im BfR biochemisch charakterisiert. Die antimikrobielle Resistenztestung erfolgte mittels Agardiffusionstest.
Insgesamt wurden 95 Y. enterocolitica Stämme isoliert. Die ermittelten Prävalenzen liegen beim Schwarzwild bei 21,94% (68/310), beim Rehwild bei 6,01% (19/316), beim Rotwild bei 2,73% (3/110) und bei Füchsen bei 10,87% (5/46). 12 der 95 Yersinia-Isolate trugen das ail Gen, 73 Stämme das ystB und 53 Stämme das inv Gen. Biochemisch wurden 59 Stämme dem Biotyp 1A, ein Stamm dem Biotyp 1B und ein Stamm dem Biotyp 2 zugeordnet. 34 Stämme konnten keinem Y. enterocolitica Biotypen zugeordnet werden. Am häufigsten vertreten war der Serotyp O:8 (76/95), gefolgt von O:5 (11/95) und O:3 (5/95). Drei Stämme konnten keinem Serotyp zugeordnet werden. Zwei von Wildschweinen stammende Isolate konnten den humanpathogenen Bio-/Serotypen 1B/O:8 und 2/O:8 zugeordnet werden.
Die Testung auf antimikrobielle Resistenzen ergab, dass alle Stämme gegen Kanamycin und Nalidixinsäure empfindlich sowie resistent gegen Erythromycin waren. Insgesamt betrachtet waren die meisten Y. enterocolitica-Stämme gegen die untersuchten antimikrobiellen Wirkstoffe empfindlich, aber resistent gegen Ampicillin, Erythromycin, Amoxicillin-Clavulansäure, Cefalotin und Cefazolin. Im Hinblick auf die Antibiotikaklassen zeigt sich eine verminderte Empfindlichkeit bei den Cephalosporinen der ersten Generation mit nur 2 sensiblen Stämmen gegenüber Cefalotin und 5 sensiblen Stämmen gegenüber Cefazolin. Gegen die Cephalosporine der zweiten und dritten Generation waren die untersuchten Isolate überwiegend empfindlich mit nur sechs resistenten Isolaten gegen Cefuroxim und 4 resistenten Isolaten gegen Cefotaxim. Bei den Vertretern der Penicilline zeigt sich eine gemischte Resistenzlage mit 13 sensiblen Isolaten bei Ampicillin und 29 sensiblen Isolaten bei Amoxicillin-Clavulansäure. Gegen die Gruppe der Aminoglykosidantibiotika mit Kanamycin, Gentamicin und Streptomycin waren jeweils kein, nur ein bzw. drei Isolate resistent. Gegen die Chinolone Nalidixinsäure und Ciprofloxacin waren keine bzw. fünf Isolate resistent. Gegenüber den antimikrobiellen Wirkstoffen Tetracyclin, Sulfamethoxazol/Trimethoprim, Trimethoprim und Chloramphenicol waren 92, 94, 91 und 90 Isolate empfindlich. 91 der 95 (95,8%) Isolate sind gegen drei oder mehr als drei antimikrobielle Wirkstoffe resistent.
Die vorliegende Studie deutet darauf hin, dass beim Umgang mit Wild ein Risiko besteht mit Y. enterocolitica in Kontakt zu geraten und somit eine Infektion mit Yersinia über diesen Weg möglich ist. Dies unterstreicht die Bedeutung der Einhaltung von Personal- und Wildbrethygiene im Umgang mit potentiellen Lebensmitteln zum Verbraucherschutz aber auch zum Eigenschutz. Die Personengruppen, Jäger und Fleischer, welche in der Regel den ersten und direkten Kontakt zum Tier haben, legen den Grundstein für ein hygienisches und qualitativ hochwertiges Lebensmittel.
Aktualisiert: 2021-10-20
> findR *

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Synthese und Charakterisierung von neuartigen anorganisch-organische Hybridnanopartikeln auf Basis von Gd3+- und [ZrO]2+-Kationen, die aufgrund ihrer Wirkstoffbeladung in unterschiedlichen Bereichen von Biologie und Medizin eingesetzt werden können. Dazu gehört die Behandlung von Tumoren, bakteriellen Infektionen ebenso wie von viralen Erkrankungen. Die hohe Wirkstoffbeladung der Nanopartikel von bis zu 93 Gew-% ermöglicht hierbei eine effektive Wirkstoffanreicherung in den betroffenen Zellen, sodass die Nanopartikel sich durch eine hohe therapeutische Effizienz auszeichnen, welche den Einsatz von molekularen Wirkstoffen übertreffen kann. Neben Hybridnanopartikeln mit mono-molekularer Beladung, werden auch Nanopartikel vorgestellt, deren therapeutische Wirkung auf einer Kombination mehrerer Wirkstoffe oder unterschiedlicher Wirkmechanismen basiert. So ermöglicht das angewandte Materialkonzept beispielweise die Umsetzung von einer chemotherapeutischen Behandlung in Kombination mit einer Photodynamischen Therapie. Ebenso befasst sich diese Arbeit mit Hybridnanopartikel, die neben Wirkstoffen auch Komponenten für bildgebende Verfahren beinhalten (MRT oder fluoreszenzbasierte Bildgebung), sodass ein Einsatz dieser Nanopartikel im Bereich der Theranostik (Therapie + Diagnostik) möglich ist.
Aktualisiert: 2022-03-17
> findR *
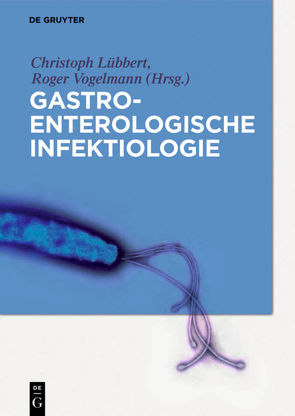
Infektionskrankheiten sind ein stetig wichtiger werdender Bestandteil der Gastroenterologie, werden in der Fort- und Weiterbildung aber bislang noch häufig vernachlässigt. Die gastroenterologische Infektiologie erfährt derzeit einen rasanten Bedeutungszuwachs durch die weitreichenden Resistenzprobleme infolge des häufig ungezielten Einsatzes von Antibiotika (insbesondere MRGN), der zunehmenden Herausforderung einer alternden Bevölkerung mit steigender Komorbidität und Infektionsanfälligkeit sowie durch die besonderen Herausforderungen von migrationsassoziierten Infektionskrankheiten. Komplexe Interventionen in der Hochleistungsmedizin mit ihren spezifischen Infektionsrisiken stellen besondere Anforderungen an das Komplikationsmanagement und die Infektionsprävention. Nicht zuletzt dürfte auch die Mikrobiomforschung neue Ansätze für das Krankheitsverständnis und die Therapiemöglichkeiten von gastrointestinalen Infektionen generieren, wie der bereits als Behandlungsoption bei rezidivierender Clostridium difficile-Infektion etablierte fäkale Mikrobiomtransfer zeigt.
Aktualisiert: 2023-03-27
Autor:
Viola Andresen,
Daniel C. Baumgart,
Tony Bruns,
Matthias Ebert,
Tim Eckmanns,
Hans-Jörg Epple,
Christina Forstner,
Christoph-T. Germer,
Daniel Gotthardt,
Beate Grüner,
Stefan Hagel,
Werner Heinz,
Max Hilscher,
Theresa Hippchen,
Mario Hoenemann,
Andreas Jansen,
Annabelle Jung,
Gernot Keyßer,
Maximilian Kittel,
Jens M. Kittner,
Jörg Krebs,
Peter Layer,
Bernhard Lembcke,
Uwe G. Liebert,
Norman Lippmann,
Stefan Löb,
Ansgar W. Lohse,
Florian Lordick,
Christoph Lübbert,
Carolin F. Manthey,
Verena Moos,
Reinier Mutters,
Michael Neumaier,
Joachim Richter,
Arne Rodloff,
Jonas Rosendahl,
Ulrich Rosien,
Jörn M. Schattenberg,
Ingolf Schiefke,
Stefan Schmiedel,
Thomas Schneider,
Klaus Schröppel,
Arno Siebenhaar,
Peter Sothmann,
Ulrich Spengler,
Andreas Stallmach,
Eduard F. Stange,
Gertraud Stocker,
Niels Teich,
Roger Vogelmann,
Jan Wehkamp,
Thomas Weinke
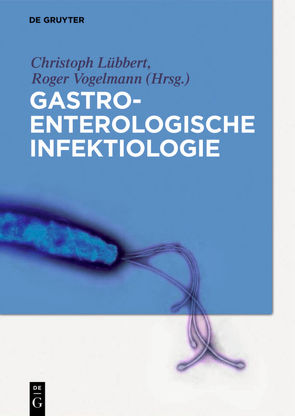
Infektionskrankheiten sind ein stetig wichtiger werdender Bestandteil der Gastroenterologie, werden in der Fort- und Weiterbildung aber bislang noch häufig vernachlässigt. Die gastroenterologische Infektiologie erfährt derzeit einen rasanten Bedeutungszuwachs durch die weitreichenden Resistenzprobleme infolge des häufig ungezielten Einsatzes von Antibiotika (insbesondere MRGN), der zunehmenden Herausforderung einer alternden Bevölkerung mit steigender Komorbidität und Infektionsanfälligkeit sowie durch die besonderen Herausforderungen von migrationsassoziierten Infektionskrankheiten. Komplexe Interventionen in der Hochleistungsmedizin mit ihren spezifischen Infektionsrisiken stellen besondere Anforderungen an das Komplikationsmanagement und die Infektionsprävention. Nicht zuletzt dürfte auch die Mikrobiomforschung neue Ansätze für das Krankheitsverständnis und die Therapiemöglichkeiten von gastrointestinalen Infektionen generieren, wie der bereits als Behandlungsoption bei rezidivierender Clostridium difficile-Infektion etablierte fäkale Mikrobiomtransfer zeigt.
Aktualisiert: 2023-03-27
Autor:
Viola Andresen,
Daniel C. Baumgart,
Tony Bruns,
Matthias Ebert,
Tim Eckmanns,
Hans-Jörg Epple,
Christina Forstner,
Christoph-T. Germer,
Daniel Gotthardt,
Beate Grüner,
Stefan Hagel,
Werner Heinz,
Max Hilscher,
Theresa Hippchen,
Mario Hoenemann,
Andreas Jansen,
Annabelle Jung,
Gernot Keyßer,
Maximilian Kittel,
Jens M. Kittner,
Jörg Krebs,
Peter Layer,
Bernhard Lembcke,
Uwe G. Liebert,
Norman Lippmann,
Stefan Löb,
Ansgar W. Lohse,
Florian Lordick,
Christoph Lübbert,
Carolin F. Manthey,
Verena Moos,
Reinier Mutters,
Michael Neumaier,
Joachim Richter,
Arne Rodloff,
Jonas Rosendahl,
Ulrich Rosien,
Jörn M. Schattenberg,
Ingolf Schiefke,
Stefan Schmiedel,
Thomas Schneider,
Klaus Schröppel,
Arno Siebenhaar,
Peter Sothmann,
Ulrich Spengler,
Andreas Stallmach,
Eduard F. Stange,
Gertraud Stocker,
Niels Teich,
Roger Vogelmann,
Jan Wehkamp,
Thomas Weinke
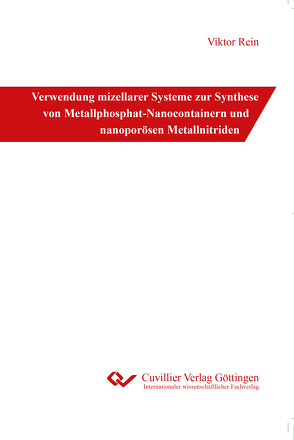
Auf Grund ihrer amphiphilen Molekülstruktur sind Tenside dazu in der Lage, durch Selbstorganisation in Lösung mizellare Aggregate unterschiedlichster Geometrien auszubilden. In Mikroemulsionen und flüssigkristallinen Phasen weisen diese Aggregate Größen im Nanometerbereich auf. Ihre Verwendung als Template und Nanoreaktoren gehört daher heute zu den Standardtechniken der flüssigphasen-basierten Synthese von Nanomaterialien.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde das Potential mizellarer Systeme für die Synthese nanostrukturierter Materialien anhand zweier unterschiedlicher Substanzklassen verdeutlicht. Zum einen wurden Öl-in-Wasser-Mikroemulsionen in einem neuartigen Ansatz dazu verwendet, Metallphosphat-Nanocontainer herzustellen, in welche diverse, wasserunlösliche Wirkstoffe eingekapselt werden konnten. Dadurch war es möglich, wässrige Formulierungen der entsprechenden Wirkstoffe zu erhalten. Zum anderen wurden flüssigkristalline Phasen als Template zur Darstellung nanoporöser Metallnitride mit hohen, spezifischen Oberflächen eingesetzt.
Aktualisiert: 2021-04-16
> findR *
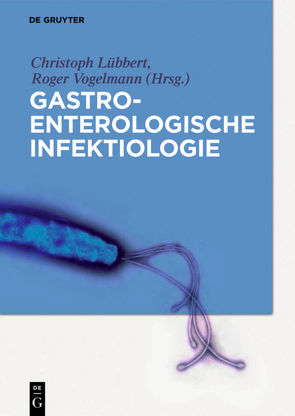
Infektionskrankheiten sind ein stetig wichtiger werdender Bestandteil der Gastroenterologie, werden in der Fort- und Weiterbildung aber bislang noch häufig vernachlässigt. Die gastroenterologische Infektiologie erfährt derzeit einen rasanten Bedeutungszuwachs durch die weitreichenden Resistenzprobleme infolge des häufig ungezielten Einsatzes von Antibiotika (insbesondere MRGN), der zunehmenden Herausforderung einer alternden Bevölkerung mit steigender Komorbidität und Infektionsanfälligkeit sowie durch die besonderen Herausforderungen von migrationsassoziierten Infektionskrankheiten. Komplexe Interventionen in der Hochleistungsmedizin mit ihren spezifischen Infektionsrisiken stellen besondere Anforderungen an das Komplikationsmanagement und die Infektionsprävention. Nicht zuletzt dürfte auch die Mikrobiomforschung neue Ansätze für das Krankheitsverständnis und die Therapiemöglichkeiten von gastrointestinalen Infektionen generieren, wie der bereits als Behandlungsoption bei rezidivierender Clostridium difficile-Infektion etablierte fäkale Mikrobiomtransfer zeigt.
Aktualisiert: 2023-03-27
Autor:
Viola Andresen,
Daniel C. Baumgart,
Tony Bruns,
Matthias Ebert,
Tim Eckmanns,
Hans-Jörg Epple,
Christina Forstner,
Christoph-T. Germer,
Daniel Gotthardt,
Beate Grüner,
Stefan Hagel,
Werner Heinz,
Max Hilscher,
Theresa Hippchen,
Mario Hoenemann,
Andreas Jansen,
Annabelle Jung,
Gernot Keyßer,
Maximilian Kittel,
Jens M. Kittner,
Jörg Krebs,
Peter Layer,
Bernhard Lembcke,
Uwe G. Liebert,
Norman Lippmann,
Stefan Löb,
Ansgar W. Lohse,
Florian Lordick,
Christoph Lübbert,
Carolin F. Manthey,
Verena Moos,
Reinier Mutters,
Michael Neumaier,
Joachim Richter,
Arne Rodloff,
Jonas Rosendahl,
Ulrich Rosien,
Jörn M. Schattenberg,
Ingolf Schiefke,
Stefan Schmiedel,
Thomas Schneider,
Klaus Schröppel,
Arno Siebenhaar,
Peter Sothmann,
Ulrich Spengler,
Andreas Stallmach,
Eduard F. Stange,
Gertraud Stocker,
Niels Teich,
Roger Vogelmann,
Jan Wehkamp,
Thomas Weinke
MEHR ANZEIGEN
Bücher zum Thema antibiotics
Sie suchen ein Buch über antibiotics? Bei Buch findr finden Sie eine große Auswahl Bücher zum
Thema antibiotics. Entdecken Sie neue Bücher oder Klassiker für Sie selbst oder zum Verschenken. Buch findr
hat zahlreiche Bücher zum Thema antibiotics im Sortiment. Nehmen Sie sich Zeit zum Stöbern und finden Sie das
passende Buch für Ihr Lesevergnügen. Stöbern Sie durch unser Angebot und finden Sie aus unserer großen Auswahl das
Buch, das Ihnen zusagt. Bei Buch findr finden Sie Romane, Ratgeber, wissenschaftliche und populärwissenschaftliche
Bücher uvm. Bestellen Sie Ihr Buch zum Thema antibiotics einfach online und lassen Sie es sich bequem nach
Hause schicken. Wir wünschen Ihnen schöne und entspannte Lesemomente mit Ihrem Buch.
antibiotics - Große Auswahl Bücher bei Buch findr
Bei uns finden Sie Bücher beliebter Autoren, Neuerscheinungen, Bestseller genauso wie alte Schätze. Bücher zum
Thema antibiotics, die Ihre Fantasie anregen und Bücher, die Sie weiterbilden und Ihnen wissenschaftliche
Fakten vermitteln. Ganz nach Ihrem Geschmack ist das passende Buch für Sie dabei. Finden Sie eine große Auswahl
Bücher verschiedenster Genres, Verlage, Autoren bei Buchfindr:
Sie haben viele Möglichkeiten bei Buch findr die passenden Bücher für Ihr Lesevergnügen zu entdecken. Nutzen Sie
unsere Suchfunktionen, um zu stöbern und für Sie interessante Bücher in den unterschiedlichen Genres und Kategorien
zu finden. Unter antibiotics und weitere Themen und Kategorien finden Sie schnell und einfach eine Auflistung
thematisch passender Bücher. Probieren Sie es aus, legen Sie jetzt los! Ihrem Lesevergnügen steht nichts im Wege.
Nutzen Sie die Vorteile Ihre Bücher online zu kaufen und bekommen Sie die bestellten Bücher schnell und bequem
zugestellt. Nehmen Sie sich die Zeit, online die Bücher Ihrer Wahl anzulesen, Buchempfehlungen und Rezensionen zu
studieren, Informationen zu Autoren zu lesen. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen das Team von Buchfindr.