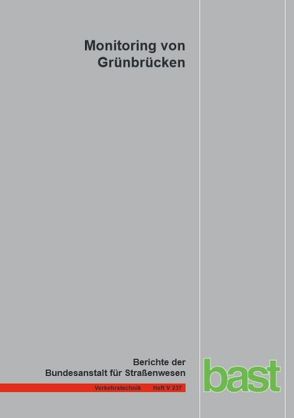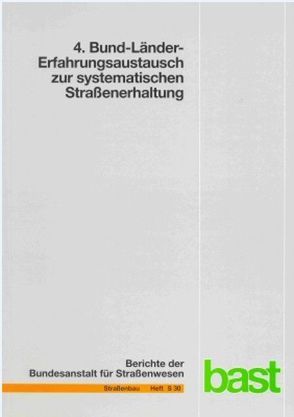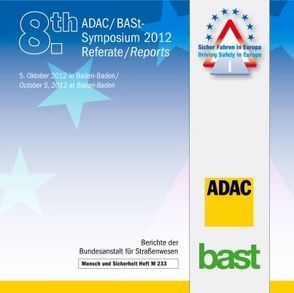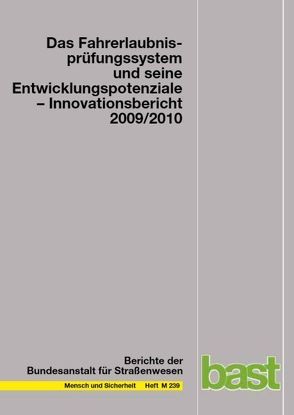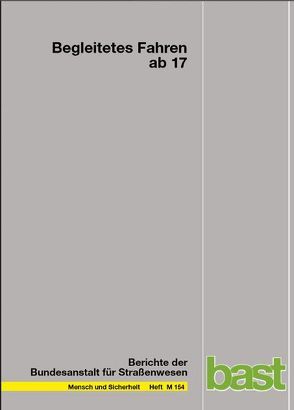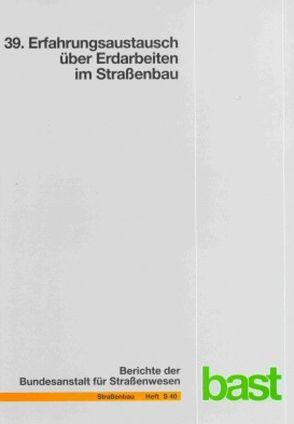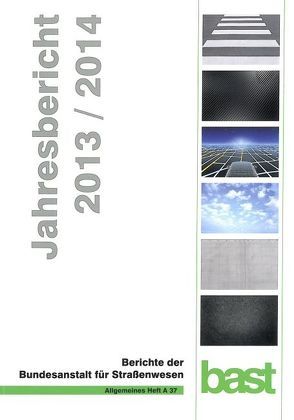Diese Arbeitshilfe dient dem Nachweis der Wirksamkeit von Grünbrücken, die im Rahmen des Konjunkturpakets II für die Wiedervernetzung von Lebensräumen an bestehenden Bundesfernstraßen erstellt wurden. Sie wurde im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung von einem Arbeitskreis der Bund-/Länder-Dienstbesprechung "Landschaftspflege und Naturschutz im Straßenbau", unter Federführung der Bundesanstalt für Straßenwesen, Referat "Umweltschutz", mit Beteiligung externer Experten erstellt.
Aktualisiert: 2019-01-17
> findR *

BASt F 87: Internationale Konferenz ESAR, „Expertensymposium Accident Research“
CD (462 S.), ISBN 978-3-95606-021-2, 2013, kostenlos (auch auf der Datenbank erhältlich)
Im Jahr 2012 fand an der Medizinischen Hochschule Hannover nun zum fünften Mal nach der ersten in 2004 und danach alle 2 Jahren implementierte ESAR Konferenz (Expert Symposium on Accident Research) statt. ESAR stellt eine internationale Zusammenkunft von Experten dar, die weltweit Verkehrsunfälle wissenschaftlich analysieren und hier ihre Ergebnisse diskutieren. ESAR verbindet Behördenvertretern, Entwicklungsingenieure der Automobilindustrie und Wissenschaftlern miteinander und bietet ein Forum mit besonderem Schwerpunkt auf In-Depth-Analysen der Unfallstatistik und Unfallanalysen. Besondere Berücksichtigung finden Forschungen auf der Basis von so genannten „Erhebungen am Unfallort“, die durch umfassende Dokumentationen vom Unfallort, den Fahrzeugen und den Verletzungen unter Einbeziehung mehrere Fachdisziplinen geprägt sind. ESAR will multi-disziplinär die wissenschaftlichen Erkenntnisse zusammenzutragen und auf einer wissenschaftlich internationalen Ebene diskutieren und ist somit wissenschaftliches Kolloquium und Plattform für einen Informationsaustausch aller Unfallforscher. Erfahrungen in der Unfallprävention und dem komplexen Feld der Unfallrekonstruktion werden dargelegt und um neue Felder der Forschung eröffnet. Bestehende Ergebnisse langjähriger Forschungsarbeiten in Europa, USA, Australien und Japan beinhalten unterschiedliche infrastrukturelle Zusammenhänge und geben Erkenntnisse über Population, Fahrzeugbestand und Fahrereigenschaften, die eine Basis für abzuleitende Empfehlungen und Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit bieten.
International Conference ESAR, "Expert Symposium Accident Research"
In 2012 the fifth ESAR conference (Expert Symposium on Accident Research) was held in Hannover. ESAR is an international convention of experts, who analyze traffic accidents all over the world and discuss their results in this context, conducted at the Medizinische Hochschule Hannover every 2 years. It connected representatives of public authorities, engineers in automotive development and scientists and offers a forum with particular emphasis on In-Depth-Analyses of accident statistics and accident analyses. Special focus is placed on research on the basis of so-called „In-Depth-Accident-Investigations“ [data collections at the sites of the accidents], which are characterized by extensive documentations of the sites of the accidents, of the vehicles as well as of the injuries, encompassing several scientific fields. ESAR aims at a multi-disciplinary compilation of scientific results and at discussing them on an international, scientific level. It is thus a scientific colloquium and a platform for exchanging information for all accident researchers. Experiences in accident prevention as well as in the complex field of accident reconstruction are stated and new research fields are added. Existing results of long-term research work in Europe, the US, Australia and Japan include different infrastructural correlations and give findings on population, vehicle population and driver characteristics, which offer a basis for recommendations to be derived and measures for increasing road safety.
Aktualisiert: 2019-01-17
> findR *

Beiträge des Kolloquiums am 6.12.04 in der BASt in Zusammenarbeit mit dem ADAC e.V. und dem DVR e.V.
Das einwohnerbezogene Risiko, im Laufe eines Jahres im Straßenverkehr zu sterben, steigt bei Kindern und Jugendlichen von
o 17 Getöteten je 1 Mio. Einwohner im Kindesalter über
o 112 Getötete je 1 Mio. Einwohner im Alter von 15 bis 17 Jahren bis zu
o 207 Getötete je 1 Mio. Einwohner und Jahr im Alter zwischen 18 und 24 Jahren. Das ist ein Anstieg um das 12fache.
Vor diesem Hintergrund wird im Programm für mehr Sicherheit im Straßenverkehr des BMVBW des Jahres 2001 (S. 14) gefordert, ". Verkehrserziehung in der Schule in allen Jahrgangsstufen" durchzuführen.
Die Ergebnisse der Studie "Verkehrserziehung in der Sekundarstufe" stellten die Grundlage dieses Kolloquiums dar.
Rund hundert Experten aus dem Bereich Verkehrserziehung nahmen an der Veranstaltung teil, darunter die für Verkehrserziehung zuständigen Referenten der Länder, Fachberater für Verkehrserziehung, Lehrer und Polizeibeamte und zahlreiche Vertreter wissenschaftlicher Institute, der Lehrerfortbildung und der Verbände, die sich mit der Verkehrsund Mobilitätserziehung befassen.
Prof. Dr. Horst WEISHAUPT präsentierte die Ergebnisse der von der Bundesanstalt für Straßenwesen in Auftrag gegebenen Studie zur Situation der Verkehrserziehung in der Sekundarstufe. Dabei stellte er unter anderem dar, dass die Verkehrserziehung im Denken vieler Lehrer und Lehrerinnen keine wesentliche Rolle spielt. Er verwies aber auch darauf, dass die Situation der Verkehrserziehung je nach Schulart, Jahrgangsstufe, Größe der Schule und Bevölkerungsdichte unterschiedlich ist. Horst ROSELIEB vom niedersächsischen Kultusministerium hinterfragte die KMK Empfehlungen für Verkehrserziehung von 1994 vor dem Hintergrund der "Weishauptstudie".
In seinem Vortrag "Vom Ringen der Schulen um Wirksamkeit" betrachtete Michael FELTEN die Ergebnisse der Studie aus der Sicht des Lehrers und vor dem Hintergru 1l der allgemeinen Diskussion um den Zustand der Schule von heute. Er plädierte dafür, die Schüler stärker zu fordern und über den sich einstellenden Lernerfolg die Freude an der Leistung und am Lernen zu erhöhen.
In Workshops wurden die Ergebnisse der Studie diskutiert.
In Workshop I "Verkehrs und Mobilitätserziehung in der Sekundarstufe: Chancen, Ziele, Grenzen" forderten die Teilnehmer:
o Den Stellenwert der Verkehrs und Mobilitätser ziehung künftig zu erhöhen.
o Die Empfehlungen für Verkehrserziehung der KMK auf Umsetzbarkeit und Akzeptanz in der Lehrerschaft zu überprüfen.
o Klarheit hinsichtlich der wesentlichen Inhalte, Ziele und Methoden der Verkehrs /Mobilitätserziehung zu schaffen.
o Verkehrs und Mobilitätserziehung in den Lehr plänen aller Bundesländer zu verankern.
o Inhalte der Verkehrs /Mobilitätserziehung über prüfbar zu machen.
o Verkehrserziehung in die Lehrerausbildung zu in tegrieren.
o Die Lehrerfortbildung zu verstärken.
o Verkehrserziehung als kontinuierliche Aufgabe zu verstehen, die alle Altersgruppen einschließt.
Die Teilnehmer am Workshop II "Unterrichtsange
bote für Verkehrs und Mobilitätserziehung durch Verbände und Verlage" kamen u. a. zu folgenden Ergebnissen:
o Angebote für Verkehrs und Mobilitätserziehung sollten folgende Kriterien erfüllen:
schneller und wiederholbarer Einsatz, geringer Organisationsaufwand,
kurze Vorbereitungszeit.
o Angebote sollten moderne Anspracheformen beinhalten:
Gruppenerfahrung fördern,
aktive Mitarbeit beinhalten,
praktische Erfahrungen einbeziehen.
o In der Aus, Fort und Weiterbildung der Lehrer muss Verkehrs und Mobilitätserziehung inhaltlich und methodisch einbezogen werden.
Im Workshop III "Wissenschaftliche Studien an Schulen" wurde u. a. gefordert, bei der Durchführung bundesweiter Studien
die Genehmigungsverfahren anzugleichen
und ggf. Standards für den Datenschutz zu schaffen.
Insgesamt fand das Kolloquium bei den Teilnehmern eine sehr positive Resonanz.
Aktualisiert: 2019-01-17
> findR *
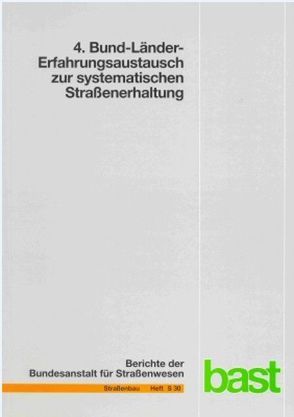
Die regelmäßig erhobenen Daten des Bund-Länder Verfahrens "Zustandserfassung und -Bewertung
auf Bundesfernstraßen" (ZEB) werden durch unter-schiedliche Informations-, Auswerfe-, und Mana-
gementsysteme bei der Straßenbauverwaltung ge-nutzt. Mit der Einrichtung und Anwendung dieser
Systeme in der Straßenbauverwaltung der Länder wurden und werden unterschiedliche Erfahrungen
gesammelt. Solche einzelnen Erfahrungen sollen allgemein genutzt werden können.
Die BASt organisiert deshalb seit 1995 zu diesem Themenkreis einen Erfahrungsaustausch für die Straßenbauverwaltung und Interessierte. Der jetzt organisierte 4. Erfahrungsaustausch soll wieder im Rahmen eines Workshops stattfinden, auf dem Teilnehmer aus Straßenbauämtern, Landesämtern und Ministerien miteinander diskutieren. Anwesend sind auch Vertreter von Ingenieurbüros, die im Rahmen der ZEB und des PMS tätig sind. Sie präsentieren ihre Ergebnisse im Foyer der BASt. Dieser 4. Erfahrungsaustausch bietet in Form des Workshops einen Überblick über die unterschiedlichen Bemühungen der Länder auf diesem Fachgebiet. Darum steht bei der Veranstaltung nicht der wissenschaftliche Hintergrund im Mittelpunkt, sondern die Praxis und insbesondere der praktische Nutzen für die Anwendung von ZEB-Ergebnissen bei Bund und Ländern vor Ort. Auch die ersten Erfahrungen bei der Verwendung des Pavement-Management-Systems in der Straßenbauverwaltung sollen durch diesen Workshop transparenter werden.
Aktualisiert: 2023-01-16
> findR *
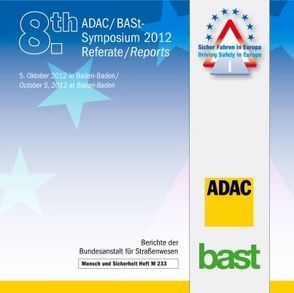
BASt M 233:
8. ADAC/BASt-Symposium 2012 – Sicher fahren in Europa – Referate
CD / kostenpflichtiger Download, ISBN 978-3-86918-298-8, 2013, EUR 18,00
Im Workshop zu den Risikogruppen werden auf den ersten Blick relativ heterogene
Themen angesprochen. Bei einigem Überlegen kann man aber feststellen, dass teils
explizit, teils in Form von Andeutungen die folgenden Aspekte eine wichtige Rolle
spielen:
• Antizipation und Gefahrenvermeidung vs. Gefahrenbewältigung
• Interaktion oder Kommunikation und deren Zusammenbruch beim Unfall zwischen
mehreren Verkehrsteilnehmern und analog dazu die Frage, was beim Alleinunfall
schief geht; man kann nicht umhin, zu sehen, dass sowohl bei Kommunikations-zusammenbruch als auch beim Alleinunfall das Geschwindigkeitsthema zu Gast ist.
• Die Lage der Verantwortung: wie oft muss man auf Bewusstseinsbildung z.B. der
Kinder und Jugendlichen hinweisen, damit diese auf die Autos aufpassen und wie
sehr haben wir resigniert dabei, die Erwachsenen = die Autofahrer in die Pflicht
zu nehmen, wenn es um Kommunikation mit anderen geht.
• Die Empirie: was wissen wir im Sinne empirischer Daten darüber, was z.B. bei
Unfällen zwischen Radfahrern und Autofahrern an Kreuzungen tatsächlich vorgeht?
Aktualisiert: 2021-08-05
> findR *

Unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Bildung und Forschung mit Unterstützung des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen wurde der Forschungsverbund "Leiser Verkehr" ins Leben gerufen. Darin bildet das Forschungsprogramm "Leiser Straßenverkehr" einen herausragenden Bereich. Um Lärmminderungspotentiale konsequent auszuschöpfen und damit den Bau von lokal begrenzten, kostspieligen Infrastruktureinrichtungen (wie z.B. Schallschutzwänden) zu vermeiden, müssen Maßnahmen an der Quelle – in der Kontaktfläche Reifen/Fahrbahn – ansetzen, wobei das Gesamtsystem Reifen, Fahrzeug, Fahrbahn zu optimieren ist. 15 Partner aus Reifen-, Fahrzeug- und Straßenbauindustrie sowie der Forschung waren unter Leitung der Bundesanstalt für Straßenwesen von Mitte 2001 bis Ende 2003 an dem Projekt "Leiser Straßenverkehr" beteiligt.
Ausgehend von Untersuchungen auf fünf verschiedenen Fahrbahnoberflächen an 40 Reifensätzen, die sich durch Profil, Gummimischung und Unterbau unterschieden, zeigte einer der Reifen mit selbsttragender Seitenwand auf allen Belägen die größten Geräuschminderungen. Der Schalldruckpegel bei 80 km/h reduzierte sich um 1,3 dB(A) auf Splittmastixasphalt und um 1,7 dB(A) auf Betondecke mit Jutetuchlängsstrich gegenüber einem handelsüblichen Reifen.
An der Komponente Fahrzeug erfolgten Modifikationen am PKW-Radhaus, die das Gesamtpotential ausloteten. Die Geräuschreduzierung bei 80 km/h durch die Auskleidung mit schallabsorbierendem Schaumstoff sowie die zusätzliche Abdeckung der hinteren Radausschnitte und vorderen Radscheiben im Vergleich zum Serienradhaus betrug 0,5 dB(A) bis 2 dB(A) in Abhängigkeit des Belages.
Die optimierten Fahrbahnoberflächen zeigten im Vergleich zur Referenzoberfläche "nicht geriffelter Gussasphalt" z.T. deutliche Geräuschminderungen. Der Schalldruckpegel von LKW bei 80 km/h reduzierte sich auf einem verbesserten offenporigen Asphalt, gemessen auf der Bundesautobahn A1, um rd. 4 dB(A). Auf der Bundesstraße B56 wiesen Fahrbahnoberflächen aus offenporigem Beton, Waschbeton und lärmreduziertem Gussasphalt bei 100 km/h einen bis zu 6 dB(A) geringeren PKW-Vorbeifahrtpegel auf.
Die Gesamtbewertung aller optimierten Komponeten des Systems Reifen-Fahrzeug-Fahrbahn erfolgte in Form eines Experimentes auf der B56. Als Referenz fungierte ein mit handelüblichen Reifen und Sereinradhaus ausgestattetes Fahrzeug auf einer Fahrbahnoberfläche aus Splittmastixsasphalt bzw. Betondecke mit Jutetuchlängsstrich. Die Schallmessungen bei 80 km/h erzielten einen um 3 dB(A) verminderten Vorbeifahrtpegel auf einer Oberfläche aus lärmgemindertem Gussasphalt sowie einen um 7 dB(A) reduzierten Pegel auf einer Fahrbahn aus offenporigem Beton.
Die Weiterentwicklung von Fahrbahnübergängen an Brücken zielte auf die Annäherung der Schallemissionen bei der Reifenüberrollung an die der angrenzenden Fahrbahnoberfläche ab. Es wurden vier Varianten untersucht. Die Übergänge mit aufgeschraubten, wellenförmigen Blechen brachten eine Lärmminderung bis zu 3 dB(A) gegenüber einem repräsentativen regelgeprüften Fahrbahnübergang in Lamellenbauweise. Der neuentwickelte Lamellenübergang mit fugenfüllendem Elastomerprofil zeigte bei den Messungen noch nicht die erwartete Lärmminderungswirkung.
Über diese Forschungsaktivitäten hinaus wurden in situ-Messsysteme für zwei akustische Eigenschaften entwickelt, deren Erfassung bisher nur im Labor möglich war. Diese Parameter dienten u.a. der Erweiterung eines statistischen Modells ("SPERoN") zur Analyse des akustischen Verhaltens von dichten und offenporigen Fahrbahnoberflächen. Ein physikalisches Finite-Elemente-Modell zur Simulation von Reifen-Fahrbahn-Geräuschen befindet sich derzeit in der Entwicklung und soll bis Ende 2004 fertig gestellt sein.
Das diesem Bericht zugrunde liegende Vorhaben wurde aus Mitteln des Bundeministeriums für Bildung und Forschung unter dem Förderkreiskennzeichen 19 U 1055 gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser gemeinsamen Veröffentlichung liegt bei den Autoren.
Aktualisiert: 2023-01-16
> findR *
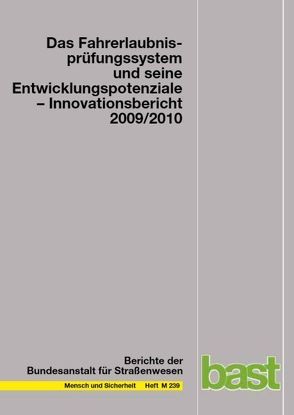
BASt M 239:
Das Fahrerlaubnisprüfungssystem und seine Entwicklungspotenziale – Innovationsbericht 2009/2010 – Innovationsbericht zur Optimierung der Fahrerlaubnisprüfung im Berichtszeitraum 2009/2010
68 S., 21 z.T. farb. Abb., inkl. CD im Anhang, ISBN 978-3-95606-035-9, 2013, EUR 16,00
Innovationsberichte dienen dem Ziel, alle zwei Jahre über die mit der mittel- und langfristigen Weiterentwicklung des Fahrerlaubnisprüfungssystems zusammenhängenden Forschungs- und Entwicklungsprozesse sowie ihre Ergebnisse zu informieren. Mit Hilfe der Innovationsberichte kann somit die Qualität, die Planmäßigkeit und die wissenschaftliche Absicherung der Weiterentwicklung der Fahrerlaubnisprüfung beurteilt werden.
Der vorliegende Innovationsbericht beschreibt die Hauptschwerpunkte der Tätigkeit der TÜV DEKRA arge tp 21 im Hinblick auf die Theoretische Fahrerlaubnisprüfung für den Berichtszeitraum 2009/2010. Diese lagen in (1) Arbeiten zur Modellierung von Fahrkompetenz, in der (2) Evaluation und Weiterentwicklung der traditionellen Aufgabenformate und der Prüfungsmethodik, in der (3) Durchführung von Forschungsarbeiten zur Verwendung computergenerierter dynamischer Fahrszenarien und in der (4) Erschließung innovativer Aufgabentypen zur Prüfung von bislang nicht ausreichend geprüften Fahrkompetenzkomponenten im Bereich des Handlungswissens.
Zu (1): Unter Berücksichtigung von inhaltlichen Anforderungsebenen des Fahrverhaltens (z. B. DONGES, 2009) und Aneignungsstufen von Fahrkompetenz (z. B. GRATTENTHALER, KRÜGER & SCHOCH, 2009) wurde ein „Fahrkompetenzstrukturmodell“ entworfen, um inhaltliche Komponenten der Fahrkompetenz darin einzuordnen und die Prüfungsaufgaben dementsprechend strukturieren zu können. Weiterhin lassen sich damit prototypische Anforderungssituationen zur Operationalisierung von Prüfungsinhalten erarbeiten sowie die Inhaltsbereiche und Fahrkompetenzbereiche beschreiben, welche durch verschiedene Prüfungsformen abgedeckt werden können.
Zu (2): Mit der Einführung der TFEP am PC wurden die technischen Rahmenbedingungen der Prüfungsdurchführung evaluiert (z. B. Bewerberprüfprogramm) und Optimierungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Manipulationssicherheit umgesetzt (z. B. Aufhebung der festen Verknüpfung von Grund- und Zusatzbogen, randomisierte Darbietungsreihenfolgen der Prüfungsaufgaben und Anordnung der Antwortalternativen innerhalb der einzelnen Aufgaben). Die auf dem Revisionsprojekt aufbauende kontinuierliche Evaluation der Prüfungsaufgaben und Paralleltests durch das Institut für Prävention und Verkehrssicherheit (IPV) zeigte grundsätzlich, dass die große Mehrheit der eingesetzten Prüfungsaufgaben unter Abwägung unterschiedlicher testpsychologischer Kriterien ihre Funktion zur Überprüfung der jeweiligen Kompetenzen erfüllt.
Zu (3): Zur Verbesserung der Darbietungsformen bzw. Instruktionsformate wurde von der TÜV DEKRA arge tp 21 die Softwarelösung „VICOM“ entwickelt. Mit dieser Software wurden zum einen die bisher verwendeten Fotos durch computergenerierte statische Abbildungen ersetzt, die mit geringem Aufwand erstellt und variiert werden können. Zum anderen wurde dadurch die Erarbeitung von dynamischen Videosequenzen ermöglicht. Die Erprobung von Aufgaben mit dynamischer Situationsdarstellung deutet darauf hin, dass die intendierte Erfassung der Kompetenzen zur Gefahrenerkennung mit dem neuen Instruktionsformat, das keine Lösungshinweise im Abschlussbild mehr enthält, besser gelingen könnte (FRIEDEL, WEIßE & RÜDEL, 2010).
Zu (4): Entwicklungspotentiale für die TFEP werden insbesondere bezüglich der Erfassung von Handlungskompetenzen im Bereich der Verkehrswahrnehmung und Gefahrenvermeidung deutlich. Diese verkehrssicherheitsrelevanten Kompetenzen können in der traditionellen „Wissensprüfung“ nicht geprüft werden, da ihre Aneignung beim Fahrerlaubnisbewerber Fahrerfahrungen voraussetzt, die zum Prüfungszeitpunkt in der Regel noch nicht gegeben sind. Auch in der traditionellen Fahrprüfung ist eine Erfassung dieser Kompetenzen nur eingeschränkt möglich, weil die Anforderungssituationen im Realverkehr nicht beliebig vom Fahrerlaubnisprüfer gesteuert werden können und Gefahrensituationen aufgrund von Sicherheitserfordernissen auch nicht herbeigeführt werden dürfen. Daher erscheint es notwendig, im Rahmen der deutschen Fahrerlaubnisprüfung eine innovative Prüfungsform zu entwickeln, bei der Verkehrs- und insbesondere Gefahrensituationen realitätsnah am Computer simuliert und zur Operationalisierung der obengenannten Kompetenzkomponenten genutzt werden. Derartige „Verkehrswahrnehmungstests“ (bzw. „Hazard Perception Tests“) finden sich bereits in den Fahranfängervorbereitungssystemen einiger europäischer und überseeischer Länder.
Zur weiteren Ausschöpfung der Potentiale der Fahrerlaubnisprüfung in Deutschland muss ihre Weiterentwicklung unter Berücksichtigung des Gesamtsystems der Fahranfängervorbereitung erfolgen. Zur Steigerung der Effizienz der Fahranfängervorbereitung sind die Qualitätssicherungs- und Weiterentwicklungsmaßnahmen neben Input-Vorgaben wie Lehrpläne und Prüfungsrichtlinien stärker auf Output-Vorgaben wie das von den Fahranfängern zu erreichende Kompetenzniveau zu fokussieren. In festzulegenden Ausbildungsstandards müssen Niveaustufen der Fahrkompetenz, die Fahranfänger bei den Übergängen zwischen den einzelnen Phasen der Fahranfängervorbereitung mindestens erreicht haben sollen, so konkret beschrieben werden, dass sie in Prüfungsaufgaben umgesetzt und im Rahmen der Fahrerlaubnisprüfungen erfasst werden können.
Aktualisiert: 2021-08-05
> findR *

Jahresbericht 2011/2012 Der Verkehr auf deutschen Straßen nimmt immer weiter zu. Einem auch in Zukunft gut funktionierenden, sicheren und ökonomisch wie ökologisch verträglichen System Straße widmet sich die Forschung der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt). Alle zwei Jahre berichtet die BASt über ihre Aufgaben, Forschungsprojekte und ausgewählte Themen der Verwaltung. Der aktuelle Bericht umfasst die Jahre 2011 und 2012. Auf 151 Seiten gibt er einen kleinen Einblick in die aktuelle Forschung zu wichtigen Themen des Straßenwesens. In den Projekten SKRIBT und SKRIBTPlus wurde das Verhalten von Autofahrerinnen und Autofahrern in Gefahrensituationen im Tunnel untersucht. Es stellte sich heraus, dass in solchen Situationen oft falsch und zu spät reagiert wird. Durch die gesammelten Daten konnten neue Konzepte entwickelt werden, die das Verhalten bei Gefahren in Tunneln verbessern. In Kraftfahrzeugen kamen zwar in den letzten Jahren neue Sicherheitssysteme zum Einsatz, die in Gefahrensituationen das Bremsverhalten verbessern. Bisher ist es jedoch für den Endverbraucher schwer, unterschiedliche Systeme zu vergleichen, da keine geeigneten Bewertungen herangezogen werden können. Im EU-Projekt ASSESS (Assessment of Integrated Vehicle Safety Systems for improved vehicle safety), an dem die BASt maßgeblich beteiligt ist, wurde deshalb an einem einheitlichen Verfahren zur Bewertung und an juristischen Fragenstellungen gearbeitet. Viele europäische Länder sind sich einig: Alkohol, Drogen und Medikamente im Straßenverkehr gefährden die Sicherheit auf Europas Straßen. Um sich ein genaueres Bild machen zu können und geeignete Gegenmaßnahmen zu entwickeln, bewilligte die Europäische Kommission das bisher größte Forschungsprojekt zur Verbesserung der Verkehrssicherheit: DRUID (Driving Under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines). An dem fünf Jahre dauernden und von der BASt koordinierten Projekt, beteiligten sich Institute aus 18 europäischen Ländern. Das Ergebnis ist eine umfassende Bestandsaufnahme sowie konkrete Maßnahmenvorschläge. Die Arbeit der BASt umfasst im großen Maße auch den Ausbau und Erhalt der gesamten Straßeninfrastruktur. Der Beitrag „Wie bauen wir in der Zukunft: Straßenbau ohne OEl?“ geht beispielsweise der Frage nach, wie wir bei immer knapper werdenden und teuer zu bezahlenden Ressourcen unsere Straßen zukünftig erhalten und ausbauen werden. Auch die Aktion „auf“ der Straße spielt eine große Rolle in der BASt. Seit Jahren zeichnet sich ein Mangel an Parkplätzen für Lkw an Bundesautobahnen ab. Um hier Abhilfe zu schaffen, hat die BASt einen neuen Steuerungsansatz entwickelt: Beim sogenannten Kompaktparken werden Kapazitäten erhöht und effektiver genutzt, indem Lkw in Reihe, nach ihrer geplanten Abfahrzeit, geparkt werden.
Aktualisiert: 2022-12-14
> findR *
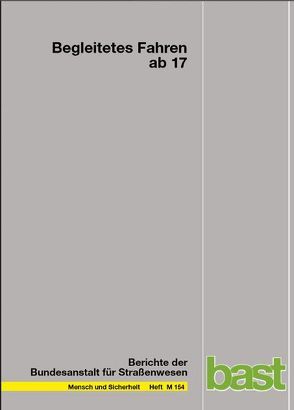
In Deutschland besteht ein hoher verkehrspolitischer Handlungsbedarf zur Absenkung des Unfallrisikos junger Fahrer. Mit einem fünffach höheren Risiko gegenüber dem Gesamtdurchschnitt ist die Altersgruppe der 18- bis 20-Jährigen am stärksten gefährdet. In dieser jüngsten Altersgruppe der Pkw-Fahrer finden sich die höchsten Anteile von Fahranfängern.
Derzeit bestehen in Deutschland noch keine Maßnahmenansätze, um Fahranfänger bereits zum Start in die selbstständige Fahrkarriere mit umfassenderen fahrpraktischen Erfahrungen auszustatten. Im Ausland wurden dagegen in den 90er Jahren mit fahrpraxisbezogenen Maßnahmenansätzen bereits beträchtliche Erfolge erzielt: So konnte in Schweden das Unfallrisiko von Fahranfängern um bis zu 40 Prozent, in Nordamerika - je nach Maßnahmenausgestaltung - zwischen 4 und 60 Prozent gesenkt werden (GREGERSEN, 2000; MEI-LI LIN, 2003).
Im Mai 2002 richtete der Bundesminister für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen bei der Bundesanstalt für Straßenwesen die Projektgruppe "Begleitetes Fahren" mit Experten aus Bund und Ländern, Verbänden und Wissenschaft ein. Die Projektgruppe erhielt den Auftrag, die Obertragbarkeit der ausländischen Erfahrungen zu prüfen und ggf. einen Modellvorschlag für einen fahrpraxisbezogenen Maßnahmenansatz in Deutschland zu erarbeiten.
Als Ergebnis ihrer Arbeit legt die Projektgruppe mit dem vorliegenden Bericht den Modellvorschlag "Begleitetes Fahren ab 17" vor, verbunden mit der Aufforderung an den Bundesminister für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, damit die interessierten Bundesländer den Maßnahmenansatz erproben können.
Nach dem Vorschlag der Projektgruppe erhalten Fahranfänger mit dem Begleiteten Fahren die Möglichkeit einer zusätzlichen Übungspraxis von bis zu einem Jahr vor dem Beginn des selbstständigen Fahrens ab 18 Jahren. Auf der Grundlage wissenschaftlicher Abschätzungen zur Kompetenzentwicklung bei Fahranfängern wird ein Übungsumfang von 5.000 km empfohlen.
Die Projektgruppe sieht dass "Begleitete Fahrbn ab 17" als eine Ergänzung der anderen Maßnahmenansätzen für junge Fahrer und Fahranfänger, nicht als eine Alternative oder Konkurrenz. Das Begleitete Fahren verfolgt mit dem längerfristigen Aufbau fahrpraktischer Erfahrungen eine eigenständige Aufgabenstellung, die von den anderen Maßnahmenansätzen nicht wahrgenommen wird. Ebenso wie die freiwillige Fortbildung von Fahranfängern (Zweiphasenausbildung), für die im Mai 2003 die erforderliche Rechtsgrundlage geschaffen wurde, und das Pkw-Sicherheitstraining ist das Begleitete Fahren als ein freiwilliges Modell angelegt, das Fahranfängern zusätzliche Möglichkeiten des Dazulernens bietet.
Das Projektgruppenmodell ist auf das Ziel einer Sicherheitsverbesserung für Fahranfänger ausgerichtet. Diese Zielsetzung wird mit den Zielen der Zugangsfreundlichkeit und der Praktikabilität verbunden, damit eine breite Nutzung des Modells und die Ausschöpfung seines Sicherheitspotenzials ermöglicht wird.
Die Projektgruppe geht aufgrund der Daten zum Risikoverlauf nach dem Fahrerlaubniserwerb (Halbierung des Anfangsrisikos nach neun Monaten Fahrpraxis) von einem hohen Potenzial zur Absenkung des Fahranfängerrisikos aus. Der tatsächlich erzielbare Sicherheitsertrag des Begleiteten Fahrens in Deutschland ist jedoch im Rahmen einer praktischen Erprobung zu klären.
Aktualisiert: 2019-01-17
> findR *

Der Bau und die Unterhaltung öffentlicher Straßen belasten die öffentlichen Haushalte in erheblichem Maße. Deshalb wird in der Bundesrepublik Deutschland nach zunächst langem Zögern nun, ausländischen Vorbildern folgend, schon seit mehr als zehn Jahren über die private Finanzierung dieser Aufgabe diskutiert; teilweise sind einzelne Vorhaben bereits in neuer Form finanziert worden. Zugleich ist die herkömmliche Form, in der Aufgaben der Straßenverwaltung wahrgenommen werden, in einigen Bundesländern als unbefriedigend angesehen und daher durch neue Organisationsstrukturen ersetzt worden. Beide Entwicklungen wurden vom Arbeitsausschuss "Straßenrecht" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen auf seinem Forschungsseminar über "Straßenbaufinanzierung und -verwaltung in neuen Formen" am 23. und 24. September 2002 an der Universität des Saarlandes ausführlich erörtert; die in diesem Band veröffentlichten vier Referate betreffen zum einen die Finanzierungsaspekte und zum anderen die organisatorischen Fragen.
In seinem Beitrag über "Neue Finanzierungsformen für den Straßenbau" stellt Michael UECHTRITZ vor dem Hintergrund der bisherigen Diskussion die Grundideen der neueren Überlegungen - Nutzerfinanzierung und Privatfinanzierung sowie Organisationsprivatisierung - vor, die nach seiner Ansicht weder gemeinschaftsrechtlichen noch verfassungsrechtlichen Bedenken begegnen. Einen Einstieg in die Nutzerfinanzierung bildet die Einführung der Maut für schwere Nutzfahrzeuge bei der Benutzung von Autobahnen (so genannte Lkw-Maut), die private Finanzierung von Fernstraßenabschnitten ist im Fernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetz geregelt, stößt jedoch auf Anwendungsprobleme, die auch durch die kürzlich erfolgte Novellierung des Gesetzes nicht völlig behoben sind. Um diese Schwierigkeiten zu vermeiden, ist im Bundesverkehrsministerium ein Betreibermodell für den mehrstufigen Autobahnausbau (so genanntes A-Modell) entwickelt worden, bei dem der Ausbau durch Private und die Refinanzierung aus dem Aufkommen der Lkw-Maut sowie durch eine Anschubfinanzierung aus dem Bundeshaushalt erfolgen soll, doch bleibt zweifelhaft, ob das Modell sinnvoll realisiert werden kann; Gleiches gilt für die in der vorigen Legislaturperiode angestrebte Gründung einer privatrechtlich organisierten Verkehrginfrastrukturgesellschaft. Insgesamt sind die.einzelnen Elemente neuerer Finanzierungsformen zudem nicht oder nur unzureichend aufeinander abgestimmt, so dass ihre Harmonisierung wünschenswert ist.
Gerhard GEYER schildert in seinem Referat über "Mischfinanzierung des Straßenbaus durch Bund, Länder und Gemeinden" Ansätze in der Praxis, eine gemeinsame Finanzierung von Bundesfernstraßen aus Bundes- und Landesmitteln - ggf. unter Beteiligung weiterer juristischer Personen des öffentlichen Rechts - zu erreichen, die er für verfassungswidrig hält. Auch ein finanzieller Interessenausgleich unterschiedlicher Baulastträger ist auf der Grundlage des einfachen Rechts nur in besonders gelagerten Fällen zulässig, wie sich bereits unter dem Aspekt der Straßenklassifizierung und dem Gesichtspunkt der Planrechtfertigung, aber auch aus den Bestimmungen des Kommunalrechts ergibt. Im Freistaat Bayern ist freilich ein Modell entwickelt worden, bei dem der Staat sich an dem Bau einer Staatsstraße durch die Gemeinde finanziell beteiligt, das auch der Bayerische Verwaltungsgerichtshof als zulässig angesehen hat. In der Praxis finden sich indessen mehrere Beispiele der Mischfinanzierung, vor allem in Form der Vorfinanzierung, die jedoch auf erhebliche rechtliche Bedenken stoßen.
Joachim MAJCHEREK berichtet über die im Zuge der Verwaltungsreform in Nordrhein-Westfalen erfolgte Neuorganisation der Landesstraßenbauverwaltung durch die Überleitung der bisher von den Landschaftsverbänden wahrgenommenen Aufgaben im Bereich der Straßenbauverwaltung auf den Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen ("Straßen.NRW") und schildert die Organisation des Landesbetriebs und seine Aufgaben als Dienstleistungsunternehmen sowie die gegenüber der früheren Rechtslage eingetretenen Veränderungen, wesentliche Aspekte der Finanzierung und der voraussichtlichen künftigen Entwicklung.
Im Anschluss stellt Jutta SCHMIDT den im Gefolge der Neuorganisation der rheinland-pfälzischen Bezirksregierungen geschaffenen "Landesbetrieb Straßen und Verkehr Rheinland-Pfalz (LSV)" dar. Ihr Beitrag geht näher auf die Überlegungen vor der Errichtung des Landesbetriebes, auf seine Rechtsstellung, seine innere Struktur, seine Aufgaben und Ziele sowie sein Finanzwesen und die ihm eingeräumten Mittel ein.
Aktualisiert: 2023-01-16
> findR *
Bestandsaufnahme aktueller Forschung auf dem Gebiet der Verkehrsmedizin auch eine 50-Jahres-Bilanz der verkehrsmedizinischen Wissenschaft auf den wichtigsten Hauptgebieten zu ziehen und einen Ausblick in die Zukunft zu wagen. Darüber berichtet der vorliegende Band.
Aktualisiert: 2020-01-16
> findR *

Gerhard GEYER schildert die Entwicklung seit Ende der achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts und geht insbesondere auf das Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz und das Planungsvereinfachungsgesetz sowie auf das Instrument der Investitionsmaßnahmegesetze ein. Weiterhin berichtet er über neuere Initiativen, durch die die Planung von Verkehrsprojekten beschleunigt werden soll, vor allem über die Verlängerung der Geltung des Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetzes und über die Vorschläge des Länderfachausschusses Straßenbaurecht, die in dem Eckpunktepapier zur "Beschleunigung der Planungsverfahren für Bundesfernstraßen" enthalten sind. Nachdrücklich weist der Referent auf die Notwendigkeit hin, für die durch beschleunigte Verfahren vermehrt geschaffenen Baurechte zeitgerecht Mittel zur Verwirklichung der Vorhaben bereit zu stellen. Schließlich betont er im Hinblick auf die künftige Entwicklung den wachsenden Einfluss des europäischen Rechts, insbesondere im Umweltbereich, auf die Ausgestaltung und die Dauer der Verfahren.
Jutta SCHMIDT wendet sich in ihrem Referat zunächst dem Umweltinformationsgesetz – in der Fassung vom 23. August 2001 – zu, das die europäische Umweltinformationsrichtlinie aus dem Jahre 1990 in nationales Recht umgesetzt hat, um sodann die in der europäischen Umweltrichtlinie vom 28. Januar 2003 enthaltenen Neuerungen darzustellen. Im Anschluss berichtet sie über die vorgesehene Gesetzesänderung und schildert insbesondere im Hinblick auf den Begriff der Umweltinformation anhand von Beispielen aus der Rechtsprechung die Auswirkungen auf die Straßenbauverwaltung.
Ulrich STELKENS behandelt in seinem Referat nicht lediglich die rechtsgeschäftliche, sondern ebenso die Vertretung des Bundes durch die Länder bei der Durchsetzung und Abwehr gesetzlicher Ansprüche zwischen den beim Vollzug der Bundesauftragsverwaltung involvierten Bundes- und Landesbehörden und Dritten. Als problematisch stellt sich dabei insbesondere die Vertretung in vermögensrechtlichen Angelegenheiten der Bundesfernstraßen dar, die auf einer Regelung in einer Allgemeinen Verwaltungsvorschrift des Bundes beruht, die historisch zu erklären ist. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dürfte der Bund indes bei der Bundesauftragsverwaltung gerade nicht von den mit der Vollziehung von Bundesauftragsangelegenheiten betrauten Landesbehörden vertreten werden; sondern die Länder sind nach der Auffassung des Referenten berechtigt und verpflichtet, diese Aufgaben im eigenen Namen wahrzunehmen, und zwar auch in vermögensrechtlichen Angelegenheiten der Bundesfernstraßenverwaltung.
Wolfgang MAß beschreibt in seinem Beitrag zunächst die Verwaltungspraxis in Bayern, die bei den verschiedenen vermögensrechtlichen Fallkonstellationen unterschiedlich vorgeht, jedoch meist das Land in Vertretung des Bundes handeln lässt, wohl in dem Bestreben, die Wahrnehmungskompetenz jeweils an die Sachfinanzierungskompetenz zu koppeln. Allerdings sind nach Ansicht des Referenten seit geraumer Zeit in Rechtsprechung und Literatur Tendenzen erkennbar, die bisherige Praxis zu erschüttern; er befürwortet eine einheitliche Regelung der Wahrnehmungskompetenz in der Vermögensverwaltung und regt eine gesetzliche Festlegung an.
Richard BARTLSPERGER geht in seiner Stellungnahme von denselben Grundannahmen wie STELKENS aus, misst jedoch der Regelung des Art. 90 Abs. 1 GG, der dem Bund das zivilrechtliche Eigentum an den Bundesfernstraßenverwaltung zuspricht, eine größere Bedeutung zu und differenziert deshalb zwischen den Fällen, in denen die Länder unmittelbar aus dem Eigentum des Bundes fließende Rechte geltend machen – dies sei nur im Namen des Bundes möglich – und allen anderen Fällen mit vermögensrechtlichen Bezug, bei denen die Länder entsprechend der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts außenwirksame Maßnahmen im eigenen Namen wahrzunehmen hätten. Im Ergebnis mahnt daher auch BARTLSPERGER einen sorgfältigeren Umgang mit den verfassungsrechtlichen Vorgaben bei der Vermögensverwaltung der Bundesfernstraßen an.
Aktualisiert: 2023-01-16
> findR *

Der Allgemeine Deutsche Automobilclub e. V. (ADAC) und die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) veranstalteten am 7. und 8. Oktober 2003 in Wiesbaden ihr 5. Symposium "Sicher fahren in Europa". Nach 1991, 1994, 1997 und 2000 trafen sich erneut über 200 Fachleute aus Wissenschaft, Politik, Verwaltung, Industrie, Wirtschaft und Verbänden aus ganz Europa und einigen außereuropäischen Ländern, trugen neue Forschungsergebnisse vor und erörterten aktuelle Ansätze zur Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr. Dabei ging es in Vortrags- und Diskussionsbeiträgen vor allem darum, folgende verkehrspolitischen Herausforderungen und Entwicklungen für eine europaweite Verkehrssicherheitsarbeit zu beleuchten:
o die Umsetzung des 3. Verkehrssicherheits-Aktionsprogrammes der EU-Kommission bis 2010, dessen Diskussion gerade begonnen hat,
o die zusätzlichen Probleme und Herausforderungen für die Verkehrssicherheit, die ab 2004 durch den EU-Beitritt von 10 weiteren Mitgliedsländern entstehen,
o das Bestreben vieler EU-Mitgliedsstaaten, ihre nationale Identität und ihre regionalen Besonderheiten auch auf dem Gebiet der Verkehrssicherheit zu bewahren, um die Akzeptanz und Effizienz von praktischen Maßnahmen zu sichern, ein Ziel, dem sich auch der "EU-Konvent zur Zukunft Europas" verschrieben hat.
Diesen ebenso aktuellen wie grundsätzlichen Anforderungen entsprach das Veranstaltungsprogramm mit seinen verkehrspolitischen Eröffnungsvorträgen und mit drei Fachsitzungen
o zur Verbesserung der Fahrzeugsicherheit,
o der Verbesserung der Straßensicherheit und
o zur Verbesserung des Verhaltens von Verkehrsteilnehmern.
Eine Podiumsdiskussion "Zur Harmonisierung von Verkehrsüberwachung und Sanktionen" schloss die Veranstaltung ab.
Alle Vorträge und Diskussionsbeiträge wurden im vorliegenden Berichtsband dokumentiert.
Aktualisiert: 2019-01-17
> findR *
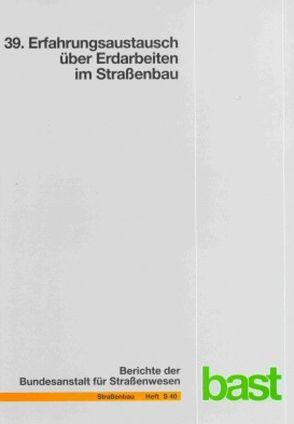
Am 39. Erfahrungsaustausch über Erdarbeiten im Straßenbau (EAT) am 5. und 6. Mai 2004 nahmen neben Vertretern des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Wohnungswesen und der Straßenbaubehörden der Länder auch Vertreter der Bundesanstalt für Wasserbau und der DEGES teil.
Der Erfahrungsaustausch dient dazu, Erfahrungen mit neuen Bauweisen und der Anwendung neuer Regelwerke und Prüfverfahren mitzuteilen und zu diskutieren. Schwerpunkt des 39. EAT war die laufende Überarbeitung der ZTV E StB. Die Straßenbaubehörden der Länder hatten im Vorlauf zur Tagung ihre Kritikpunkte und Anregungen dazu der Bundesanstalt für Straßenwesen mitgeteilt. Diese hatte daraus eine Synopse erarbeitet, deren Inhalte bei der Tagung im Einzelnen diskutiert wurden.
Die Informationen aus der Arbeitsgruppe 5 "Erdund Grundbau" der FGSV beinhalteten neben personellen und organisatorischen Veränderungen in den Gremien den aktuellen Stand der Regelwerksbearbeitung und inhaltliche Schwerpunkte der Arbeiten in der Arbeitsgruppe. Die Informationen aus der BASt umfassten die europäische Normung, die Forschungsprojekte im gemeinsamen Forschungsprogramm von BMVBW, BASt und FGSV sowie die Schwerpunkte der Themen, die in der BASt bearbeitet werden. Außerdem wurde ein Sachstandsbericht zur Überarbeitung der "Richtlinien für die umweltverträgliche Anwendung von industriellen Nebenprodukten und Recycling Baustoffen im Straßenbau" (RuA StB) und zum Forschungsprojekt "Sickerwasserprognose" des BMBF gegeben.
Der Diskussion über die Überarbeitung der ZTV E StB waren zwei Sachstandsberichte der zuständigen Gremienleiter vorangestellt. Die Diskussion über die zu überarbeitenden Inhalte der ZTV E StB erfolgte abschnittsweise entsprechend der Gliederung dieser Vertragsbedingungen. Besondere Schwerpunkte der Diskussion waren u. a.: Größe des Luftporenanteils und bautechnische Maßnahmen zu dessen Einhaltung, Sinnhaftigkeit des Begriffs "frostunempfindliches Material" und dessen Definition, Berücksichtigung und Integration des Abfallrechts sowie des Boden und Grundwasserschutzes bei Erdbauwerken, Einstufung in die Bodenklassen 6 und 7 (Fels), Beurteilung der Wasserverhältnisse, Notwendigkeit von Abtreppungen bei geneigtem Gelände, Verdichtung der Böschungen, Dauerhaftigkeit der Tragfähigkeit des Planums. Verdichtungsanforderungen in Hinterfüllbereichen, "qualifizierte" Bodenverbesserung, Prüfmethoden, Richtwerte für die Zuordnung von Verdichtungsgrad und Verformungsmodul, indirekte Prüfverfahren, Anforderungen an den dynamischen Verformungsmodul.
Die Fachexkursion am 6. Mai 2004 führte zu Baustellen im Zuge der B 6n, die bis 2007 als zweistreifige Bundesstraße zwischen der BAB A 395 und der BAB A 14 ausgebaut wird. Dabei wurde u. a. über die Gewinnung und Wiederverwertung von Oberkreidegestein im Zuge des Neubaus berichtet. Der Neubau wird vorlaufend von umfangreichen archäologischen Grabungen begleitet, die einen Einblick in die Natur und Kulturgeschichte der Nordharzregion geben.
Aktualisiert: 2023-01-16
> findR *
Im Dezember 2009 wurde nach vier Jahren Forschungsarbeit das durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) geförderte Forschungsprojekt Leiser Straßenverkehr 2 erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt elf Partner aus Industrie und Forschung haben gemeinsam Lösungen erarbeitet, wie der Straßenverkehrslärm dauerhaft reduziert werden kann. Die Projektkosten wurden auf ca. 4,5 Mio. Euro veranschlagt und werden jeweils zu 50% vom BMWi und den Forschungspartnern getragen. Der Bau der Erprobungsstrecken wird aus Baumitteln finanziert. Auf diese Weise unterstützt das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) das Projekt Leiser Straßenverkehr 2.
Aktualisiert: 2023-01-16
> findR *
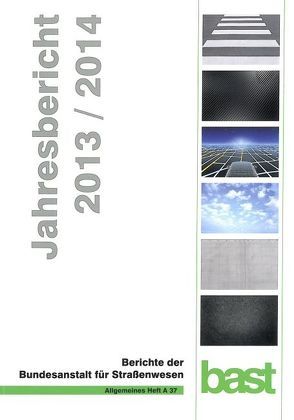
BASt A 37: Jahresbericht 2013 / 2014
168 S., zahlreiche Fotos und Abbildungen, ISBN 978-3-95606-158-5, 2015, kostenlos
Um den Straßenverkehr in Deutschland weiterhin sicher gestalten und aufrecht erhalten zu können, braucht es anwendungsnahe Forschung in den unterschiedlichen Fachdisziplinen des Straßenwesens. In Deutschland gibt es neben der Bundesanstalt für Straßenwesen kein zweites Forschungsinstitut auf diesem Gebiet, in dem sämtliche Disziplinen zu Hause sind: Fahrzeugtechnik ebenso wie Straßenverkehrs- und -bautechnik, Brücken- und Ingenieurbau in enger Verzahnung mit der Unfallforschung und der wissenschaftlichen Erkenntnis zum menschlichen Verhalten im Straßenverkehr. Eine bedarfsgerechte Verkehrspolitik und der Wille zur Verbesserung der Verkehrssicherheit setzt eine objektive wissenschaftliche Fachexpertise voraus.
Die BASt hält Schritt mit der Industrie, geht neue Wege und befasst sich intensiv mit neuen Technologien. Ich möchte an dieser Stelle ein Beispiel aus der Fahrzeugtechnik aufgreifen: die Fahrzeugsicherheitssysteme. Auf dem Weg zum automatisierten Fahren wächst die Zahl der zur Verfügung stehenden Fahrerassistenzsysteme stetig. Um diese zu validieren, bedarf es grundlegender Forschung und einheitlicher Prüfmechanismen, nicht zuletzt um den Verbrauchern Hilfestellung im Dschungel der Assistenten zu geben. Die BASt beobachtet nicht nur die Marktdurchdringung, sondern stellt hier – als Teil eines großen internationalen Forschungsnetzwerks – die Weichen für die Zukunft.
Erstklassige Fahrzeuge verlangen nach erstklassigen Straßen. Der hohe Standard des deutschen Infrastrukturnetzes muss aufrechterhalten werden. Der prognostizierte Verkehrszuwachs im Personen- und Güterverkehr muss bewältigt werden. Hier gilt es, nicht nur effektive und wirtschaftliche, sondern auch umweltfreundliche Methoden zu entwickeln, um das Straßennetz gegen immer höhere Belastungen zu wappnen.
Dabei sind es nicht immer nur die grundsätzlichen und nachhaltigen Lösungen, die im Fokus der Forschungsarbeit der BASt stehen – manchmal verlangt das Bundesverkehrsministerium nach innovativen und schnell umsetzbaren Maßnahmen. So entwickelte die BASt beispielsweise ein Schnellreparatursystem für Betonstraßen. Mit dieser Instandsetzungsmethode, die sich derzeit in der Erprobung befindet, könnten in Zukunft Schäden an Betonfahrbahnen deutlich ökonomischer und ökologischer als bislang beseitigt werden.
Ich danke allen Beschäftigten der BASt für ihr Engagement und freue mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit in der Zukunft. Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich ein kurzweiliges Studium des Jahresberichts 2013/2014.
Rainer Bomba, Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
Aktualisiert: 2022-12-14
> findR *

Am 38. Erfahrungsaustausch über Erdarbeiten im Straßenbau am 7. und 8. Mai 2002 nahmen neben Vertretern des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen und der Straßenbaubehörden der Länder auch Vertreter der Bundesanstalt für Wasserbau, der DEGES, des Bundesrechnungshofes und der Deutschen Bahn AG teil.
Der Erfahrungsaustausch dient dazu, Erfahrungen mit neuen Bauweisen und der Anwendung neuer Regelwerke und Prüfverfahren mitzuteilen und zu diskutieren. Schwerpunkte waren diesmal der Boden- und Grundwasserschutz im Straßenbau und Straßenbetrieb, die Vorstellung von Neuerungen im Regelwerk und Erfahrungen mit deren Anwendung sowie neue Baustoffe und Bauverfahren.
Nach Informationen aus dem BMVBW und über Aktivitäten in der BASt und der FGSV wurden die gesetzlichen Grundlagen des Boden- und Grundwasserschutzes vorgestellt und eine Übersicht über den aktuellen Stand des zugehörigen Regelwerkes des Straßenbaus gegeben. Im Detail wurden die Richtlinien über die umweltverträgliche Anwendung von industriellen Nebenprodukten und RC-Baustoffen (RuA-StB 01) mit den Mitteilungen 20 der LAGA verglichen. Des Weiteren befasste man sich mit neuen Forschungsergebnissen über Bodenbelastungen an Verkehrswegen und stellte die neuen Richtlinien über bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten (RiSt-Wag) vor. Zum Themenbereich Regelwerke wurden aus der Sicht des Erdbaus Betrachtungen zu den Neuerungen der RStO 01 angestellt und über die neuen Richtlinien über geotechnische Untersuchungen und geotechnische Berechnungen berichtet. Um baustoffbezogene Themen ging es bei den Erfahrungen aus dem Wasserbau über das Verhalten von Geosynthetischen Tondichtungsbahnen im gequollenen Zustand, den Erkenntnissen über den Einsatz von Geokunststoffen zur Sicherung bruchgefährdeter Straßenbereiche in Altbergbau- und Subrosionsgebieten und den Einsatz von Blähton als Leichtbaustoff beim Straßenbau auf wenig tragfähigem Untergrund. Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen über Bauweisen zur tiefgründigen Bodenstabilisierung im Verdrängungs- und Mischverfahren wurden in einem Überblick einschließlich der Kosten der verschiedenen Verfahren aufgezeigt. An Beispielen wurde über die Sicherung von steilen Böschungen mit Pflanzen (Lebend bewehrte Erde) und über die Sanierung einer Rutschung berichtet.
Die Fachexkursion am 8. Mai führte zur Baustelle eines Abschnittes der BAB A 17 von Dresden nach Prag, die in ihrem stadtnahen Streckenabschnitt 4 Brücken und 3 Tunnel aufweist, um Wohngebiete und Kleingartenanlagen zu schützen. Der bei den Tunnelvortrieben gewonnene Syenit wird aufbereitet und auf den Baustellen wieder verwendet.
Aktualisiert: 2023-01-16
> findR *
MEHR ANZEIGEN
Bücher von Bundesanstalt für Strassenwesen, Bereich Unfallforschung, Bergisch-Gladbach
Sie suchen ein Buch oder Publikation vonBundesanstalt für Strassenwesen, Bereich Unfallforschung, Bergisch-Gladbach ? Bei Buch findr finden Sie alle Bücher Bundesanstalt für Strassenwesen, Bereich Unfallforschung, Bergisch-Gladbach.
Entdecken Sie neue Bücher oder Klassiker für Sie selbst oder zum Verschenken. Buch findr hat zahlreiche Bücher
von Bundesanstalt für Strassenwesen, Bereich Unfallforschung, Bergisch-Gladbach im Sortiment. Nehmen Sie sich Zeit zum Stöbern und finden Sie das passende Buch oder die
Publiketion für Ihr Lesevergnügen oder Ihr Interessensgebiet. Stöbern Sie durch unser Angebot und finden Sie aus
unserer großen Auswahl das Buch, das Ihnen zusagt. Bei Buch findr finden Sie Romane, Ratgeber, wissenschaftliche und
populärwissenschaftliche Bücher uvm. Bestellen Sie Ihr Buch zu Ihrem Thema einfach online und lassen Sie es sich
bequem nach Hause schicken. Wir wünschen Ihnen schöne und entspannte Lesemomente mit Ihrem Buch
von Bundesanstalt für Strassenwesen, Bereich Unfallforschung, Bergisch-Gladbach .
Bundesanstalt für Strassenwesen, Bereich Unfallforschung, Bergisch-Gladbach - Große Auswahl an Publikationen bei Buch findr
Bei uns finden Sie Bücher aller beliebter Autoren, Neuerscheinungen, Bestseller genauso wie alte Schätze. Bücher
von Bundesanstalt für Strassenwesen, Bereich Unfallforschung, Bergisch-Gladbach die Ihre Fantasie anregen und Bücher, die Sie weiterbilden und Ihnen wissenschaftliche Fakten
vermitteln. Ganz nach Ihrem Geschmack ist das passende Buch für Sie dabei. Finden Sie eine große Auswahl Bücher
verschiedenster Genres, Verlage, Schlagworte Genre bei Buchfindr:
Unser Repertoire umfasst Bücher von
Sie haben viele Möglichkeiten bei Buch findr die passenden Bücher für Ihr Lesevergnügen zu entdecken. Nutzen Sie
unsere Suchfunktionen, um zu stöbern und für Sie interessante Bücher in den unterschiedlichen Genres und Kategorien
zu finden. Neben Büchern von Bundesanstalt für Strassenwesen, Bereich Unfallforschung, Bergisch-Gladbach und Büchern aus verschiedenen Kategorien finden Sie schnell und
einfach auch eine Auflistung thematisch passender Publikationen. Probieren Sie es aus, legen Sie jetzt los! Ihrem
Lesevergnügen steht nichts im Wege. Nutzen Sie die Vorteile Ihre Bücher online zu kaufen und bekommen Sie die
bestellten Bücher schnell und bequem zugestellt. Nehmen Sie sich die Zeit, online die Bücher Ihrer Wahl anzulesen,
Buchempfehlungen und Rezensionen zu studieren, Informationen zu Autoren zu lesen. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
das Team von Buchfindr.