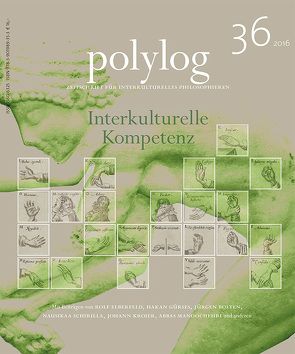Bianca Boteva-Richter, Nausikaa Schirilla Einleitung Interkulturelle Kompetenz
Interkulturelle Kompetenz wird in vielen Disziplinen diskutiert und die Spannbreite dessen, was unter dem Begriff und den damit verbundenen Strategien und Ansätzen verstanden wird, ist entsprechend groß: Während eine klassische Definition interkultureller Kompetenz diese im Kontext von interkulturellen Überschneidungssituationen, von auf kulturelle Differenz zurückgeführten Konflikten oder generell mit dem Umgang mit Fremdheit denkt, wird für andere Selbstreflexion und Machtkritik im Kontext von Ethnozentrismus und Rassismus zur zentralen Herausforderung auf diesem Gebiet. Aus philosophischer Sicht stellen sich einige wichtige Fragen hinsichtlich der Grundannahmen und Grundlagen dieses zurzeit sehr populären Konzeptes. Diese betreffen sowohl den Kompetenzbegriff als auch den Kulturbegriff oder bereits den Ansatz der Frage nach dem »Kulturellen«, die Wahrnehmung von Differenzen und die in ihnen potenziell enthaltenen Normierungen und Machtverhältnisse, die Frage nach den Eigenen und Anderen und nach dem Verstehen. Die Frage nach dem »Fremden« kann als Frage nach Wahrnehmungs- und Ordnungssystemen auf das Eigene zurückwerfen, im Sprechen über »Andere« können sich aber auch neue Strategien des »Othering« und der Diskursdominanz (wer spricht für und über wen?) entwickeln.
Zugleich ist die Einseitigkeit des Konzepts Interkulturelle Kompetenz zu kritisieren. Bei Menschen, die zu uns, aus einem – von uns aus gesehenen – Ausland, kommen, wird interkulturelle Kompetenz als durch den Umzug angeeignet bzw. bereits vorhanden vorausgesetzt. Für Andere wiederum, die in ein–von uns aus gesehenen–Ausland fahren, um dort zu arbeiten oder eine Zeitlang zu leben, werden Kurse über sogenannte kulturelle Eigenschaften des anvisierten Landes angeboten.
Interkulturelle Kompetenz hat auch mit einem starken Innen-Außen-Bild zu tun, und es werden gemäß dieser Einteilung Menschen bestimmte Fähigkeit ab- oder zugesprochen.
Doch sind die Innen-Außen-Grenzen durchlässig, und wer darüber bestimmt, was das Innen und Außen ausmacht, ist immer noch eine Frage der Macht. Wer Macht hat, hat das Sagen, und bestimmt auch darüber, was das Innere einer Kultur, und dementsprechend deren Außen, ausmacht. So wird auch darüber entschieden, wer zu einer Mehrheitskultur dazugehört, wer darüber hinaus interkulturelle Kompetenz besitzt, wer diese braucht und wer Kurse zur In(ter)kulturalisierung erhält, dies sind in der Regel Mitglieder der Mehrheitsgesellschaft. Zugewanderte erhalten Kurse zur Werteorientierung und Leitkultur.
In diesem Band, der auf eine Tagung von polylog, der Wiener Gesellschaft für Interkulturelle Philosophie (WiGiP), der Universität Wien und dem Institut für Wissenschaft und Kunst (IWK) in Februar 2015 zurückgeht, haben wir versucht, den Fragen nach Innen und Außen, Selbst und Fremdbild, Macht und Machtstrukturen innerhalb des Themenkomplexes der Interkulturallen Kompetenz nachzugehen.
Im ersten Beitrag von Jürgen Bolten geht es um eine allgemeine kritische Einführung in die Problematik der Interkulturellen Kompetenz. Er plädiert für ganzheitliche Art interkultureller Kompetenzvermittlung, in der sich nicht um die zu bestimmenden Grundlagen gestritten wird, sondern intradisziplinär agiert wird. Als Grund hierfür nennt Bolten vor allem die Kontextabhängigkeit interkulturellen Handelns und expliziert je nach Akteursfeld und insbesondere je nach dem situativen Beziehungsgeschehen verschiedene Bedingungen interkulturell kompetenten Handelns. Zentral an seinem Ansatz ist ein relationales Denken, das »Mehrwertigkeit«, »Unschärfe« und »Perspektivenreflexivität« in den Vordergrund stellt.
Zum Selbst- und Fremdbild, bzw. der Frage, wie man sich fühlt und agiert, wenn man seinen angestammten Kulturraum verlässt, um in die Fremde zu ziehen, äußert sich der Philosoph Rolf Elberfeld. Wie erkennt bzw. vermeidet man Konflikte, und wie kann man an sich selbst arbeiten (sich selbst kultivieren), um ein respektvolles und friedliches Miteinander zu erreichen. Mit Bezug auf Plato, Cicero, Pufendorf bis hin zum japanischen Philosophen Nishida argumentiert Elberfeld, dass man an der eigenen Selbstkompetenz arbeiten solle, bevor man sich für eine Fremdkompetenz qualifiziere. Die Selbstkultivierung, die ebenso die künstlerisch-wissenschaftliche Sphäre als auch den Gefühlsbereich umfasst, ist eine Notwendigkeit.
Die Erweiterung der Selbstkompetenz dient also der Grundlegung von Fremdheitskompetenz, die der Autor angelehnt an die Arbeiten von Kristeva und Waldenfels, in uns selbst, schlussendlich als einen Teil unserer Selbstkompetenz ausmacht. Diese gilt es also zu entfalten, denn nur so kann ich feststellen dass »die Fremdheit nicht erst beim anderen Menschen beginnt, sondern in mir selbst, [und] so bezieht sich die Fremdheit auch nicht allein auf die Menschen anderer Kulturen, sondern auf jeden anderen Menschen, der mir begegnet.« Zum Schluss verweist Rolf Elberfeld auf die Frage nach unterschiedlichen Fremdheitskompetenzen im Rahmen verschiedener Kulturen.
Von der eingangs angesprochenen Frage von Macht und Machtstrukturen handelt der Aufsatz des Autors Hakan Gürses. Er rekurriert auf »die Unzulänglichkeiten des Kultur-Begriffs«, die zu einer kulturalistischen Lesart von Texten führen, die auch Interkulturelle Konzepte miteinschließt. »Partikularismus versus Universalismus« sind zwei wichtige Schlagwörter, die den Umgang mit Kultur, kulturellen Texten bzw. kulturellen/interkulturellen Zugängen charakterisieren. Gürses zeigt zugleich im Rekurs auf Foucault und Gramsci, dass Hegemonie und Machtstrukturen aber nicht a-kulturell sind. Mit Gramscis Konzept von Führen und Herrschen thematisiert Gürses ideologische, nämlich kulturelle und ethische Aspekte von Führung, die nicht allein auf militärischer oder polizeilicher Stärke beruht. Er verweist weiter auf das Zusammenspiel von Individuum/individuellen Gruppen und der Gesellschaft/des Staats in einer Doppelperspektive von Zwang und Konsenses, Autorität und Hegemonie, Gewalt und Kultur. Gürses erweitert Gramscis Staatsbegriff durch das Konzept der società civile als Schauplatz der kulturellen Hegemonie und der Kulturalität, Kontingenz der Kultur sowie die Universalisierung als Strategie. Er betont die Verschränkung von Kultur und Gesellschaft, samt deren ineinander verstrickte Machtverhältnisse: Kultur ermöglicht also Herrschaft, indem scheinbar sie Ordnung stiftet und real partikular agiert. Doch wie kann man dieser Sackgasse entkommen, da doch das Kulturelle nicht abzustreifen ist, wie ein Mantel oder ein anderes Kleidungsstück? Hakan Gürses schlägt vor, »von Kulturalität zu lernen«. Denn nur indem Partikularität und Kontingenz im Kulturellen aufgezeigt werden, wird die ideologische Dimension der Universalisierung deutlich und Hegemoniekritik wird möglich, ohne eine Gegenhegemonie aufbauen zu müssen.
Nausikaa Schirilla versucht wiederum die Bandbreite der Kontroversen zu Interkultureller Kompetenz abzustecken, eine neue hinzuzufügen und sie gleich wieder einzuschränken. Schirilla bezieht sich auf Interkulturelle Kompetenz im Zusammenhang von Einwanderungsdebatten und stellt die Frage des Zugangs von Zugewanderten als neuen Teilen der Gesellschaft zu öffentlichen Dienstleistungen wie
z. B. Gesundheitsversorgung. Interkulturelle
Kompetenz in Dienstleistungsfeldern und entsprechende organisationsbezogene Konzepte sollen den Zugang zu Versorgung verbessern. Sie übernimmt das Konzept der Zugangsgerechtigkeit aus sozialpolitischen Diskursen und argumentiert, dass, wenn Interkulturelle Kompetenz im Kontext von Zugangsgerechtigkeit gedacht wird, Fragen nach dem Eigenen und Fremden ihre Bedeutung verlieren und Fragen nach Normalität und Vielfalt in den Vordergrund rücken. In demokratischen Gesellschaften muss kulturelle Vielfalt im Kontext demokratischer Rechte gesehen werden und nicht von Toleranz und Verständnis – so das Schlussplädoyer.
Mit diesen Beiträgen werden sehr unterschiedliche Facetten einer Debatte berührt, die es philosophisch noch zu führen gilt. Auch dieser Band krankt wie die gesamte Interkulturelle-Kompetenz-Debatte, dass sie sehr westlich oder von Europa dominiert geführt wird. Es war nicht möglich, Autor(inn)en aus anderen Teile der Erde zu finden, die im Rekurs auf dortige philosophische Traditionen zu Kontroversen über Interkulturelle Kompetenz beitragen hätten können. Diese Einseitigkeit kann auf Machtverhältnisse hinweisen oder darauf, dass das Bestreben, andere zu verstehen und kulturell konnotierte Störungspotentiale durch eine besondere Kompetenz meistern zu wollen, vielleicht doch ein koloniales Erbe darstellt – oder ein sehr partikulares Interesse? Trotz vieler Lücken hoffen wir, den Nexus von Kultur, Macht und Kompetenz in verschiedenen Annäherungen ausgestaltet zu haben.