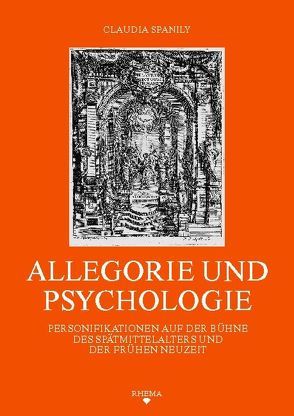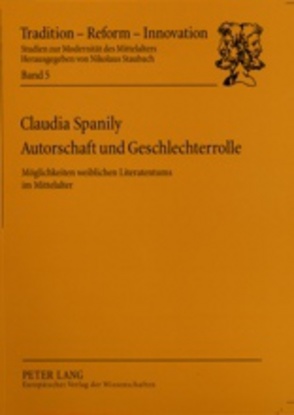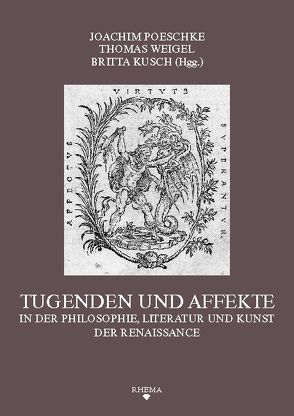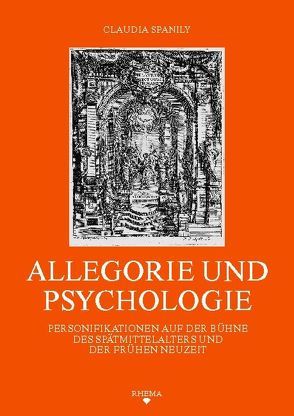
Weitere Informationen unter http://www.rhema-verlag.de/books/sfb496/sfb30.html
Ein bemerkenswertes Phänomen des europäischen Theaters im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit ist die starke Zunahme allegorischer Personifikationen (Affekte, Tugenden, Laster, Wahrheit, Tod u.ä.) auf der Bühne: Vielgestaltig und in großer Zahl beherrschen sie nicht selten das Spielgeschehen. Begegnete man einzelnen dieser Figuren bereits im Drama des Hochmittelalters – etwa der Heuchelei und der Ketzerei im Tegernseer ›Ludus de Antichristo‹, der Ecclesia und der Synagoga in der ›Frankfurter Dirigierrolle‹ oder dem Tod im ›Alsfelder Passionsspiel‹ –, brechen sie ab dem Spätmittelalter fast massenhaft in die europäische Theaterkultur ein, um nach einer etwa dreihundert Jahre währenden, sehr intensiven Wirkungsphase im Laufe des 18. Jahrhunderts nahezu vollständig wieder zu verschwinden. Wie läßt sich dies erklären? Ihren Funktionen nach erinnern sie einerseits an den antiken ›Deus ex machina‹, andererseits an die Protagonisten des Tugend-Laster-Kampfes im spätantiken Epos ›Psychomachia‹. Sie gehen jedoch weit darüber hinaus, wenn sie – wie das vielfach durchaus geschieht – im Spiel psychische Prozesse der menschlichen Bühnenfiguren sinnlich faßbar machen und gesellschaftliche Werte- und Ordnungssysteme repräsentieren.
Auch im deutschen Sprachraum ist die Zahl der überlieferten Theaterstücke, die allegorisches Personal führen, viel größer als man dem Forschungsinteresse und dem Stand der wissenschaftlichen Untersuchungen nach vermuten würde. Ihr Auftreten beschränkt sich keineswegs auf das Schauspiel Lohensteins, Gryphius' und einiger weiterer prominenter Barockautoren, die diesen besonderen Figurentypus in ihren Dramen häufig verwenden und der dort entsprechend gut untersucht ist. Vielgestaltig und in großer Zahl beherrschen Figuren wie die Gottesfurcht, das Gewissen, Tugenden, Laster, Affekte und viele andere mehr im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit das Bühnengeschehen in zahlreichen Spielen – volkssprachlichen wie lateinischen. Das Phänomen allegorischer Spielfiguren ist nicht nur mehrsprachig, es zieht sich auch durch die verschiedensten Spieletypen: die teils volkssprachigen, teils lateinischen religiösen Spiele in der Tradition des mittelalterlichen geistlichen Theaters, die humanistischen Dramen, die der antiken Komödie und Tragödie nacheifern, die konfessionell eingefärbten Bibeldramen und die Theaterstücke der Jesuiten. Einen Höhepunkt erreicht das Auftreten der Personifikationen in der theatralischen Großform der Moralitäten-Spiele. Da Deutschland jedoch nicht zu den klassischen Zentren dieser Untergattung gehört (man ging bislang davon aus, daß nahezu keine nennenswerten deutschen Moralitäten überliefert sind), fehlen entsprechende Untersuchungen und damit offenbar auch das Forschungsinteresse an ihrem Hauptgegenstand, der Personifikationsallegorie.
Was war die spezifische Leistung dieses so vielfältig auftretenden Figurentypus', dieser theatralen Sonderform, die – wenn auch nur für einen begrenzten Zeitraum – zu einem nahezu unentbehrlichen Kunstmittel wurde? Die vorliegende Arbeit versucht, eine Antwort auf diese Frage zu finden, indem sie sich darum bemüht, möglichst viele verschiedene Anwendungstechniken und spezielle Leistungen der allegorischen Figuren im dramatischen Genre herauszuarbeiten.
Weblink: http://www.rhema-verlag.de/books/sfb496/sfb30.html
Inhaltsverzeichnis:
I. Einleitung
1. Zur Forschungssituation
2. Differenzen und Gemeinsamkeiten: drei Jahrhunderte Bühnenpräsenz allegorischer Figuren
2.1. Jesuitentheater: Allegorien in Spielen und Periochen
2.2. Die ›Erfurter Moralität‹ (vor 1448) und ›Male tuta Securitas‹ (Mitte 17. Jh.) – ein Vergleich
II. Deutung und Darstellung von Emotionen und emotionalem Handeln
1. Die moderne Emotionsforschung
2. Affekttheorien der Frühen Neuzeit
III. Affekte auf der Bühne: Die Schauspiellehre des Jesuiten Franciscus Lang
1. Dichtungstheoretische Grundannahmen
2. Darstellung von Affekten durch Sprache, Gestik, Körperhaltung, Mimik (mit Blick auf ihre rhetorischen und ikonographischen Quellen)
3. Darstellung von Affekten durch symbolisch-allegorische Zwischenspiele (exhibitiones scenicae)
4. Darstellung von Affekten durch allegorische Figuren: Der Katalog der ›Imagines Symbolicae‹ und seine Hauptquellen (Jacob Masen / Cesare Ripa)
IV. Begierde und lasterhafte Affekte als Bühnenfiguren
1. Historische Anschauungen zu lasterhaften Affekten und zur Begierde
2. Werbung, Verführung, Streit: die Einflußnahme lasterhafter (Affekt-)Personifikationen auf Spielfiguren und Publikum
2.1. Werbung im Tugend-Lasterkampf und Publikumsverführung: Die ›Voluptatis cum Virtute disceptatio‹ des Chelidonius (1515), die ›Comedia, darin die göttin Pallas die tugend und die göttin Venus die wollust verficht [.]‹ von Hans Sachs (1530) und das Zwischenspiel ›Der Strytt Veneris und Palladis‹ von Jakob Funkelin (1550)
2.2. Verführung von Bühnenfiguren: Der ›Euripus‹ von Levin Brecht und ›Der irdisch Pilgerer‹ von Johannes Heros
2.3. Das virtuose Spiel mit allen Formen der Allegorie: die ›Vita Comoedia‹ des Franz von Hildesheim
2.4 Verkürzung und Separierung: Der ›Spiegel weiblicher Zucht und Ehr‹ von Jacob Ayrer und Shakespeares ›Much Ado About Nothing‹
V. Gewissen, Reue, Umkehr und Buße als Bühnenfiguren
1. Das Gewissen als komplexes Phänomen
1.1. Historische Positionen zum Gewissen
2. Reue, Buße und Umkehr als Folgen
2.1. Historische Positionen zu Reue und Buße
3. Poenitentia, Metanoea und Conscientia auf der Bühne: ausgewählte Dramen
3.1. Belehrungsträger, brutale Furie und mütterlicher Beistand: Reue und Gewissen in der ›Erfurter Moralität‹ (vor 1448) und im ›Prodigus‹ des Ludovicus Crucius (1568)
3.2. Wechselnde Erscheinungen einer Prüfinstanz: Die Conscientia im ›Mercator‹ des Thomas Naogeorg (1539)
3.3. Visualisierung eines psychischen Prozesses: Die Conscientia im ›Judas Iscariotes‹ des Thomas Naogeorg (1552)
3.4. Objektivierende Abstraktion statt Polemik: Gewissen und Reue in der ›Hypocrisis‹ des Wilhelm Gnaphaeus (1544)
VI. Allegorische Personifikationen auf der Bühne des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit: Synoptische Auflistung ihrer Funktionen und Anwendungsgebiete
A. Formen und Funktionen
1. Beförderung des Verständnisses
1.1. Die Nutzung der Personifikationsallegorien zum Verständnis sprachlicher Explikationen
1.2. Die Nutzung der Personifikationsallegorien zum Verständnis der Handlung
2. Beförderung der Deutung und Wertung
2.1. Die Nutzung allegorischer Figuren als Sprachrohre
2.1.1. In der Haupthandlung
2.1.2. In Pro- und Epilogen
2.1.3. In Zwischenspielen (Chören, Reyen)
2.2. Personifikationsallegorien als Garanten für Eindeutigkeit
3. Medium der Verkürzung, Verdichtung, Substitution
3.1. Die Nutzung der allegorischen Personifikation als Ersatz für sprachliche Explikation(en)
3.2. Die Nutzung allegorischer Personifikation als Ersatz für Handlungen
3.3. Allegorien und allegorische Figuren zur Wahrung der Schicklichkeit (Die Darstellung des nicht Aufführbaren, des offen nicht Zeigbaren)
3.4. Allegorische Figuren in ihren bündelnden Funktionen
3.4.1. Bündelung von Eigenschaften
3.4.2. Bündelung von Vorstellungen / Sachverhalten
3.4.3. Stellvertreter
4. Medium der Visualisierung
4.1. Die Verwendung allegorischer Figuren zur Visualisierung von Unsichtbarem
4.2. Die Modellfunktion von Personifikationsallegorien (Visualisierung von Zusammenhängen durch Modelle)
5. Medium der Abstraktion
5.1. Allegorische Personifikationen zur Verhüllung von Angriffen
5.2. Allegorien und allegorische Figuren zur Vermeidung von Polemik
6. Allegorische Personifikationen in ihrer Funktion als künstlich zusammengesetzte Figuren
6.1. Allegorische Figuren als Mischwesen aus Personifikation und Mensch
6.2. Allegorische Figuren als Mischwesen aus Personifikation und Teufel oder Dämon
6.3. Allegorische Personifikationen als wandlungsfähige Kunstfiguren (wandelbare Identitäten)
B. Effekte
1. Innere Effekte
1.1. Allegorische Figuren als Autoritäten
1.2. Allegorische Figuren im Dienste der Emotionalisierung
1.3. Die Personifikationsallegorie in ihrer unmittelbaren Wirksamkeit (sine intermedio)
2. Äußere (technische) Effekte
2.1. Der Einsatz allegorischer Elemente zur Entspannung und als intellektuelles Vergnügen
2.2. Allegorien und allegorische Figuren im Dienste der Schaulust
2.3. Allegorische Figuren zur Aufschwellung des Spielpersonals
VII. Der Rückzug allegorischer Figuren von der Bühne: Grenzbereiche, Sonder- und Übergangsformen
1. Graduelle Ablösung vom rein Allegorischen
2. Aussonderung der allegorischen Figuren
VIII. Schluß: Einige generelle Überlegungen zum Verschwinden der Personifikationsallegorien von den Bühnen
Aktualisiert: 2020-06-25
> findR *
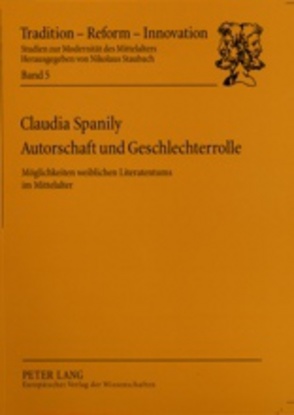
Daß Frauen im Mittelalter literarisch hervortraten, gilt als eine Ausnahmeerscheinung, denn die Literaturproduktion war eine Domäne der Männer. Nicht zuletzt die herrschenden Vorstellungen von der weiblichen Schwäche in intellektueller und auch moralischer Hinsicht wirkten sich als gravierende Benachteiligung aus. Dennoch ist die Zahl der schreibenden Frauen überraschend hoch. Die vorliegende Arbeit hat für eine repräsentative Auswahl von lateinischen wie volkssprachigen Autorinnen (8.-16. Jh.) Aussagen, in denen Frauen ihre Schreibtätigkeit rechtfertigen, gesammelt, historisch und literarisch in den jeweiligen Kontexten analysiert und bewertet. Ein umfangreicher systematischer Teil stellt die entscheidenden Elemente ihrer Rechtfertigungsstrategien zu einer ‘Topik’ weiblicher Schreiblegitimation zusammen. Dabei wird deutlich, daß es den Frauen gelang, ihre sozial determinierten geschlechtsspezifischen Defizite zu kompensieren, indem sie das christliche Paradox von der Stärke des Schwachen und der Weisheit des Ungelehrten bewußt für sich in Anspruch nahmen.
Aktualisiert: 2023-04-12
> findR *
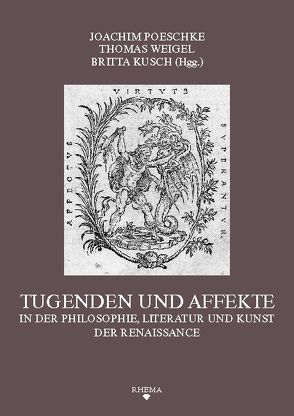
Weitere Informationen unter http://www.rhema-verlag.de/books/sfb496/sfb01.html
Inhalt:
Christof Rapp:
Kunstgemäß erzeugte Affekte in Aristoteles' 'Rhetorik'
Andreas Vieth:
Verzauberung der Affekte –
Symbolische Kommunikation der Tugend
Rainer Stillers:
Sinnliche Wege zur Tugend? –
Sinne, Affekte und moralische Intention in zwei narrativen Werken Giovanni Boccaccios
Eckhard Keßler:
Emanzipation der Affekte? –
Tugenden und Affekte im frühen Italienischen Humanismus
Klaus Wolfgang Niemöller:
Tradition und Innovation des Affekt-Denkens im Musikschrifttum des 16. Jahrhunderts
Michael Zywietz:
Affektdarstellung und Affektkontrolle in den 'Bußpsalmen' des Orlando di Lasso
Claudia Spanily:
Affekte als Handlanger des Teufels und Mittler des Heils in der 'Erfurter Moralität'
Volker Janning:
Zur Darstellung, Erregung und Kontrolle von Affekten im Chor des neulateinischen Dramas
Heinz Meyer:
'Theatrum Affectuum Humanorum' bei Franciscus Lang S.J. –
Ein Hinweis zu den Affekten auf der Jesuitenbühne
Joachim Poeschke:
Motus und modestia in der Kunst, Kunsttheorie und Tugendlehre der Florentiner Frührenaissance
Peter Krüger:
Istoria und virtus bei Alberti und in der Malerei der frühen Renaissance
Hubert Locher:
Erbauliche Kunst? –
Tugend- und Moralvermittlung als Motivation des frühneuzeitlichen 'Gemäldes'
Der Antagonismus von Tugenden und Affekten war eines der großen Themen der Moralphilosophie von der Antike bis in die Neuzeit. In der Renaissance stand die Diskussion darüber ganz im Zeichen der aristotelischen Ethik einerseits und der stoischen Affektenlehre andererseits. Eine stärkere Resonanz als der stoischen Sicht, die auf eine völlige Befreiung von den Affekten abzielte, war jedoch seit dem späten 14. Jahrhundert der peripatetischen Lehre von der Mäßigung der Affekte durch die Vernunft und von der Tugend als dem Mittleren zwischen den Extremen beschieden. Schon Coluccio Salutati ergriff mit Nachdruck für sie Partei und sein Schüler und späterer Nachfolger im Amt des florentinischen Staatskanzlers, Leonardo Bruni, der 1416/18 eine neue Übersetzung der 'Nikomachischen Ethik' anfertigte und in seinem wenige Jahre danach verfaßten 'Isagogicon moralis disciplinae' die Lehrmeinungen der Peripatetiker, Stoiker und Epikureer gegeneinander abwog, war zeitlebens einer der eifrigsten Verfechter der aristotelischen Tugendethik. Deren Wirkung blieb in der Renaissance jedoch nicht auf Florenz beschränkt, sondern reichte weit darüber hinaus, und erstreckte sich auch keineswegs nur auf die Moralphilosophie, sondern auch auf die Dichtung, die Redekunst und die Poetik sowie auf die Musik, die bildende Kunst und die Kunsttheorie. Denn keine der genannten Künste konnte letztlich ohne die Erregung von Affekten auskommen, auch und gerade dann nicht, wenn es galt, erbauend und belehrend auf das Publikum einzuwirken. Die rhetorische Frage 'Sinnliche Wege zur Tugend?', die als Obertitel über einem der Beiträge des Buches steht, kann daher zugleich als der rote Faden verstanden werden, der sich durch diese insgesamt hindurchzieht.
Während es der aristotelischen Rhetorik – anders als der Poetik – vor allem um eine möglichst kunstgerechte Erregung von Affekten im Zuhörer ging, ohne daß sich damit moralpädagogische Absichten verbanden, kennzeichneten solche erzieherischen Intentionen, die mit dem Bewegen des Gemütes nicht nur erfreuen wollten, sondern damit auch das Ziel der Belehrung verknüpften, in besonderem Maße die römische Rhetorik. Deren Aufleben war daher – zusammen mit dem für diese Epoche kennzeichnenden wachsenden Individualitätsbewußtsein und der mit diesem einhergehenden Emanzipation der Affekte – zweifellos eine der Hauptursachen dafür, daß sich in der Renaissance die Evokation von Affekten zu einem virtuos gehandhabten Instrument künstlerisch-rhetorischer Vermittlung ethischer und sozialer Normen entwickelte. Daß unter diesen Normen die Mäßigung der Affekte einen hervorragenden Platz einnahm, machte sie nicht nur zu einem Hauptthema der symbolischen Wertevermittlung, sondern erforderte auch ein neues und vertieftes Reflektieren der ihrer Rolle angemessenen darstellerischen Mittel, eine ihr adäquate Dramaturgie, die der Affektkontrolle im literarischen, musikalischen und bildlichen Kunstwerk nicht weniger als der Affekterregung Rechnung trug. In welcher Weise dies geschah und wie dabei das Kräftespiel von Affektregie und Tugendlehre, von affizierenden und exhortativen Mitteln und Inhalten beschaffen sein konnte, wird in dem vorliegenden Band in Einzelanalysen auseinandergesetzt.
Der Band 'Tugenden und Affekte in der Philosophie, Literatur und Kunst der Renaissance' versammelt die Beiträge eines Kolloquiums, das im Januar 2002 im Rahmen des Sonderforschungsbereiches 496 'Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme vom Mittelalter bis zur Französischen Revolution' im Institut für Kunstgeschichte der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster stattfand. Entsprechend der interdisziplinären Ausrichtung dieses Forschungsverbundes und insbesondere jener drei mit Tugendlehren und Wertesystemen in der frühen Neuzeit befaßten Teilprojekte der Kunstgeschichte ('Virtus in der Kunst und Kunsttheorie der italienischen Renaissance'), der Philosophie ('Grundlagen und Typen der Tugendethik') und der Mittel- und Neulateinischen Philologie ('Theatralische und soziale Kommunikation: Funktionen des städtischen und höfischen Spiels in Spätmittelalter und früher Neuzeit') betreffen die hier vorgelegten Beiträge die engeren Fachgrenzen überschreitende Themen eben jener genannten Disziplinen, darüber hinaus aber auch solche der Romanistik und der Musikwissenschaft.
Aktualisiert: 2020-06-25
Autor:
Volker Janning,
Eckhard Keßler,
Peter Krueger,
Britta Kusch,
Hubert Locher,
Heinz Meyer,
Klaus W Niemöller,
Joachim Poeschke,
Claudia Spanily,
Rainer Stillers,
Andreas Vieth,
Thomas Weigel,
Michael Zywietz
MEHR ANZEIGEN
Bücher von Spanily, Claudia
Sie suchen ein Buch oder Publikation vonSpanily, Claudia ? Bei Buch findr finden Sie alle Bücher Spanily, Claudia.
Entdecken Sie neue Bücher oder Klassiker für Sie selbst oder zum Verschenken. Buch findr hat zahlreiche Bücher
von Spanily, Claudia im Sortiment. Nehmen Sie sich Zeit zum Stöbern und finden Sie das passende Buch oder die
Publiketion für Ihr Lesevergnügen oder Ihr Interessensgebiet. Stöbern Sie durch unser Angebot und finden Sie aus
unserer großen Auswahl das Buch, das Ihnen zusagt. Bei Buch findr finden Sie Romane, Ratgeber, wissenschaftliche und
populärwissenschaftliche Bücher uvm. Bestellen Sie Ihr Buch zu Ihrem Thema einfach online und lassen Sie es sich
bequem nach Hause schicken. Wir wünschen Ihnen schöne und entspannte Lesemomente mit Ihrem Buch
von Spanily, Claudia .
Spanily, Claudia - Große Auswahl an Publikationen bei Buch findr
Bei uns finden Sie Bücher aller beliebter Autoren, Neuerscheinungen, Bestseller genauso wie alte Schätze. Bücher
von Spanily, Claudia die Ihre Fantasie anregen und Bücher, die Sie weiterbilden und Ihnen wissenschaftliche Fakten
vermitteln. Ganz nach Ihrem Geschmack ist das passende Buch für Sie dabei. Finden Sie eine große Auswahl Bücher
verschiedenster Genres, Verlage, Schlagworte Genre bei Buchfindr:
Unser Repertoire umfasst Bücher von
- Spaniol, Adolf
- Spaniol, Marc
- Spaniol, Margret
- Spaniol, O
- Spaniol, Otto
- Spaniol, W
- Spanitz, Gabriele
- Spanjaard, Han
- Spanjardt, Eva
- Spanjer, Jörg
Sie haben viele Möglichkeiten bei Buch findr die passenden Bücher für Ihr Lesevergnügen zu entdecken. Nutzen Sie
unsere Suchfunktionen, um zu stöbern und für Sie interessante Bücher in den unterschiedlichen Genres und Kategorien
zu finden. Neben Büchern von Spanily, Claudia und Büchern aus verschiedenen Kategorien finden Sie schnell und
einfach auch eine Auflistung thematisch passender Publikationen. Probieren Sie es aus, legen Sie jetzt los! Ihrem
Lesevergnügen steht nichts im Wege. Nutzen Sie die Vorteile Ihre Bücher online zu kaufen und bekommen Sie die
bestellten Bücher schnell und bequem zugestellt. Nehmen Sie sich die Zeit, online die Bücher Ihrer Wahl anzulesen,
Buchempfehlungen und Rezensionen zu studieren, Informationen zu Autoren zu lesen. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
das Team von Buchfindr.