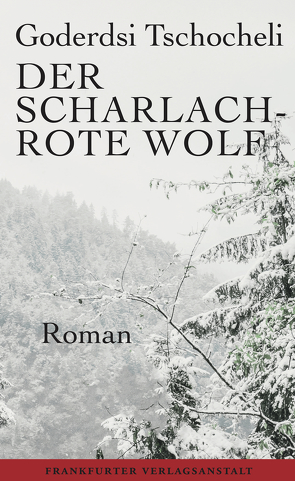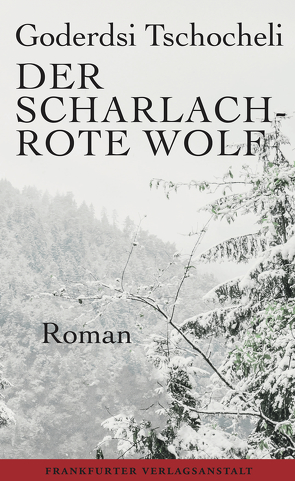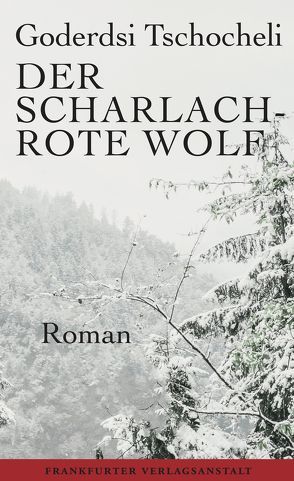Bela Tsipuria
Der magische Realismus bei Goderdsi Tschocheli
Den Namen des Schriftstellers und des Regisseurs Goderdsi Tschocheli kennt heutzutage in Georgen jeder. Sein Dasein wird heute von dem georgischen Leser genauso selbstverständlich wahrgenommen, wie das Dasein eines Berges, eines Baumes oder eines Flusses.
Zwar gibt es im georgischen Bewusstein des 20. Jahrhunderts durchaus Schriftsteller und Regisseure, die bedeutender erscheinen oder die wesentlichen kulturellen und nationalen Bestrebungen Georgiens repräsentieren, aber es gibt eben auch Goderdsi Tschocheli.
In den 1980-1981, als seine ersten kleinen Büchlein veröffentlicht wurden, war Goderdsi Tschocheli auf eine ganz natürliche Weise bekannt geworden. Für den jungen Mann, der einige Jahre zuvor sein Heimatdorf Gudamaqari in Ostgeorgien verlassen hatte, um an der elitären Staatlichen Schota-Rustaweli-Theaterhochschule in Tbilisi zu studieren, öffneten sich alle Türen ungewöhnlich leicht (vor allem an der Fakultät der Filmwissenschaft und später der Regie, wo immer nur einige wenige zum Studium zugelassen wurden). Genauso unbeschwerlich verliefen später seine ersten Filmaufnahmen und Buchveröffentlichungen.
Irgendwie schien der elitäre Kreis der Tbiliser Künstler Goderdsi Tschocheli den einfachen Wunsch, Bücher zu schreiben und Filme zu drehen, nicht abschlagen zu können und gewährte ihm hiermit seinen eigenen Platz, seine eigene Nische im Kulturbetrieb.
Zwar boten die Sowjet-Regulierungen einem Heranwachsenden, der aus einer Provinz stammte, gewisse „limitierte“ Studienplätze zu besonderen Konditionen an, das bedeutete aber lange nicht, dass derjenige sich auch tatsächlich seinen Weg durch die übertrieben exklusive Künstlerszene inmitten Tbilisis zu ebnen vermochte. Eine besondere Aufmerksamkeit war auch damals von dem verwöhnten und überaus anspruchsvollen georgischen Publikum zu erwarten.
Die Nische, die Goderdsi Tschocheli füllte, wartete schon seit Wascha-Pschawela, dem großen georgischen Dichter (1861-1915), auf eine neue Figur (auch in den Biographien Goderdsi Tschochelis wird oft erwähnt, dass sein Erscheinen in Tbilisi gebührend gefeiert wurde: Der junge Wascha-Pschawela sei von den Bergen ins Tal hinabgestiegen).
Im georgischen Literaturkanon waren die Werke Wascha-Pschawelas schon fest verankert. Deshalb gab es auch keine Missverständnisse, als die Fragen aus den Bergen neu erklangen: die Suche nach Gott, die Existenz einer Seele, Fragen nach Leben und Tod, nach der Ewigkeit, nach der Natur und dem Menschen. Obwohl es in der spätsowjetischen georgischen Literatur gar nicht so einfach war, diese Fragen zu stellen, geschah es dennoch. Das georgische Literaturzentrum, das ein Hybrid aus georgisch nationalen und sowjetischen Diskursen bestand, hielt ausgerechnet von Goderdsi Tschocheli diese Fragestellungen für selbstverständlich.
Der Status eines Heranwachsenden, der aus dem Kaukasusgebirge kam, öffnete seinen Texten die Türen in die Kulturrealität, die noch immer von der Sowjetregierung geleitet wurde.
Die existenziellen Fragen der Moderne, die seit den 1930er-Jahren durch das Sowjetsystem tabuisiert worden waren, klangen aus dem Mund dieses jungen Mannes fast schon ungefährlich. Deshalb wurde ihm auch einiges - sowohl hinsichtlich seiner Protagonisten als auch seiner Leser - verziehen: das Schreiben über die Bergrituale, der Dreh über die Unterhaltung mit den Verstorbenen, die Frage nach der Existenz einer Seele. Er durfte die Grenzen des materiellen Bewusstseins überschreiten und über die religiös-mythische Wahrnehmung im Alltag Chewsuretiens berichten.
Für die sowjetische materialistische Ideologie waren solche Themen inakzeptabel. Aber wenn ein ehrlicher, junger Provinzler darüber schrieb oder Filme drehte, der sich neben alldem noch des Humors bediente, wenn er Sitten und Gebräuche eines Bergdorfes zeigte und seinen eigenen Verwandten und Dorfmitbewohnern die Rollen in seinen Filmen übertrug, füllten sich selbst die ranghohen georgischen Sowjetbeamten (im eigentlichen Sinne: Zensoren) verpflichtet, das Vorhaben des jungen Mannes hinreichend zu unterstützen.
Zu der Zeit, als Goderdsi Tschocheli anfing seine Erzählungen zu veröffentlichen, hatte die georgische Kultur des 20. Jahrhunderts einen sehr schwiergien Weg hinter sich. Gleich die ersten Jahre dieses Jahrhunderts beendeten die ausdrucksstarke Epoche des Realismus des 19. Jahrhunderts.
Anfangs war es Wascha-Pschawela, der die Grenze zwischen materieller und seelischer Realität aufzeichnete, einerseits durch christliche Weltanschauung, andererseits durch Naturphilosophie. Er war auch derjenige, der die Mythologie der Bergvölker, die nationale Dichtertradition und die Dialekte Ostgeorgiens in den Diskurs der georgischen Literatur brachte.
Wascha-Pschawela wurde ganz besonders von der nachfolgenden Generation, der georgischen Moderne, sehr geschätzt, auch wenn sie, von der Erneuerung der georgischen Literatur beeinflusst, durch die europäischen Moderne angefangen hatte.
Die Moderne der 1910-1920er-Jahre war in der Tat so eine explosive kulturelle Tendenz, dass der stalinistische Totalitarismus nicht nur der russischen Moderne, der Kultur der Silbernen Ära, den Krieg erklärte, sondern auch in Georgien jede Erfahrung der georgischen Moderne aus dem Kulturgedächtnis zu tilgen versuchte.
In der post-stalinistischen Epoche, nachdem das „Tauwetter“ gewisse kulturelle Freiheiten mit sich brachte, stellte sich die Zugehörigkeit zu diesen Erfahrengen wieder ein. In Wirklichkeit war es aber kein klar definierter Bund: in der georgischen Literatur und ganz besonders in der georgischen Dichtung herrschte der Realismus. In den 1970er-Jahren verlieh der georgische Roman der georgischen Literatur ein neues Gesicht und passte ihn an die Kriterien des westlichen Romans an.
Mehrere georgische Schriftsteller und Dichter versuchten in der georgischen Literatur der 1960-1980er-Jahre auf eigene Faust, kulturelle Grenzen, die ihnen vom Sowjetsystem aufgezwungen wurden, zu überschreiten und an den kulturellen Prozessen hinter dem Eisernen Vorhang teilzuhaben.
Otar Tschiladse und Guram Dotschanaschwili brachten die Anforderungen des magischen Realismus in die Literatur, inspiriert von den Werken der lateinamerikanischen Schriftsteller.
Jeder angehende Schriftsteller lernt diese Prozesse kennen. Das Empfinden des magischen Realismus in Goderdsi Tschochelis Erzählwerken stammte in erster Linie aus der Welt der Bergvölker Ostgeorgiens.
Wahrscheinlich war die Welt, die mit finsteren, eisbedeckten Bergen umzingelt war, genauso liminal, auch hier war die Grenze der Empfindungen zwischen dem Materiellen und dem Übernatürlichen so zerbrechlich, auch hier war die Begegnung mit der transzendentalen Welt so lebendig, wie im impulsiven und farbenfrohen Südamerika.
Nach der Ansicht des georgischen Dichters Dato Barbakadse, der die Herausgabe dieses Bandes initiierte, zählt Goderdsi Tschochelis Prosa zum magischen Realismus.
Bei Goderdsi Tschocheli werden die Grundbedürfnisse und Ur-Konflikte des einfachen Lebens gezeigt: Mutter- bzw. Großmutterliebe zum Kind bzw. Enkelkind, die Macht der ersten Liebe, der Generationenvertrag, sowie die Sorge der Verstorbenen um die Hinterbliebenen, die Ankunft und das Akzeptieren des Todes, der Einfluss der menschlichen Vorstellungen und Sehnsüchte auf die Welt und auf der anderen Seite die Fähigkeit des Menschen zur Erkenntnis zu gelangen, die Verbindung zwischen Traum und Wirklichkeit, und schlussendlich die Hoffnung auf Gott als geheimnisvollen Beschützer, der dazu beiträgt, in diesem einfachen Dasein die Ewigkeit zu empfinden.
Gleichzeitig weist uns der Schriftsteller auf die Möglichkeiten hin, die reale Magie zu erkennen, und das in der Epoche, in jener sowjetischen Wirklichkeit, wo nur eine einzige Sichtweise auf die Welt erlaubt war, und zwar die materialistische.
Die Aufdeckung dieser Wahrheiten spielt in den Erzählungen Goderdsi Tschochelis keine vorrangige Rolle. So scheint es zumindest auf den ersten Blick. Doch seine Texte leben von dem Drama eines möglichen Weges für ein Individuum. Dabei geht es um die Auseinandersetzung des Einzelnen mit den überlieferten Bergtraditionen (wie zum Beispiel bei Wascha-Pschawela).
Bei Goderdsi Tschocheli aber stellt sich das Individuum gegen das Sowjetsystem und übernimmt die Aufgabe, die traditionelle Welt neu zu organisieren und zerstört hiermit die innere Logik sowohl des Menschen als Sozialwesen als auch des Menschen als Einzigartigem.
Der Schriftsteller erzählt von den Wünschen des Individuums, sich vor der eigenen Nivellierung schützen zu wollen, und was noch bedeutender ist, er tut dies, indem er die Standards der Realität auflöst.
Interessant ist, dass so ein Protest des Individuums/Schriftstellers eben durch diese magische Kraft (Wunder, unerklärliche Vorkommnisse, unergründliche menschliche Stellungnahmen) die Grenzen der Realität durchbrechen kann.
In seiner frühen Erzählung „Ein Brief an die Tannen“ wächst dem Protagonisten ein Tannenbaum aus der Schulter. Dieses Phänomen lässt sich mit materiellen Gesetzmäßigkeiten leicht erklären (nach Ansicht des Dorfarztes „wurde der Mann im Krieg verwundet und im Wald fiel etwas Tannenstaub in seine Wunde“). Die Selbstaufopferung des Protagonisten, noch dazu des Stammesältesten, bei dem Versuch, das neu entstandene Leben zu schützen, überschreitet die Möglichkeiten eines sozialen Wesens und die Grenzen der materiellen
Welt.
Das möchte der junge Dorflehrer zum Ausdruck bringen, als er sagt: „Nicht das wäre zu erforschen und zu erklären, dass einem Mann eine Tanne auf der Schulter wächst, sondern die väterliche Fürsorge des Mannes zu dieser Tanne!“
Das Sozium, und ganz besonders seine emanzipierten, sowjetisch erzogenen Mitglieder: der Arzt und der Geografie-Lehrer, verlangen von dem Individuum das Einhalten der materiellen Gesetze. „Woher ist denn diese elitär-fürsorgliche Beziehung überhaupt entstanden?“, möchte der Lehrer wissen.
Der Stammesälteste jedoch nimmt das Leben, wenn auch das einer jungen Tanne, als Geschenk Gottes an: voller Dankbarkeit und Fürsorge. Obwohl Gott ihn nicht mit einem Kind gesegnet hat und ein Mitbewohner deshalb die Gerechtigkeit Gottes anzweifelt, stimmt ihm der Stammesälteste nicht zu: „Ist denn diese Tanne nicht lebendig?!“
Selbstverständlich stellt sich hier die Frage nach Glauben und Nicht-Glauben generell: Wie äußert sich das Wunder in der hiesigen Welt? Durch das Wachsen der Tanne oder durch das Beschützen jedes beliebigen Lebens? Wie sollten wir das Leben eines anderen empfinden? Und für welchen Preis sollten wir auf unsers verzichten? Hat tatsächlich Gott diese Welt erschaffen? Hat tatsächlich er die Gesetze für uns geschaffen?
Schon in dieser Erzählung wird das Misstrauen gegenüber dem Sowjetsystem und seinen Gesetzen sichtbar: Dieses ist ein gleichgültiges und zynisches System. Ein Individuum findet hier keinen Platz. So zynisch verhält sich auch der Vorsitzende der Kolchose dem Stammesältesten gegenüber (in einem abgelegenen Bergdorf verkörpert diese Person den wichtigsten Vertreter der Sowjetregierung).
Das System gewährt dem Individuum nicht das Recht, die eigene Position zu verteidigen. Der Text hat ein offenes Ende. In dieser früher Erzählung wird das Problem nur in Halbtönen wiedergegeben: Vielleicht trug gerade das dazu bei, dass sie für den Leser so attraktiv wurde. Vielleicht war der Leser an ein offenes Ende oder an die Missachtung der realitätsbezogenen Erzählweise nicht gewöhnt. Von den nationalen, anti-russisch und anti-sowjetisch gestimmten georgischen Schriftstellern wurde die Botschaft richtig gedeutet und die Wahrheit von der Allegorie getrennt.
Der georgische Leser nahm diese Erzählung mit so einer Begeisterung auf, und ähnliche Themen, Sichtweisen und Darstellungsmethoden erhielten Einzug in die georgischen Literatur.
Jeder kennt die Geschichte eines Mannes, der vor der Wahl steht, das Unfassbare zu beschützen und sich gegen die sozialen Vorschriften, die Standards und das System aufzulehnen und seine Einzigartigkeit verteidigen zu müssen.
Darum geht es in Goderdsi Tschochelis Erzählung „Der Briefverkehr mit einem Fisch“, und zwar auf eine sehr dramatische Weise: Der Protagonist zeigt seine Abneigung gegenüber der sowjetischen Lebensweise (gegenüber dem Vorsitzenden der Kolchose, der dessen Rechte verletzt) und dem Sozialisierten, der nach diesen Regeln lebt, sehr offensichtlich. Auch hier verteidigt das Individuum sein eigenes Ich und lehnt die Anpassung ab. Es erkennt, dass das menschliche Bewusstsein mit diesem System nicht in Einklang gebracht werden kann. Es verzichtet auf Menschen und auf die Menschheit und beschließt, ein Fisch zu werden.
Ein Fisch steht der Welt und den Naturgesetzen näher als ein gieriger und respektloser Mensch.
Selbstverständlich kann auch die Fisch-Metapher unterschiedlich gedeutet werden. In der Sowjetepoche galt der Fisch als Symbol eines Mannes, der der Ideologie unterwürfig war und der sich mit Ungerechtigkeiten abgefunden hatte. Sein Mund war voll mit Wasser, ähnlich wie bei einem Fisch.
Auf der anderen Seite war in Georgien die christliche Tradition noch immer präsent. Diese stellte den Fisch als Symbol für Christus dar. Der Schriftsteller lädt jedoch seinen Text nicht mit der Suche nach symbolischen Bedeutungen auf. Er erzählt nur die Geschichte eines einfachen Mannes, der die Grenzen seiner eigenen Existenz überschritten hat, mit Ehrlichkeit und Standhaftigkeit, sowie mit dem Akzeptieren des Sonderbaren.
In diesem Fall gestaltet der Schriftsteller die Erzählung auf eine wirklich dramatische Weise. Hier entspricht alles dem tragischen Konflikt im klassischen Sinne: Ein Held, der seiner Zeit vorauseilt, um der Wahrhaftigkeit näher zu kommen; einer, der in niederen materiellen Leidenschaft gefangen ist; die Selbstaufopferung des Helden und schließlich auch sein Untergang; das Resultat: die Katharsis des Einzelnen.
Die Erzählungen Goderdsi Tschochelis lassen dem Leser den magischen Realismus besonders dann empfinden, wo der Schriftsteller von der Nichtexistenz oder der Überwindung der Grenzen zwischen Realität und Traum, zwischen Leben und Tod, berichtet.
Eine besondere Kraft haben dabei jene Wesen, die in der hiesigen Welt erscheinen, zur Selbsterkenntnis verhelfen und den Weg ins Jenseits weisen.
„Die Nacht der Engel“ erzählt ausschließlich von solchen übernatürlichen Empfindungen, von der Einheit von Traum und der Realität, von dem Zusammenhang zwischen Mythos und Wahrheit und letztendlich von dem Bund zwischen Gott und Mensch. Der Garant für diesen Bund ist selbstverständlich die Mutter.
Diese Erzählung trägt autobiografische Züge. Der Schriftsteller gibt klar zu erkennen, dass er von sich und seiner eigenen Mutter spricht. Die humoristischen Mittel, die er anwendet (diktiert von der echten Gestalt der Mutter) soll die Glaubwürdigkeit des Textes unterstreichen. Er erzählt von einer Mutter, die sich manchmal in lustigen Lagen wiederfindet, die auf das Leben ihres Kindes Acht gibt und in der Not den Vater im Himmel um Hilfe bittet.
Die Mutter bringt dem Sohn bei, seine Wünsche Gott gebührend vorzutragen. Sie ist auch diejenige, die diese Bitten mit einem Tabu belegt, wenn der Sohn versucht, für seine irdischen Bedürfnisse die Macht der Natur zu missbrauchen.
Dieses Tabu bleibt für den Schriftsteller/Erzähler Zeit seines Lebens verbindlich. Auch wenn er der Überzeugung ist, dass es durchaus lohnenswert war, im Frühling den Schnee heraufzubeschwören, um den Film zu Ende drehen zu können.
Seiner Meinung nach diente das nicht irgendeinem irdischen, materiellen Zweck, sondern ausschließlich der Kunst.
Für seine Zeitgenossen, die die Epoche des mythischen und realen Bewusstseins verlassen hatten, war nämlich die Kunst das einzige Mittel, das Materielle und das Nichtmaterielle auf legitime Weise miteinander zu verbinden.