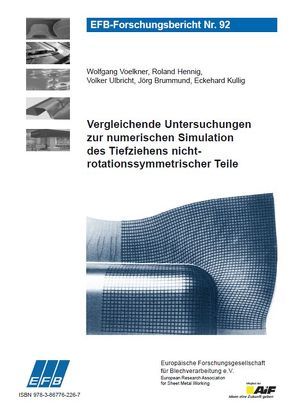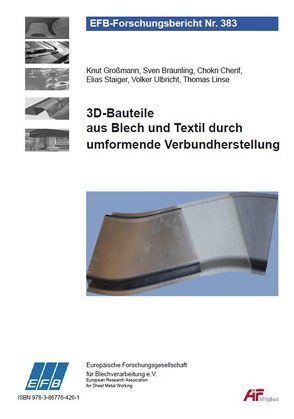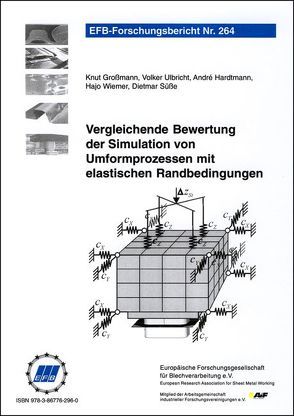Für die Realisierung des Setzprozesses innerhalb einer numerischen
Simulation bei FKV-Hybridverbunden wird eine Methodik entwickelt, die
den FKV-Werkstoff als Schichtverbund betrachtet.
Zwei zentrale Modellbestandteile bilden hierbei das komplexe Deformations-
und Versagensverhalten. Zur Beschreibung des richtungsabhängigen
Schichtverhaltens wird erstmalig ein Materialmodell implementiert,
das neben den Schädigungsprozessen auch viskoelastische
Effekte, d. h. die Ratenabhängigkeit des Materialverhaltens und Relaxations-
sowie Kriecheffekte abbilden kann.
Den Anwendern steht damit ein Setzprozessmodell zur Verfügung, das
alle charakteristischen, durch den Setzvorgang induzierten Schädigungsphänomene
in der Simulation erfasst
Aktualisiert: 2019-10-09
> findR *

Besonders kleine und mittlere Unternehmen als Zulieferbetriebe müssen entsprechend der Markttendenz zu kleineren Stückzahlen schnell auf Angebotsanfragen reagieren können und bei Auftragserteilung ebenso schnell und kostengünstig produzieren.
Entsprechender zeitlicher und finanzieller Spielraum besteht nur in der Produktionsvorbereitungsphase. Um entsprechende Marktvorteile zu erzielen, sind eine genauere Bestimmung der teilspezifischen Werkzeuggeometrie einschließlich der Blechdickenänderung und der notwendigen technologischen Kenngrößen wie Umformkraft, Umformweg zur Produktion eines qualitätsgerechten Werkstückes Voraussetzung. Bei der Ermittlung der Blechdickenabnahme versagen im allg. die elementaren Theorien, obwohl diese Kenngröße entscheidend für den späteren Einsatz des Bauteiles ist. Die geforderten Blechdickenabnahmen können durch das Simulationssystem in einer Phase der Produktion überprüft werden, in der noch kostengünstige Änderungen möglich sind.
Durch die angestrebten Ergebnisse wird es möglich, besonders für kleine und mittlere Unternehmen in einer frühen Phase der Produktion ohne eine Vielzahl kosten- und zeitintensiver Versuche eine für das jeweilige Werkstück optimierte Gestaltung der Werkzeuggeometrie und der Stufenfolge sowie der technologischen Einstellgrößen zu erhalten. Dabei wird die genauere Geometrie und die Maße der Werkstücke nicht durch hohe Kräfte, die entsprechende Maschinen erfordern, sondern durch Neugestaltung der Werkzeuge erzielt.
Diese aus der Simulation gewonnenen Vorgaben bilden die Grundlage für den Werkzeugbau und die Einrichtung der Maschinen.
Dies führt zu einer Verkürzung der Produktionsanlaufphase und zu einer Erhöhung des Nutzungsgrades der investitionsintensiven Fertigungseinrichtungen und sichert vor allem klein- und mittelständischen Unternehmen eine größere Effizienz und Marktfähigkeit Weiterhin können durch die berechneten Spannungen und Dehnungen Aussagen zur beanspruchungsgerechten Auslegung des Teiles und zu Produkteigenschaften gewonnen werden. Mit dem Simulationsprogramm kann im Zusammenwirken zwischen Teilekonstrukteur, Werkzeugkonstrukteur und Fertiger ein beanspruchungsgerecht konstruiertes, rotationssymmetrisches Werkstück mit darauf abgestimmter Werkzeuggeometrie und Stufenfolge mit dazugehörigen technologischen Daten in kürzerer Zeit hergestellt werden. Potentielle Anwender sind blechverarbeitende Betriebe, die rotationssymmetrische Teile im Produktionssortiment führen (z.B. Radnaben, Kupplungsteile, Bremstrommeln, beliebige Tiefziehteile und Werkzeugbaubetriebe).
Im Rahmen dieses Forschungsprojektes wurden Untersuchungen zur Rechnersimulation des Nachformens von rotationssymmetrischen Blechteilen angestellt. Dabei wurde auf experimentellem und numerischem Wege die Werkstückqualität durch Variation der Werkzeuggestaltung optimiert.
ln der ersten Phase der Bearbeitung des Forschungsthemas wurden Untersuchungen theoretischer und experimenteller Art in Bezug auf die Ermittlung von Eingangsdaten für Berechnung und Simulation angestellt. Dies betrifft die unterschiedlichen einsetzbaren Verfahren sowie die mathematische Ermittlung der Fließkurvenparameter.
Weiterhin wurden Untersuchungen zur Ermittlung des E -Moduls durchgeführt.
Diese Untersuchungen erfolgten mit alternativen Methoden, wobei neue Erkenntnisse gewonnen werden konnten. Parallel dazu erfolgte die Erarbeitung einer Werkstoffdatei.
Zur Approximation der Fließkurven wurde ein eigenes Programm erarbeitet und zusammen mit der Werkstoffdatenbank weiterentwickelt.
Parallel dazu wurde nach Erarbeitung einer Konzeption ein Preprozessor für das Simulationssystem erstellt und in mehreren Varianten umgesetzt. Nach Testung der unterschiedlichen Varianten erfolgte die endgültige Fertigstellung des Preprozessors.
Dieser Preprozessor befindet sich im industriellen Einsatz.
Um die Treffsicherheit des Simulationssystems darzustellen und zu testen, wurden in einer weiteren Phase Simulationsrechnungen an Beispielteilen durchgeführt. Die Überprüfung des Programmsystems erfolgte durch vergleichende Experimente an rotationssymmetrischen Werkstücken. Bei den Rechnungen sind vorrangig Untersuchungen zur Variation der Werkzeuggeometrie und deren Auswirkung auf das Umformergebnis durchgeführt worden.
Dabei wurden einstufige und mehrstufige Nachformvorgänge simuliert und experimentell überprüft. Es ergab sich eine gute Übereinstimmung zwischen den simulierten und den experimentellen Ergebnissen.
Aktualisiert: 2022-02-08
> findR *

Das Stanzpaketieren von Elektroblechen ist ein Verfahren zur Herstellung von Rotor -und Statorpaketen für Elektromotoren. Zu diesem Zweck werden die in einem Folgewerkzeug ausgeschnittenen Einzelbleche aufeinander gestapelt und durch das in dem Werkzeug integrierte Verfahren des Durchsetzfügens verbunden. Die hohen Stückzahlen, die dabei gefordert werden, setzen eine hohe Werkzeugstandmenge voraus. Der Einsatz von oberflächenbeschichteten Werkzeugen stellt eine Möglichkeit zur Erhöhung der Standmenge dar.
Eine Klassifizierung einzelner Beschichtungssysteme hinsichtlich der Verschleißwerte in Abhängigkeit von der eingestellten Hubzahl (H/min) und des eingesetzten Schmierstoffs kann, insbesondere den Herstellern von Elektromotoren, Richtlinien zur Einstellung optimaler Verfahrensparameter beim Scherschneiden liefern, um den Werkzeugverschleiß und die daraus resultierende Gratbildung gering zu halten.
Die Ergebnisse der Versuchsreihen zeigen, daß CVD-beschichtete Werkzeuge deutlich geringere Werte der Mantelflächen-Verschleißlänge bei vergleichbaren Verfahrensparametern aufweisen, als PVD-beschichtete Werkzeuge. Diese Verschleiß-Kenngröße ist entscheidend für den Werkzeugnachschliff. Die Gratbildung wird wesentlich von dem Verschleißzustand der Werkzeuge beeinflußt. Entscheidende Kriterien sind hierbei die Kantenrundung und der Mantelflächenverschleiß der Werkzeuge. Sowohl die Werte für den Mantelflächenverschleiß, als auch die für die Grathöhe, liegen bei PVD-beschichteten Werkzeugen höher, als bei CVD- beschichteten Werkzeugen.
Darüber hinaus haben die Versuche gezeigt, daß mit zunehmendem Esteranteil des Stanzöls insgesamt geringere Verschleißwerte erreichbar sind. Hingegen hat eine Hubzahlsteigerung nicht zwingend höhere Werte der Verschleiß-Kenngrößen bzw. der Grathöhe zur Folge. Die vorliegenden Untersuchungen verdeutlichen, daß die Verfahrensparameter Hubzahl und Stanzöl einen erheblichen Einfluß auf den Werkzeugverschleiß, die Gratbildung und die Formgenauigkeit des Schnitteils, des einzelnen Rotor- und Statorblechs, nehmen. Das Ziel des Forschungsvorhabens wurde erreicht.
Aktualisiert: 2022-02-08
> findR *

Innerhalb des Forschungsvorhabens sollten durch Untersuchungen Grundlagen für die sichere Werkstück- und Prozessauslegung des Gleitziehbiegens geschaffen werden. Mittels experimenteller Grundlagenuntersuchungen konnten wesentliche Erkenntnisse zum Verfahrensablauf und zu den Verfahrensgrenzen gesammelt werden.
Eine Versuchsanlage mit einer starren Gleitziehbiegematrize wurde zur Durchführung der Grundlagenuntersuchungen verwendet. Mit diesem Versuchsaufbau war es möglich, Profile mit einer Blechdicke von s0 = 0,6 mm bis 1,0 mm und einer Länge von 500 mm bis 750 mm herzustellen. Im Rahmen der Untersuchungen wurden U-Profile und Hutprofile aus den Werkstoffen DC05, X5CrNi1810 sowie AlMg4,5Mn0,4 hergestellt. Erste Untersuchungen befassten sich mit den allgemeinen Möglichkeiten des Gleitziehbiegens ohne die Verstellung des Ziehspaltes an der Matrize bei konstanten Randbedingungen (Ziehgeschwindigkeit, Ziehspalt). Hierbei wurden die ersten Grenzen des Verfahrens ermittelt.
Um eine Variation des Ziehspaltes durchführen zu können, modifizierte man die bestehende Versuchsanlage. Nach der Modifizierung konnten Ziehspaltadaptionen für U – Profile der Blechdicken s0 = 0,8 und s0 = 1,0 mm durchgeführt werden. Dabei stellten sich für die unterschiedlichen Blechdicken optimale Ziehspalte heraus. Durchgeführte Schmierstoffvariationen sowie eine Untersuchung des Einflusses der Ziehgeschwindigkeit auf den Umformprozess ließen weitere grundlegende Erkenntnisse zu. In numerischen Simulationen gewonnene Ergebnisse wurden durch experimentelle Untersuchungen bestätigt. Die numerischen Berechnungen wurden um Varianten mit traktrixförmigen Ziehrundungen an der starren Matrize ergänzt und abgeschlossen.
Umfangreiche Versuche zur Kennwertermittlung wurden durchgeführt. Die Fließkurven der Probewerkstoffe und die Reibwerte im Zusammenspiel mit den Werkzeugwerkstoffen wurden ermittelt. Die Grenzformänderungskurven der Probenwerkstoffe konnten mit Hilfe der Methode der Visioplastizität bestimmt werden. Verschiedene Profile wurden berastert und es erfolgte eine visioplastische Analyse der Probeteile.
Im weiteren Projektverlauf wurden unterschiedliche Werkzeugkonzepte zur Herstellung belastungsangepasster Profile mit variablem Querschnitt entwickelt. Daran schlossen sich Simulationsrechnungen der verschiedenen Werkzeugkonzepte an. Die Geometrie eines ausgewählten Werkzeugkonzeptes wurde für die Simulation weiter aufbereitet. Der benötigte Kraftbedarf wurde ermittelt und umfassende Auslegungsrechnungen zur Optimierung erfolgten. Bei den Simulationsrechnungen wurden in enger Zusammenarbeit mit den Projektpartnern neue numerische Modelle bezüglich des Kontaktes zwischen Werkstück und Werkzeug sowie des funktionalen Ablaufes der Simulation entwickelt und getestet.
Basierend auf den Ergebnissen der Grundlagenuntersuchungen und den numerischen Simulationen realisierte man das Werkzeugkonzept in der Praxis. Mit der Gleitziehbiegeanlage konnten im Querschnitt variierte Profile hergestellt werden.
Aktualisiert: 2022-02-08
> findR *

Die Entwicklung eines innovativen Werkzeugkonzepts zum Walzprofilieren von Bauteilen mit über der Längsachse veränderlichen Querschnitten, das mit Hilfe von FE-Berechnungen zunächst verifiziert wurde, bildete die Grundlage für die Entwicklung, Auslegung und Konstruktion eines neuartigen, angetriebenen und automatisierten Walzprofiliergerüsts.
Im Rahmen einer numerischen Sensitivitätsanalyse wurden der Einfluss maßgeblicher Prozessparameter, wie das Aufweitverhältnis, die Schenkelhöhe, die Blechdicke und die Stufenfolge für die Durchführung experimenteller Untersuchungen ermittelt.
Die Entwicklung eines intelligenten Bewegungsmechanismus bildete die Voraussetzung für die anlagentechnische Umsetzung des innovativen Werkzeugkonzepts, das in einer neuartigen Konstruktion realisiert worden ist.
Das von der Funktionsstruktur sehr wirkungsvolle Steuerungskonzept bietet zusammen mit der eigens für dieses Forschungsprojekt entwickelten Programm- bzw. Bedienoberfläche einerseits einen sehr hohen Bedienkomfort andererseits eine sehr große Flexibilität, da die Werkzeugsteuerung grafisch auf eine zu fertigende Werkstückgeometrie einstellbar ist.
Mit der Realisierung einer Versuchsanlage und der experimentellen Untersuchung des neuartigen Verfahrens, konnten Bauteile mit über der Langsachse veränderlichen Querschnitten hergestellt werden, wodurch der Nachweis für die Machbarkeit des Verfahrens erbracht worden ist.
Die Entwicklung zu immer kürzeren Produktlebenszeiten und zu kleineren Losgrößen bei gleichzeitig steigenden Anforderungen an Design und Bauteilkomplexität, stellt die umformtechnischen Fertigungsverfahren vor neue Aufgaben, die unter zunehmendem Kostendruck gelöst werden müssen. Mit der Entwicklung eines Verfahrens zum Walzprofilieren von Bauteilen mit veränderlichen Querschnitten wurde das herstellbare Bauteilspektrum des Verfahrens maßgeblich erweitert. Dadurch wurde der Weg für die Herstellung komplexer, belastungsangepasster Strukturbauteile in einem kontinuierlichen, sehr wirtschaftlichen Fertigungsprozess geebnet, die bislang entweder gar nicht oder nur mit sehr hohem Aufwand gefertigt werden konnten.
Neben den bereits bestehenden Anwendungsmöglichkeiten stellt die Bauteilgruppe von Profilen mit variierenden Querschnitten ein großes Marktpotential für Produktbereiche dar, die die Profiliertechnik bislang entweder nicht genutzt haben oder diese nicht nutzen konnten. Der Einsatz veränderlicher Profile und deren Integration in eine Gesamtstruktur wird in vereinzelten Branchen zwangsläufig zu neuen Konstruktionskonzepten und Fertigungsstrategien führen, die technische Verbesserungen und größeren wirtschaftlichen Nutzen versprechen.
Aktualisiert: 2022-02-08
> findR *
Aktualisiert: 2020-07-16
> findR *
Das Projekt leistet für die Weiterentwicklung der Simulation von Umformprozessen einen wichtigen Beitrag zur Ermittlung von Randbedingungen und technologischen Parametern bei der Werkzeugentwicklung. Damit kann eine hohe Prozesssicherheit und eine hohe Qualität in Bezug auf die Maßhaltigkeit des umgeformten Bleches gewährleistet werden.
Mit einer verbesserten Prognosefähigkeit bei der Simulation von Blechumformprozessen wird die Zeit bis zum Serienanlauf verkürzt, da sich der manuelle Aufwand bei der Werkzeugeinarbeitung vermindert. Die geringe Abweichung beim 3D-Vergleich bestätigt die Notwendigkeit und Effektivität der erweiterten FEM-Prozessmodelle.
Aktualisiert: 2019-10-09
> findR *
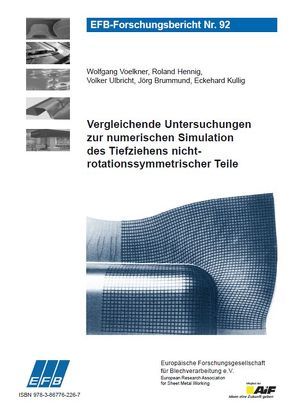
Im Rahmen des Vorhabens sollte untersucht werden, ob die bei der rotationssymmetrischen Teileklasse festgestellten sehr guten Ergebnisse der Simulation auf der Basis der Deformationstheorie auch auf nichtrotationssymmetrische Teile übertragbar sind.
Im verwendeten Simulationsprogramm wird eine gegebene Geometrie (Blechteil) in einem Schritt vom Ausgangzustand (Platine) auf den Endzustand abgebildet. Gesucht wird das Minimum der dafür erforderlichen Formänderungsarbeit auf der Grundlage finiter Spannungs-Dehnungsbeziehungen in mehreren Iterationsschritten. Voraussetzung ist die Gültigkeit dieser Beziehungen und der Deformationstheorie für große plastische Dehnungen. Die Problemstellung bestand darin, wie genau die Verformungen am Bauteil unter diesen Voraussetzungen bestimmt werden können.
Für das Versuchsprogramm wurde ein Modellwerkzeug mit leicht wechselbaren Aktivteilen für verschiedene Geometrieformen zur Untersuchung typischer Versagensfälle im Bereich wannen- und muldenförmiger Teile konzipiert. Es erfolgte eine Auswahl derzeit interessanter Werkstoffe für den Karosserie- und Behälterbau sowohl mit deutlich unterschiedlichem als auch mit ähnlichem Verfestigungsverhalten. Für alle Werkstoffe wurden die Fließkurven, Grenzformänderungskurven und relevante Werkstoffparameter wie r- und n-Wert ermittelt und durch mathematische Approximation als Werkstoffdatei für das Programm bereitgestellt.
In mehreren Versuchsreihen wurden Einflüsse der Geometrieformen, der Werkstoffeigenschaften und der Randbedingungen auf das Ziehergebnis bestimmt, Kraft- und Deformationsverläufe ermittelt und berechnete Zuschnittkonturen in verschiedenen Ziehtiefen an unterschiedlichen Geometrieformen überprüft. Experimentell konnten deutliche Einflüsse der Geometrieformen und des Verfestigungsverhaltens der Werkstoffe auf das Ziehergebnis und das Auftreten von Versagensfällen nachgewiesen werden. Die Einflüsse der Randbedingungen Reibung und Niederhalterdruck waren demgegenüber eher gering und nur in der Nähe von Versagensfällen deutlich nachweisbar.
Bei der Berechnung der Modellversuche in einem Schritt wurden deutliche Abweichungen zwischen berechneten und experimentellen Ergebnissen festgestellt. Insbesondere die Streckziehanteile im Bodenbereich der untersuchten Wannen wurden .überhöht berechnet, während die Tiefziehanteile an der Ziehkante zu niedrig bestimmt wurden. Damit konnte auch die Grenze zu den auftretenden Versagensfällen anhand der Grenzformänderungskurve nicht exakt bestimmt werden. Auch die Werkstoffunterschiede fielen in der Rechnung geringer aus als sie experimentell nachgewiesen werden konnten.
Die vorausberechneten Zuschnittgeometrien stimmten in geringen Ziehtiefen noch recht gut mit den experimentellen Ergebnissen überein, während bei größeren Ziehtiefen besonders an den kurzen Seiten stärkere Abweichungen auftraten, da hier die Abweichungen von den Voraussetzungen der Theorie zu groß werden. Die bestmögliche Einhaltung der Voraussetzungen wird bei flachen Streckziehteilen mit großem Flansch (Ziehanlageflächen) und flachen Zargen (eindeutige Geometrieabbildung) ohne Überschreitung des Kraftmaximums erreicht. Größere Abweichungen sind zu erwarten bei sehr tiefen Teilen mit kleinem Flansch nach Überschreiten des Kraftmaximums (z. B. Ölwannen) aufgrund der Prozeß- und Reibungseinflüsse sowie Entlastungserscheinungen im Boden- und Flanschbereich.
Bei den untersuchten Praxisteilen waren kritische Bereiche sowohl hinsichtlich Faltenbildung als auch Reißern schnell erkennbar, ohne jedoch auch hier die Größe der Deformationen und deren Abstand zur Grenzkurve exakt bestimmen zu können. Ein Überblick über Gefahrenbereiche eines Bauteils ist damit jedoch sehr schnell und sehr früh möglich, wodurch eine Optimierung der Bauteilgeometrie bereits in der Konstruktionsphase durch die Vermeidung solcher Bereiche ermöglicht wird. Dadurch ist ein geringerer Try-out-Aufwand bei der Werkzeugerprobung und eine spätere höhere Prozeßsicherheit erreichbar.
Zur weiteren Annäherung an die Praxisbedingungen wird derzeit eine neue Programmversion erarbeitet, die eine schrittweise Berechnung des Umformprozesses gestattet und damit den Prozeßcharakter des Tiefziehens besser nachbilden kann. Damit konnten bereits wesentlich bessere Ergebnisse sowohl hinsichtlich der errechneten Deformationen als auch der Werkstoffunterschiede erreicht werden. Auch die Einschätzung von Versagensfällen im Grenzformänderungsschaubild ist dadurch erheblich sicherer geworden. Bei idealisierten Versuchen unter größtmöglicher Annäherung an die Voraussetzungen der Theorie durch Verringerung der Biege- und Reibkraftanteile konnte sogar eine fast identische Übereinstimmung zwischen berechneten und experimentellen Ergebnissen erreicht werden, so daß die Weiterentwicklung dieser Programmversion für die Berechnung komplizierter Realbauteile unter Berücksichtigung von Reibung und Biegung sehr erfolgversprechend ist.
Aktualisiert: 2022-02-08
> findR *
Neben der Entwicklung des neuen in-situ Umform-Füge-Verfahrens, der prototypischen Umsetzung des dazu erforderlichen variothermen Werkzeuges und der Weiterentwicklung der verstärkten Mehrlagengestricke (vor allem die Erhöhung ihrer Umform-/ Drapierbarkeit) kommt der Betrachtung der Grenzschichten des Textil-Blech-Verbundes besondere Bedeutung zu.
Durch die Entwicklung und Durchführung geeigneter Oberflächenmodifikationen werden die Haftfestigkeit des Verbundes und damit die Bauteilqualität entscheidend gesteigert. Weiterhin werden FE-Modelle generiert und eine Potentialanalyse und Kostenbetrachtung mit Ausblicken zur Weiterentwicklung des Verfahrens dargestellt.
Aktualisiert: 2019-10-09
> findR *

Durch die Untersuchungen des Gleitziehbiegens von Tailored Blanks wurden weitere Grundlagen für die sichere Werkstück- und Prozessauslegung für das wenig verbreitete Profilierverfahren Gleitziehbiegen geschaffen. Mittels seitlich verstellbarer Matrizen können reproduzierbar belastungsangepasste Profile hergestellt werden, die unterschiedliche Querschnitte über der Profillänge aufweisen. Beim Einsatz von Tailored Blanks als Ausgangsmaterial für das Gleitziehbiegen erweitert sich das Anwendungsspektrum der hergestellten Profile um ein Vielfaches.
Im Verlauf der Untersuchungen wurde das Gleitziehbiegen von Tailored Blanks umfassend simuliert. Die seitliche Werkzeugverstellung stellte in der Simulation ein großes Problem in Bezug auf stabile Kontaktbedingungen dar. Durch die Kombination von Kontakten aus dem Crash-Bereich (PAM-CRASH-Kontakt 33) mit PAM-STAMP konnte dieses Problem gelöst werden. Aufwendig ist nach wie vor die Erzeugung der Netzgeometrien bei Tailored Blanks, da diese Werkstückgeometrie für das Gleitziehbiegen mit den Standardvernetzern nur unbefriedigend zu vernetzen ist.
Bei der Simulation des Gleitziehbiegens wurden mehrere Werkzeugstadien untersucht. Zunächst wurden die Matrizen einzeln betrachtet und verschiedene Varianten der Nahtlage berechnet. Um weiter die Qualität der Teile zu verbessern wurde eine Werkzeugentwicklung in mehreren Stufen durchgeführt. Dabei wurde die Tiefe der Matrizen reduziert, um den Kontaktbereich der Werkzeuge mit dem Blech zu verringern, was einer „freien“ Vorwölbung besser entsprechen würde. Mit dieser Werkzeugvariante konnten vollkommen neue Profilgeometrien mit gewölbtem Boden erzeugt werden. Bei der visioplastischen Auswertung ergab sich eine gute Übereinstimmung der durchgeführten Versuche mit den Simulationsrechnungen.
Eine vergleichende Auswertung ist nur an den Biegekanten der Profile sinnvoll, in allen anderen Bereichen sind Dehnungen zu gering oder gar nicht vorhanden. Dabei sind an der Biegekante in allen Richtungen (e1, e2 und e3) nur geringe Deformationen vorhanden. Bei den Experimenten und der Simulationen hat sich gezeigt, dass eine starke Abhängigkeit der Werkstückgeometrie von der Innengeometrie der Matrize vorhanden ist. Je nach „Tiefe“ der Matrize können Werkstücke mit gewölbtem Bodenbereich oder mit gewölbtem Flanschbereich erzeugt werden. Um einen optimalen Ziehspalt zur Umformung von Blechzuschnitten aus Tailored Blanks zu erhalten modifizierte man die bestehende Versuchsanlage.
Es konnten nach der Modifizierung Tailored Blanks unter konstanten Reibbedingungen zu U-Profilen umgeformt werden. Durchgeführte Schmierstoffvariationen ließen weitere grundlegende Erkenntnisse zu. Aufgrund der lokal hohen Flächenpressungen an den Radien des Ziehteiles ist speziell dort mit erhöhtem Verschleiß an den Werkzeugen zu rechnen. Begleitende Simulationen konnten die Versuchsergebnisse bestätigen und ermöglichen eine Vorausberechnung des Umformvorgangs.
Ansatzpunkte für eine Weiterentwicklung des Verfahrens sind beispielsweise die Untersuchung von Einsatzmöglichkeiten von Kunststoffwerkzeugen. Die damit einhergehende weitere Reduzierung der Kosten wirkt sich positiv auf die Attraktivität des Verfahrens aus und begünstigt eine industrielle Umsetzung der Technologie.
Aktualisiert: 2019-10-09
> findR *

Beim Scherschneiden von Aluminiumblechwerkstoffen wird im Vergleich zu Stahlwerkstoffen bereits bei geringer Gratbildung die Auflösung des Werkstoffverbunds an der Schnittfläche beobachtet. Die abgelösten Werkstoffpartikel in Form von stark kaltverfestigten Spänen (Flitter) gelangen zwischen Bauteil und Werkzeug. Daraus resultiert zwangsläufig eine Beschädigung des Blechteils. Die Ergebnisse beim Scherschneiden mit geschlossener Schnittlinie zeigen, dass der relative Schneidspalt einen geringen Einfluss auf die Schnittgrathöhe ausübt.
Die Schnittgrathöhe wird wesentlich durch den Schneidkantenradius, d. h. durch den Verschleißzustand der Schneidkante beeinflusst. Ein optimaler Schneidspalt in diesem Zusammenhang ist der Schneidspalt, bei dem die geringste Abrundung der Schneidkanten auftritt, und somit auch beim Scherschneiden großer Stückzahlen kleine Grathöhen entstehen. Die Bedeutung des relativen Schneidspalts und des Schneidkantenzustands auf die Schnittgrathöhe beim Reißen ist dieselbe wie beim Scherschneiden.
Zur sicheren Gewährleistung eines vollkantigen Schnitts und aufgrund der Zunahme der Differenz zwischen Istmaß und Nennmaß der Schnittlinie und der bezogenen Schneidarbeit ist eine prozesssichere Reduzierung der Schnittgrathöhe beim Reißen mit entsprechender Fasengeometrie und Schneidspalten zwischen 20% und 40% zu erzielen.
Die Versuchsergebnisse zeigen. dass der Einfluss des relativen Schneidspalts auf die Schnittgrathöhe beim Scherschneiden mit offener Schnittlinie wesentlich größer ist. als beim Scherschneiden bzw. Reißen mit geschlossener Schnittlinie. Werden relative Schneidspalte unterhalb des kritischen relativen Schneidspalts gewählt, kann die Schnittgrathöhe signifikant reduziert werden.
Abschließend bleibt festzuhalten. dass durch die Wahl entsprechender Verfahrensparameter eine deutliche Reduzierung der Schnittgrathöhe und damit die Gefahr der Bildung von Flitter verringert werden kann. Dies gilt insbesondere beim Scherschneiden mit offener Schnittlinie. das als Zerteilverfahren bei jedem Beschneiden von Karosserieteilen eingesetzt wird. Dadurch ist es möglich, die Fertigung von Karosserieteilen aus Aluminiumknetlegierungen reproduzierbarer, prozesssicherer und wirtschaftlicher zu gestalten.
Aktualisiert: 2022-02-08
> findR *
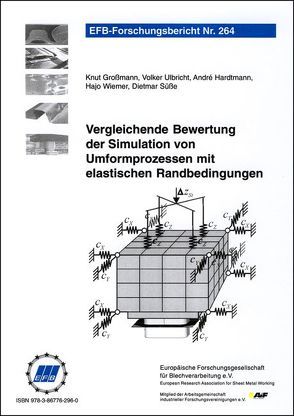
Ausgehend von einer Analyse des Gesamtsystems "Blechumformprozess" wurden Defizite der herkömmlichen Simulationsmethoden erarbeitet. Vor allem die bisherige Vernachlässigung der Einflüsse statischer Genauigkeitskenngrößen von Pressmaschinen - wie die vertikale und kippende Verlagerung des Pressenstößels - wurde als Defizit erkannt.
Durch die ersetzende Modellierung der Presse mit Federelementen konnten Modellstrukturen entwickelt werden, die die Stößelbettung im FEM-Prozessmodell abbilden können. Die Parametrierung der Federelemente erfolgt dabei über entsprechende Transformationsfunktionen aus vorhandenen Steifigkeitswerten der Pressen.
Die Leistungsfähigkeit des entwickelten Modellansatzes wurde anhand eines praxisnahen Benchmarkteils "S-Rail" veranschaulicht. Der Vergleich mit der bisherigen Modellierung zeigt, dass mit der Einbeziehung der statischen Presseneinflüsse in die Modellierung des Umformprozesses maschinenbedingte Ziehfehler sichtbar gemacht und damit prognostiziert werden können. Die Vorhersagegenauigkeit in der Planung des Blechumformprozesses kann somit durch Erweiterung des Prozessmodells mit den statischen Presseneinflüssen gesteigert werden. Damit steht prinzipiell ein Gesamtmodell des Umformprozesses zur Verfügung, um Einflüsse unterschiedlicher Presseneigenschaften während der Prozessplanung zu berücksichtigen und somit auf simulativem Weg den Aufwand bei Werkzeugeinarbeitung und Serienanlauf zu reduzieren.
Die Realisierung eines "virtuellen Try-Out" durch den Einsatz der Prozesssimulation unter der Berücksichtigung der werkzeug- und maschinenseitigen Randbedingungen in der Produktionsvorbereitung ermöglicht erstmalig das Erkennen von Schwachstellen im Zusammenwirken der Kette Maschine-Werkzeug-Werkstück.
Das Anwendungspotenzial liegt auf der einen Seite bei den kmU's des Werkzeugbaus, die durch Anwendung der erarbeiteten Lösungsstrategie Werkzeuge mit weniger oder sogar ohne Einarbeitungsbedarf herstellen können, und auf der anderen Seite bei den Pressenbetreibern, die den Werkzeugeinarbeitungsprozess verkürzen oder teilweise ganz einsparen können
Aktualisiert: 2019-10-09
> findR *

Durch die im Rahmen dieses Projekts durchgeführten Untersuchungen zum Herstellen variabel längsgekrümmter Profile wurde das Fertigungsverfahren Gleitziehbiegen um wichtige Erkenntnisse bezüglich der Möglichkeiten des Profilierprozesses erweitert. Dies kann zu einer stärkeren Verbreitung des bislang wenig etablierten Verfahrens Gleitziehbiegen beitragen. Grundlagen für die Prozessplanung
und Auslegung sowie zur Konstruktion der Umformwerkzeuge und des benötigten Antriebs wurden erarbeitet. Die Optimierung dieses Profilierverfahrens und damit eine Verbesserung hinsichtlich der sicheren Planung und der Beherrschbarkeit des Gleitziehbiegeprozesses werden sich weiterhin positiv auf eine weitere Verbreitung auswirken.
Mit Hilfe einer neu installierten Anlage ist man in der Lage, Hutprofile mit über der Längsachse veränderlichen Längskrümmungen zu erzeugen. Dabei besteht die Möglichkeit im Rahmen der Werkzeug- und Anlagendimensionen sowohl kontinuierlich vom Coil als auch diskontinuierlich mit Zuschnitten zu arbeiten. Eine Optimierung der Zuschnittsgeometrie hat mit Unterstützung der Simulation und
in Versuchsreihen stattgefunden. Die Simulation der Gleitziehbiegeprozesse mit dem System PAM-STAMP 2G liefert wichtige Informationen in der Phase der Werkzeugkonstruktion für das Werkzeug zur Herstellung von Hutprofilen sowie in der Darstellung des gesamten Verfahrensablaufes mit dem konzipierten Walzenantrieb mit integrierter Biegung.
Die Gestaltung des Walzenantriebes sollte in weiteren Forschungsvorhaben näher untersucht werden, da eine erste Pilotanlage noch nicht alle Untersuchungspunkte abdecken kann. Durch die Möglichkeit, in einem flexiblen Prozess kleine und mittlere Serien individuell konfigurierbarer Profile herstellen zu können, ist eine Verringerung der Herstellkosten für diese Art Profile zu erwarten.
Weiterhin werden durch die Einbringung definierter Längskrümmungen neue Anwendungsbereiche der Profiliertechnik erschlossen. Individuelle Profile können vor allem vor dem Hintergrund immer stärker ansteigender Umweltstandards beispielsweise im Fahrzeugbau zur Umsetzung von Leichtbaukonzepten und damit zur Schonung von Ressourcen beitragen.
Durchgeführte Schmierstoffvariationen lassen weitere grundlegende Erkenntnisse zu. Aufgrund der lokal hohen Flächenpressungen an Kontaktstellen des einlaufenden Profils mit dem Werkzeug ist speziell dort mit erhöhtem Verschleiß an den Werkzeugen zu rechnen.
Neben dem Einsatz des Gleitziehbiegens mit der Möglichkeit der Einbringung von Profillängskrümmungen kommt auch der Einsatz von Gleitziehbiegestufen in einem Walzprofilierprozess in Frage. Diese Umsetzung findet im Rahmen der Integration einer Gleitziehbiegestufe in einen Walzprofilierprozess zunächst zur Herstellung eines C-Profils sowie zukünftig eines U-Profils statt.
Dies führt zur Substitution von kostenintensiven und stark verschleißanfälligen Werkzeugsätzen. Der Herstellprozess kann so flexibler und kostengünstiger gestaltet werden.
Mit diesem Forschungsvorhaben ist es erstmalig gelungen, eine Gleitziehbiegeanlage als Pilotanlage darzustellen, die im Gegensatz zur vorherigen translatorisch arbeitenden Gleitziehbiegeanlage durch den nunmehr vorhandenen Walzenantrieb auch eine kontinuierliche Arbeitsweise ermöglicht. Es kann sowohl vom Coil gearbeitet als auch Profilzuschnitte verwendet werden. Dabei ist es gelungen, eine Möglichkeit zur Einbringung definierter Längskrümmungen zu integrieren. Die Anlage ist mit vertretbarem Aufwand transportabel und kann vor Ort in einem gewissen Geometriespektrum Profile beliebiger Länge erzeugen, die je nach Wunsch mit einer definierten Längskrümmung versehen werden können.
Weiterhin ist es gelungen, durch die Berücksichtigung der Erfahrungen aus der Praxis, einer intelligenten Konstruktionsmethodik und nicht zuletzt der numerischen Simulation ein Werkzeug für Hutprofile in einem Zug zu konzipieren und zu bauen, welches qualitativ hochwertige Hutprofile erzeugt.
Aktualisiert: 2019-10-09
> findR *
MEHR ANZEIGEN
Bücher von Ulbricht, Volker
Sie suchen ein Buch oder Publikation vonUlbricht, Volker ? Bei Buch findr finden Sie alle Bücher Ulbricht, Volker.
Entdecken Sie neue Bücher oder Klassiker für Sie selbst oder zum Verschenken. Buch findr hat zahlreiche Bücher
von Ulbricht, Volker im Sortiment. Nehmen Sie sich Zeit zum Stöbern und finden Sie das passende Buch oder die
Publiketion für Ihr Lesevergnügen oder Ihr Interessensgebiet. Stöbern Sie durch unser Angebot und finden Sie aus
unserer großen Auswahl das Buch, das Ihnen zusagt. Bei Buch findr finden Sie Romane, Ratgeber, wissenschaftliche und
populärwissenschaftliche Bücher uvm. Bestellen Sie Ihr Buch zu Ihrem Thema einfach online und lassen Sie es sich
bequem nach Hause schicken. Wir wünschen Ihnen schöne und entspannte Lesemomente mit Ihrem Buch
von Ulbricht, Volker .
Ulbricht, Volker - Große Auswahl an Publikationen bei Buch findr
Bei uns finden Sie Bücher aller beliebter Autoren, Neuerscheinungen, Bestseller genauso wie alte Schätze. Bücher
von Ulbricht, Volker die Ihre Fantasie anregen und Bücher, die Sie weiterbilden und Ihnen wissenschaftliche Fakten
vermitteln. Ganz nach Ihrem Geschmack ist das passende Buch für Sie dabei. Finden Sie eine große Auswahl Bücher
verschiedenster Genres, Verlage, Schlagworte Genre bei Buchfindr:
Unser Repertoire umfasst Bücher von
- Ulbts, Michael
- Ulc, Simon
- Uldall, Bjarne
- Uldbæk Nielsen, Katherine
- Ulder, L.U.
- Ulderup, Sascha
- Uldin, Tanya
- Uldorf, C.
- Uldrich, Andreas
- Uldry, Dominique
Sie haben viele Möglichkeiten bei Buch findr die passenden Bücher für Ihr Lesevergnügen zu entdecken. Nutzen Sie
unsere Suchfunktionen, um zu stöbern und für Sie interessante Bücher in den unterschiedlichen Genres und Kategorien
zu finden. Neben Büchern von Ulbricht, Volker und Büchern aus verschiedenen Kategorien finden Sie schnell und
einfach auch eine Auflistung thematisch passender Publikationen. Probieren Sie es aus, legen Sie jetzt los! Ihrem
Lesevergnügen steht nichts im Wege. Nutzen Sie die Vorteile Ihre Bücher online zu kaufen und bekommen Sie die
bestellten Bücher schnell und bequem zugestellt. Nehmen Sie sich die Zeit, online die Bücher Ihrer Wahl anzulesen,
Buchempfehlungen und Rezensionen zu studieren, Informationen zu Autoren zu lesen. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
das Team von Buchfindr.