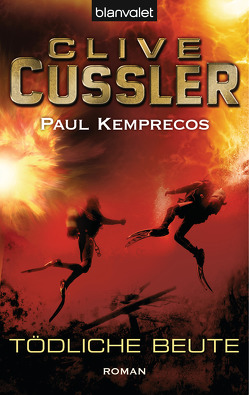Anton Bruckner.
Angst vor der Unermeßlichkeit
Klaus Heinrich Kohrs
Anton Bruckner »ist ein armer verrückter Mensch, den
die Pfaffen von St. Florian auf dem Gewissen haben«
– dieser Satz von Johannes Brahms reißt schlaglichtartig
eine unüberbrückbare Kluft auf zwischen dem ins
gehobene Bildungsbürgertum integrierten Komponisten,
in dessen Arbeitszimmer über dem Schreibtisch
ein Reproduktionsstich der Mona Lisa und über dem
Sofa ein Stich der Sixtinischen Madonna hing, und dem
gesellschaftlich nur schwer einzuordnenden Bruckner,
in dessen karg möblierter Wohnung sich hinter einem
grünen Vorhang ein Foto der toten Mutter auf dem
Sterbebett verbarg.
Was es heißen könne, daß nach dem Ende unserer Zeit
eine unausdenkbare Ewigkeit beginnt, wie Unermeßlichkeit
musikalisch zu formulieren sei, darum kreisen
Bruckners Reflexionen, die vor keinem Grenzgedanken
zurückschrecken – so wie ihn auch Katastrophen oder
die menschenleere, unvorstellbare Weite des Nordmeers
und dessen letzte Inseln obsessiv beschäftigen.
Schließlich ist es der Gedanke an den Allesvernichter
Tod, der ihn zunehmend bedrängt und der zu einem
Thema der letzten beiden Symphonien wird. Wie die
Musik diese Abenteuer des Denkens und der Imagination,
die eine nicht stillzustellende Krisendynamik
erzeugen, strukturhomolog realisiert, soll hier gezeigt
werden.
Bruckner war alles andere als ein »Musikant Gottes«.
Die durch zahlreiche Erinnerungsberichte und Anekdoten
korrumpierte Vorstellung vom Menschen Bruckner
bedarf noch immer einer rigorosen Kritik. Er war
ein Krisenkomponist par excellence. Dies tritt umso
mehr hervor, je strikter mit den Quellen verfahren
wird. Kunst entsteht nicht aus der Ergebung in fromme
Kontemplation dogmatischer Inhalte, sondern auf
der Schwelle zum Unausdenkbaren, auf der es sich mit
allen Kräften des Ichs zu halten gilt.