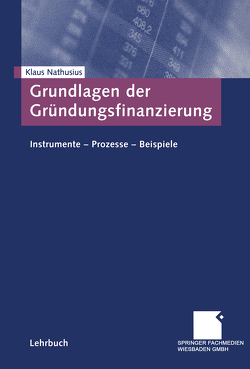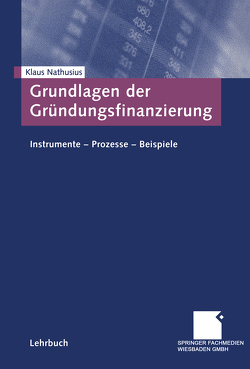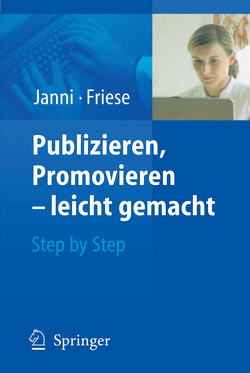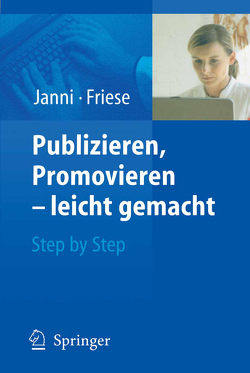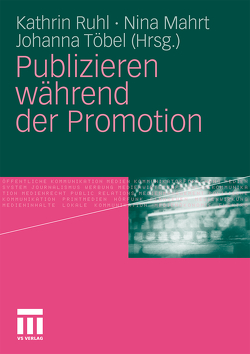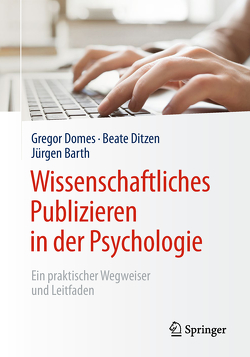Ausscheidung von Mycoplasma suis unter Feldbedingungen
Christopher Heinrich Wilhelm Wöstmann
Das Ziel dieser Studie war es, eine Vorstellung von der Relevanz möglicher blut-unabhängiger Übertragungswege von Mycoplasma suis im Rahmen einer Feldin-fektion zu gewinnen. Hierfür wurden zum einen Urin-, Speichel- und Nachge-burtsproben von Sauen und zum anderen Blut- und Spermaproben von 183 Ebern einer Besamungsstation in Süddeutschland mittels qPCR auf M. suis un-tersucht. Die 148 Speichel-, 47 Urin- und 143 Plazentaproben stammten aus As-servaten der Klinik für Schweine der LMU und waren im Rahmen vorangegange-ner Studien auf 15 bekannt M. suis-positiven Betrieben in Süddeutschland ge-wonnen worden. Die Blut- und Spermaproben der 183 Eber waren auf der Be-samungsstation im Rahmen des Routine-Monitorings gewonnen und freundli-cherweise von deren Betreiber zur wissenschaftlichen Untersuchung zur Verfü-gung gestellt worden.
Die DNA-Extraktion der Speichel-, Urin- und Plazentaproben sowie der Eber-Blutproben erfolgte unter Verwendung des GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kits (Sigma-Aldrich, Steinheim, Deutschland). Die Plazentaproben waren hierfür zunächst homogenisiert worden. Die DNA-Extraktion der Spermaproben erfolgte unter Verwendung des QIAamp® DNA Mini Kits (QIAGEN GmbH, Hilden, Deutschland) in Pools zu je 5 Proben am Lehrstuhl für Virologie des Instituts für Infektionskrankheiten und Zoonosen, Tierärztliche Fakultät der LMU. Die an-schließende PCR-Untersuchung wurde am Institut für Nutztierwissenschaften der Universität Hohenheim mittels LightCycler® (LC) 2.0 System (Roche-Diagnostics, Mannheim, Deutschland) durchgeführt.
Die Untersuchung der Speichel- und Urinproben ergab keinen Nachweis von M. suis-DNA. Währenddessen zeigte die Beprobung der Nachgeburtsproben bei sechs Tieren ein positives Ergebnis. Aufgrund der Ergebnisse einer früheren Un-tersuchung war ersichtlich, dass bei zweien dieser Tiere die Blutunter¬suchung mittels PCR auf M. suis-DNA ein negatives Ergebnis gezeigt hatte, sowie dass außer einem dieser beiden Tiere alle Sauen M. suis-positive Ferkel geboren hat-ten. Allerdings war keinerlei Korrelation der Bakterienzahlen im Blut und im Pla-zentagewebe ersichtlich.
Die 183 Eber der Besamungsstation entstammten mindestens 26 Eberzucht-betrieben. Ihr Alter lag zwischen 9 und 77 Monaten und sie verteilten sich auf die Rassen Deutsches Edelschwein (n = 8), Deutsche Landrasse (n = 16), Iberi-sches Schwein (n = 1), Duroc (n = 6) und Piétrain (n = 150), sowie eine Duroc-Piétrain-Kreuzung (n = 2). Die analysierten Blut- und Spermaproben der Tiere waren zu 100% M. suis-negativ. Dies überraschte insofern, als dass für adulte Schweine eine hohe Prävalenz von M. suis erwartet wurde.
Die Ergebnisse dieser Untersuchung legen nahe, dass Urin und Speichel in der Übertragung von M. suis keine größere Rolle spielen. Hygienekonzepte zum Schutz vor M. suis sind entsprechend auf eine Berücksichtigung dieser Körper-flüssigkeiten wohl nicht angewiesen. Weiterhin zeigen die Ergebnisse, dass eine Dia-gnostik mittels Kaustrick für M. suis eher keine Option darstellt.
Der Nachweis von M. suis-DNA im Plazentagewebe stützt die Annahme der vertikalen Übertragbarkeit dieses Erregers. Wie häufig eine solche Organmani-festation auftritt und ob sie tatsächlich von der Präsenz von M. suis im Blut des Wirtes unabhängig ist, müssen zukünftige Untersuchungen zeigen.
Ob die Tatsache, dass im Rahmen der vorliegenden Studie kein Nachweis von M. suis-DNA im Sperma der Zuchteber möglich war, bedeutet, dass es tat-sächlich nicht zu einer Ausscheidung des Erregers mit dem Samen kommt, oder ob dies schlicht auf eine Naivität der Tiere – ggf. im Zusammenhang mit einer altersab-hängigen Rekonvaleszenz – zurückzuführen ist, muss im Rahmen künf-tiger Forschung ermittelt werden.