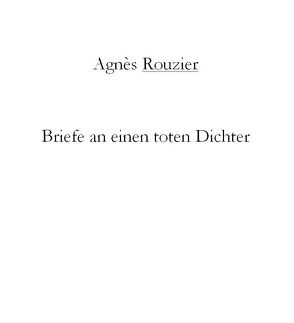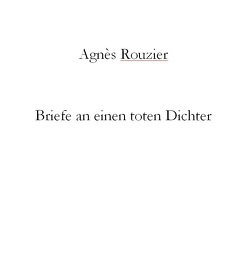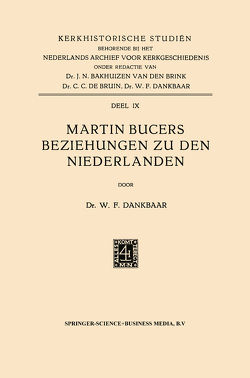Briefe an einen toten Dichter
An Rilke
Agnès Rouzier, Erwin Stegentritt
Schreiben ist Leben, ein Art Leben – so könnte man die Texte von Agnès Rouzier umschreiben. Nur schreibend leben wir, doch zugleich mit dem Schreiben sind wir in der Abwesenheit gefangen. So unternimmt sie es in den sechs bzw. acht Briefen an Rilke, das Schreiben und zugleich das Leben durch das eigene Schreiben zu bannen, es für sich selbst wohnbar, lebbar zu machen.
In den Briefen nutzt Agnès Rouzier Rilke-Zitate als auslösendes Element für ihre Antworten, doch was bezweckt sie mit den Antworten, an einen toten Dichter? In der Situation des Briefe-Schreibens wird die Problematik des Schreibens noch potenziert: der Adressat ist abwesend, der Leser ist nicht zugegen und das Schreiben ist eine Handlung, die sich an einen Raum richtet, der leer ist. Das Schreiben vertieft die Einsamkeit – es gibt nur Erinnerungsstücke, ganz so, als seien sie mit dem fernen Empfänger gemeinsam erlebt, gemeinsam heraufbeschworen und geteilt.
Aber der Dichter ist tot, er ist unerreichbar: die Antworten sind Antworten an sich selbst, die Fragen sind Fragen, die schon immer gestellt sind, nur in den Rilke-Briefen sind sie in eindringlichster Art ausgedrückt. Jeder Augenblick gelebt angesichts des Todes, angesichts eines Lebens, das sich nicht in Wohlgefallen übt, sondern in der existenziellen Frage: wie lebe ich, kann das Schreiben mich erretten oder ist der Satz „Ich will, dass das Wort abreisen einen Sinn hat“ – eine denkbare Lösung – für Agnès Rouzier die einzige Lösung ? – um dann im 6. (ursprünglich letzten) Brief zu enden. „jener Frieden: der Friede in gewisser Weise“.
So ist es ein seltsamer Zufall des Schicksals, dass die Briefe an einen toten Dichter zuerst in der Schweizer Zeitschrift Furor erschienen sind – in ihrem Sterbemonat.