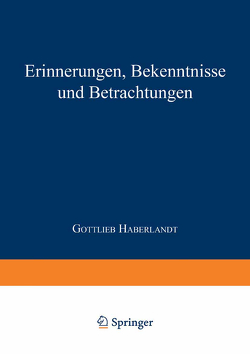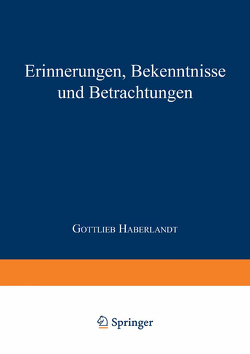Hutgesicht
Briefe an die Mutter
Liesel Willems
Was hast du geträumt, als du noch jung warst und ich dich schon alt einstufte, unten im Keller, in der Waschküche, über dem dampfenden Bottich, wenn ich auf der obersten Stufe saß und die duftenden Schwaden einsog, die aus der Tür nach draußen quollen? fragt die Tochter ihre alte Mutter in Briefen und blättert ihre gemeinsam verbrachte Lebenszeit auf. Sie beschreibt das Erschreckende und das Beglückende der letzten Jahre und Monate, bis zum unbegreiflichen Ende.
Erinnerungen eines „Achkinds“
Ein anrührendes, ein ergreifendes Buch, eines das dankbar vom Leben und ehrfüchtig vom Tod erzählt, aber auch erlittenen Schmerz nicht ausspart und Versöhnlichkeit nicht zur alles glättenden Geste degradiert: „Hutgesicht“ hat die Krefelderin Liesel Willems ihre Briefe an die Mutter betitelt. Ein Jahr lang schrieb sie, über sich selber und über ihre Erinnerungen, über ihre Kindheit und über die Mutter, deren Weg sie pflegend und sorgend bis zum Tod begleitete. In ihren Tagesabläufen, im Urlaub oder zu Hause, assoziiert sie und denkt zurück an ihre Träume vom Lieben, an Schläge, dass sie das „Achkind“ war, aber auch, als höchstes Lob einer Modistin „Hutgesicht“ genannt wurde. „Die Reise zu dir war die längste, die ich je gewagt habe. Ich wollte begreifen, warum du mir fremd warst“, schreibt sie zu Beginn ihrer Tagebuchbriefe.
Nach dem Krieg geboren, ist Liesel Willems das Kind von Eltern, die den Krieg als Jugendliche und junge Erwachsene erlebten und überlebten. Deren körperliche Entbehrungen und seelische Verletzungen in die nächste Generation wirkten, deren Glück im Überleben bestand, und die von Liebe nie sprachen.
„Stiehlt ein Krieg Jahre? Oder brennt er sie unerbittlich ein?“ Liesel Willems kann im Rückblick ihre früheren Erfahrungen deuten, die Eigenarten der Mutter, auch die des Vaters. „Wir teilten unser Unvermögen“, sagt sie am Ende. Wenige Tage nach dem Tod der Mutter wird die Autorin selber Großmutter, erinnert sich an ihre Mutterschaft und nimmt „Maß an deiner stillen Freude Großmutter zu sein“. Sie hat sich offensichtlich nicht geschont, sie hat nichts beschönigt oder verklärt.
Gerade deshalb ist dieses Buch so lesenswert, es zeigt Menschen in ihrer Not, in persönlichen und konventionellen Fesseln gefangen und ihren oft hilfslosen Versuch, sich nahe zu sein, Nähe zuzulassen. Und zeigt auch, dass das Scheitern dieser Bemühungen kein Grund ist, es doch nicht immer wieder zu versuchen.
Hans Dieter Peschken
Rheinische Post, 12.1.2008