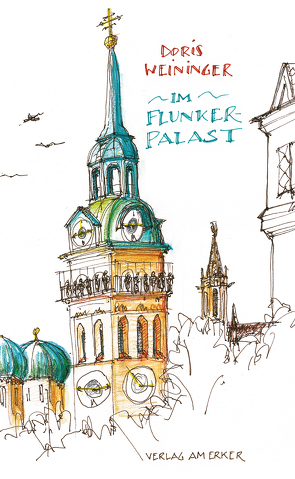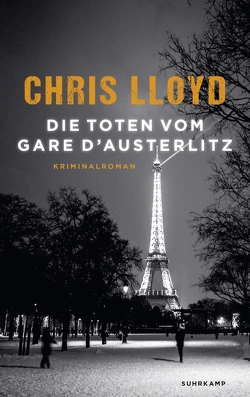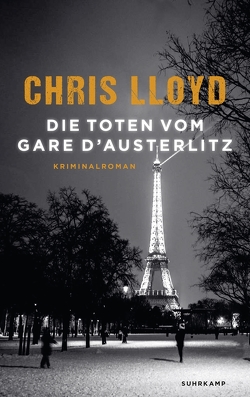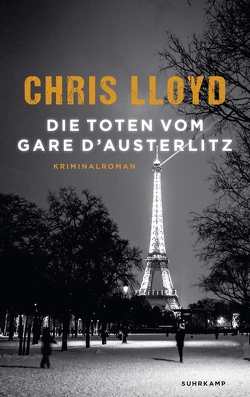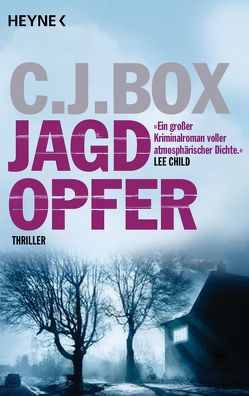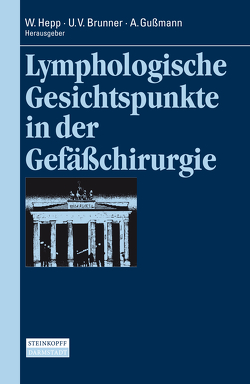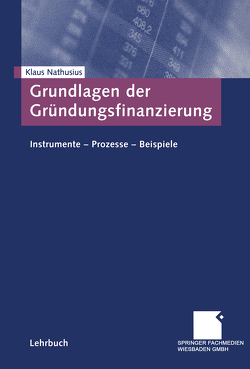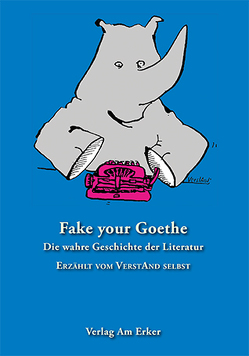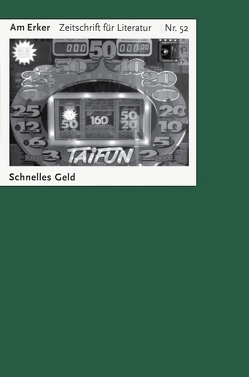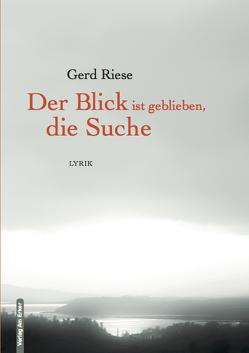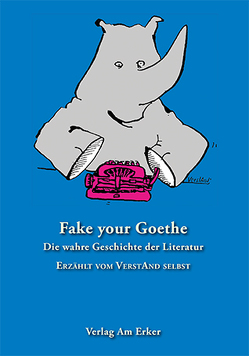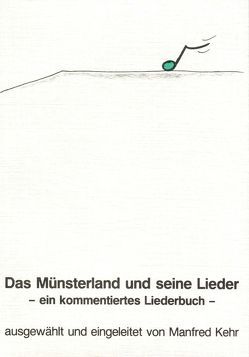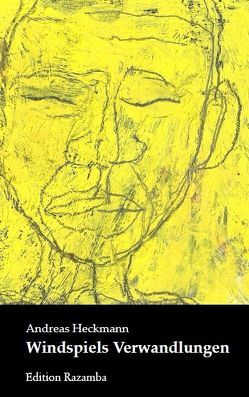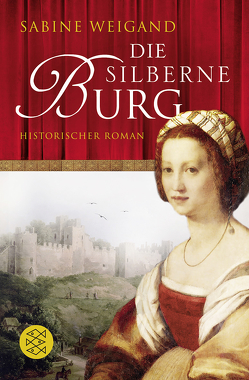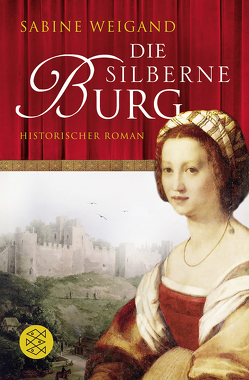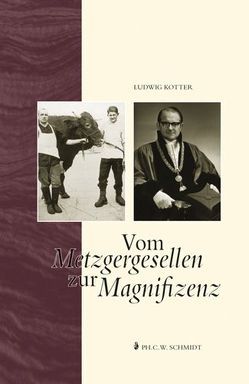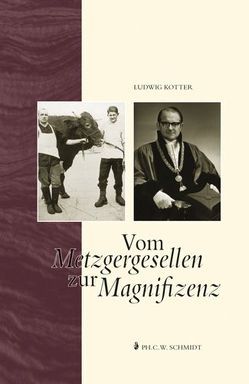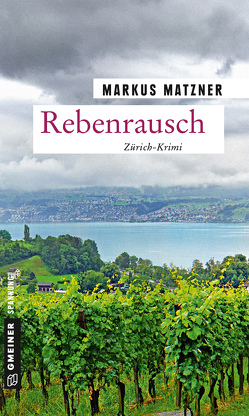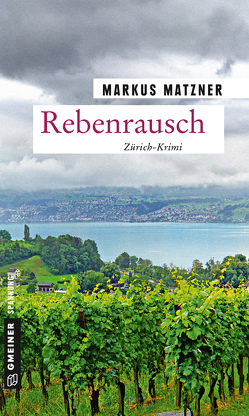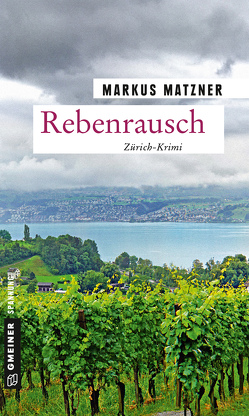Autoren Biografie
Nachwort des Herausgebers
Mag die Katze neun Leben haben: Menschen haben nur eines, doch manche vermögen es mit neunfacher Kraft und Intensität zu leben. Zu ihnen gehörte Doris Weininger. Am 1. Mai 2019 ist sie mit nur dreiundfünfzig Jahren in München gestorben.
Im Brotberuf war sie Archivpflegerin, u.a. für den Bayerischen Rundfunk, für das Erzbistum München und Freising, für eine Tierschutzorganisation. Daneben aber war sie eine begeisterte Theater- und Operngängerin, die von Johan Simons‘ Intendanz an den Kammerspielen schwärmen konnte, eine leidenschaftliche Konzertbesucherin (wobei ihr Bruckner-Messen so lieb waren wie Metal-Konzerte), eine große Reisende, die herrliche Ansichtskarten aus Wien, Lissabon, Sizilien geschrieben hat. Und sie pflegte enge Kontakte in verschiedenste Szenen, hatte donnerstags einen jour fixe mit Staatsanwälten, arbeitete ehrenamtlich in der telefonischen Betreuung von Menschen in psychischen Krisen (wofür sie eine komplexe Ausbildung absolviert hat), war bekennende Katholikin, die jedes Jahr den Aschermittwoch der Künstler in der Frauenkirche besuchte, hat ihre Punk-Sozialisation immer hochgehalten, aber auch zehn Jahre als Schöffin amtiert.
Um die Jahrtausendwende hatte Doris eine intensive Poetry Slam-Phase, die sie ganz Deutschland bereisen ließ. Und fast bis zuletzt hat sie sprudelnde, arabeskenhafte, detailverliebte, stets zu Abschweifungen neigende Kurzprosa verfasst, die voll Witz und Bosheit, Scharfzüngigkeit und Sarkasmus ist, neben Breitseiten auf saturierte Pfahlbürger aber auch von großer Empathie getragene Porträts randständiger, kranker, wunderlicher Menschen enthält, schrulliger Herzgewinnler und passioniert Scheiternder. Und oft hat sie ihren kritischen Blick auf das allzu wohlig prosperierende München gerichtet, das fast besinnungslos in eine Stadt der Reichen und Schönen verwandelt wird, während Krankenpfleger, Busfahrerinnen, Erzieher an die auch kaum mehr bezahlbare Peripherie gedrängt werden, genau wie Künstlerinnen und Kulturarbeiter.
„Die MS und ich, wir hatten uns arrangiert, aber der Krebs nimmt mir alles, was die MS mir gelassen hat“, hat sie ein Jahr vor ihrem Tod zu mir gesagt. Tatsächlich war zu der sehr kämpferisch ertragenen MS ein Krebs gekommen, der sich rasch ausbreitete und dem nur mehr palliativ zu begegnen Doris sich früh entschieden hatte, um sich den Lebensrest nicht mit den Nebenwirkungen von Chemotherapie oder Bestrahlung zu vergällen, deren Erfolgsaussichten verschwindend gering waren. Mit ihr ist ein Mensch gestorben, der in München schon zu Lebzeiten eine – sehr nahbare – Legende war. Die Stadt ist ärmer ohne sie, das fühlen alle, die sie kannten.
Doris Weininger hat die Münsteraner Literaturzeitschrift Am Erker seit Ausgabe 54 (2007) um fünfzehn Prosabeiträge unter eigenem Namen und eine Zugabe als Miss Harmlos bereichert. Fast alle diese Beiträge versammelt dieses Buch, ergänzt um einige Texte, die eingereicht, aber nicht veröffentlicht wurden, und um einige für Am Erker geschriebene, aber nicht eingereichte Texte. Überdies wurde das Roman-Fragment Bernie – Idyllen aus dem Mäandertal, das ihr sehr am Herzen lag, aber nur in Ansätzen und Bruchstücken vorliegt, in eine Lesefassung gebracht, die zumindest eine Ahnung von dem vermitteln soll, was geplant war, aber nicht mehr ausgeführt werden konnte.
Als Redakteur von Am Erker habe ich die Texte von Doris schon zu ihren Lebzeiten lektoriert und für meine Änderungsvorschläge stets ihr uneingeschränktes Plazet erhalten. Für die Buchausgabe nun habe ich ihre Texte erneut redigiert und da und dort um allzu wuchernde Arabesken gekürzt, die im vereinzelten Zeitschriftenbeitrag gern gelesen werden, in der konzentrierten Form einer Textsammlung aber – darin der Misere zwischen Buchdeckeln gesammelter Kolumnen ähnelnd – wohl zur Übersättigung geführt hätten, genauer: zum Zuckerschock. Die Texte haben durch die neuerliche Überarbeitung nach meiner Überzeugung erneut gewonnen, das hätte Doris sicher bestätigt. Skeptischen Leserinnen und Lesern sei indes empfohlen, sich anhand der Originalveröffentlichungen, deren Fundorte am Schluss des Buchs verzeichnet sind, ein Bild zu machen.
Ich möchte nichts Interpretierendes zu Doris‘ Texten sagen, sondern nur darauf hinweisen, wie tief die Themen Körpererfahrung und Krankheit in diese Prosa eingesenkt sind. Bei aller Leichtigkeit, allem Übermut, allem Perlend-Beschwingten zeugen diese Beiträge auch davon, dass sie einer tödlichen Krankheit abgerungen sind, am stärksten wohl „Lammfromm der ärgste Feind oder Jeden Tag kann das Blatt sich wenden“ aus Am Erker 67.
Andreas Heckmann