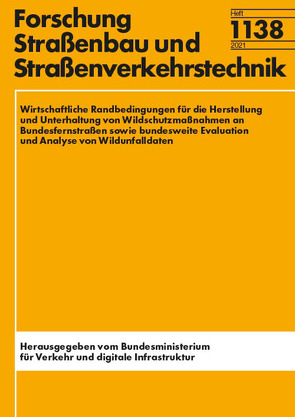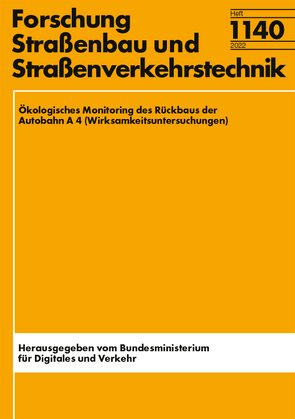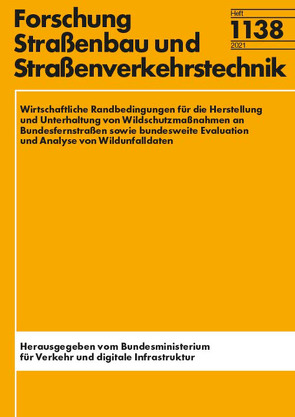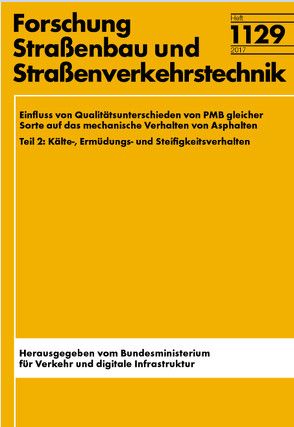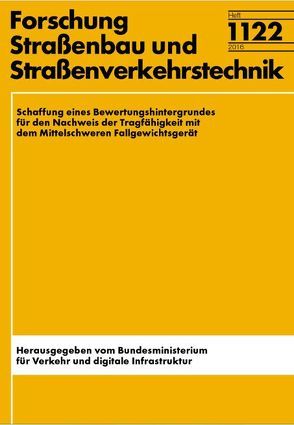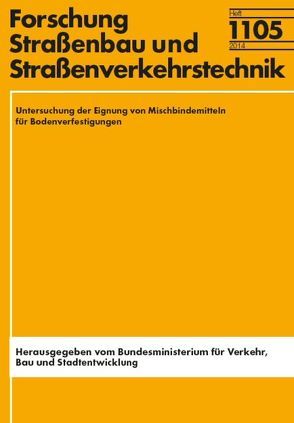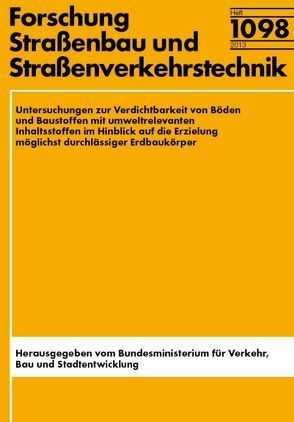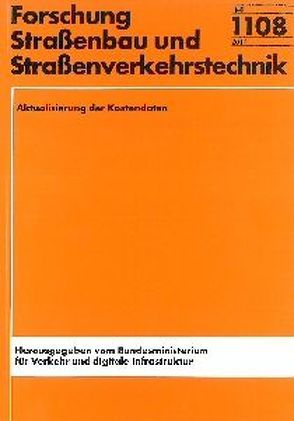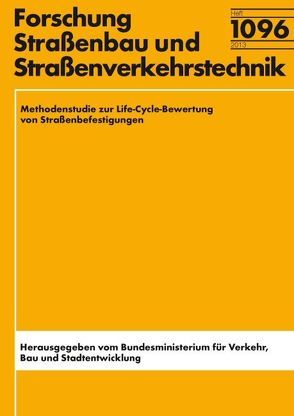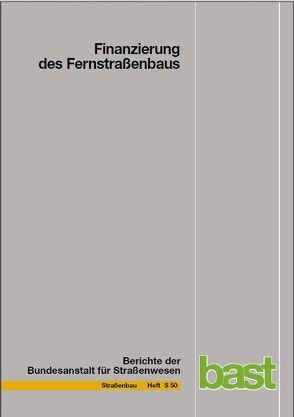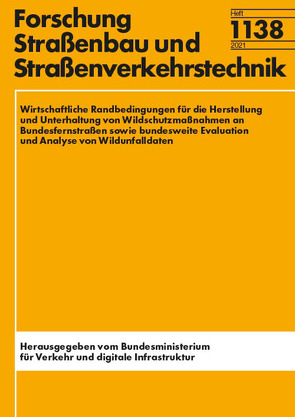
Die Zunahme der Straßennetzdichte, des Verkehrsaufkommens und der Motorisierung einerseits sowie die regional z. T. wachsende Wilddichte und die zunehmende Zerschneidung von Wildwechseln andererseits erhöhen das Risiko von Kollisionen zwischen Fahrzeugen und Tieren. Fahrzeuginsassen können entweder durch den direkten Aufprall mit dem Wildkörper oder durch Ausweichmanöver verletzt oder gar getötet werden und es entstehen oft hohe Sachschäden. Auf der anderen Seite gefährdet die Straßenverkehrsinfrastruktur und deren Betrieb Tiervorkommen auf verschiedene Weise, z. B. aufgrund erheblicher Barrierewirkungen oder aufgrund hoher Tierverluste. Das Forschungsprojekt leistet zwei Beiträge zum Themenkomplex Wildunfälle. Zum einen wurde eine Methode zur Identifizierung von Wildunfallhäufungsabschnitten entwickelt und diese bei gegebener Datengrundlage bundesweit angewandt (I.). Zum andern erfolgte eine Übersicht und Bewertung der bundesweit eingesetzten Wildschutzzaunsysteme, um Vorschläge zur Verbesserung abzuleiten (II.). I. Für den Zeitraum von 2012-2017 wurden bundesweit Wildunfalldaten abgefragt. Der Rücklauf ergab mehr als 800.000 Wildunfalldaten, die geografisch verortet und mithilfe von GIS-Programmen analysiert werden konnten. Die meisten Bundesländer sowie das Tierfund-Kataster Deutschland stellten auswertbare Daten zur Verfügung. Im Rahmen der Auswertung konnten dann 30.393 Wildunfallstrecken für den Zeitraum von 2012 bis 2017 ermittelt werden, die das Kriterium von mindestens 6 Unfällen mit einem maximalen Abstand von 200 m zwischen zwei Wildunfallpunkten erfüllen. Diese Wildunfallstrecken bilden 56,6 % aller gemeldeten Wildunfälle ab. Betroffen sind davon aber nur 4 % des Straßennetzes (29.580 km von 738.145 km). Auf 11.912 Streckenabschnitten liegt die Wildunfalldichte oberhalb von 15 Wildunfälle/ km. Wildunfallstrecken mit > 15 Wildunfällen werden als Wildunfallhäufungsabschnitte definiert. Die wichtigsten Wildunfallhäufungsabschnitte können durch das Projekt für einen Großteil der Bundesländer bzw. deren Landkreise nunmehr lagegenau dargestellt werden. Hier sollten Vermeidungsmaßnahmen prioritär durchgeführt werden. Für die Gebietskörperschaften, wie z. B. Landkreise oder Gemeinden, ohne geeignete Datengrundlagen sollte das Meldesystem möglichst schnell verbessert werden. Wildunfallstrecken mit hoher Stetigkeit, d. h. mit signifikanter Ereigniskontinuität, müssen noch ermittelt werden. Weitere Empfehlungen zum Umgang mit Wildunfällen sind: 1. Die Entwicklung eines bundesweit einheitlich anwendbaren und gut auswertbaren Meldeverfahrens, mit dem Wildunfallhäufungsabschnitte verschiedener Intensitätsstufen fortlaufend ermittelt werden können. Für ein solches Meldeund Auswertesystem sind qualitative Mindestanforderungen an die Meldungen abzustimmen und es beinhaltet die Bereitstellung von Auswertungsroutinen zur gewichteten Ermittlung von Wildunfallhäufungsabschnitten. Dazu sollten die Datenschnittstellen der einzelnen Unfallerfassungsprogramme der Bundesländer vereinheitlicht werden und Folgendes bereitstellen: a. Module zum Export einheitlicher Geodaten, b. Zugang zu anonymisierten Unfallhergangsbeschreibungen, um die verursachenden Tierzarten zu ermitteln (alternativ: Nennung der unfallverursachenden Tierarten). 2. Langfristig sollte das Straßenverkehrsunfallstatistikgesetz (StVUnfStatG) dahingehend geändert werden, dass alle Unfälle an das Statistische Bundesamt übermittelt werden. 3. Die landschaftlichen und straßenraumbezogenen Merkmale (Charakteristika), die die Herausbildung von Wildunfallhäufungen begünstigen, sollten auf Basis der Wildunfallhäufungsabschnitte für eine gezieltere Prävention ermittelt werden. II. Die Anwendung von Wildschutzzäunen in Deutschland erfolgt nach den Wildschutzzaunrichtlinien (WSchuZR), die zuletzt 1985 novelliert wurden. Im Zuge neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse und veränderter Rahmenbedingungen werden die Regelungen in den WSchuZR jedoch in vielen Belangen nicht mehr den aktuellen Verhält¬nissen gerecht. Dies zeigt sich z. B. an den flächendeckend angestiegenen Wilddichten in Deutschland, die mittlerweile die in den WSchuZR zugrunde gelegten Dichten für einen Handlungsbedarf erheblich übertreffen, sowie in der unzureichenden Pflege von Wildschutzzäunen und im Artenschutz, die in den WSchuZR bisher nicht berücksichtigt werden. Die Befragung von Zuständigen des Unterhaltungsdienstes für Bundesfernstraßen in zehn Regionen führte zum Ergebnis, dass Wildschutzzäune gemäß den WSchuZR mit Stacheldraht als Untergrabschutz die Verkehrssicherheit nicht gewährleisten können, da Wildtiere davon nicht genügend aufgehalten werden. Dies wird durch regelmäßig auftretende Wildunfälle unterstrichen, die sich innerhalb von gezäunten Straßenabschnitten ereignen. In einem zweiten Schritt wurden Ideen für einen modularen Wildschutzzaun aufgezeigt, der einen flächigen Einsatz in Deutschland ermöglicht. Das System sollte aus Maschendrahtgeflecht bestehen und kann z. B. bei nachträglicher Zuwanderung streng geschützter Arten wie der Wildkatze modular mit einem Überkletterschutz erweitert werden. Ein standardmäßig integrierter Untergrabschutz verhindert das Unterwühlen bzw. Anheben des Zauns und ermöglicht gleichzeitig eine praktikable Pflege der Vegetation. Wichtige Empfehlungen für die Zukunft sind daher Wildschutzzäune grundsätzlich mit funktionalem Untergrabschutz auszustatten und die Zäune von den Grundstücksgrenzen abzurücken. Damit wird zum einen gewährleistet, dass dem Unterhaltungsdienst für die Vegetationskontrolle entsprechend Platz zur Verfügung steht, um eine Pflege durchzuführen, zum anderen eine maschinelle Pflege vom Fahrzeug aus ermöglicht wird. Darüber hinaus wird die Erfassung und Dokumentation von Wildschutzzäunen im Bundesgebiet empfohlen.
Aktualisiert: 2023-05-18
> findR *

Heft 1143: Bestandsentwicklung von invasiven Pflanzen auf Verkehrsnebenflächen
– Eine Folgeuntersuchung auf ehemaligen Dauerversuchsflächen des BMDV
F. Molder N. Claßen, T. Gaar, K. Jidkova, B.Roger
240 S., 187 Abb., 86 Tab., ISBN 978-3-95606-680-1, 2022 € 27,00
In den 1980er Jahren hat das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) Dauerversuchsflächen an Bundesfernstraßen etabliert, um den Einfluss von Pflegemaßnahmen auf das Straßen-begleitgrün zu erforschen. In dem 2019 von der Bundesanstalt für Straßenwesen initiierten Projekt „Bestandsentwicklung von invasiven Pflanzen auf Verkehrsnebenflächen“ wurde eine Evaluierung der 17 Offenland-Untersuchungsstandorte durchgeführt. Die aktuelle Untersuchung zeigt den Status von Straßenbegleitflächen als Lebensraum invasiver Pflanzenarten auf. Der Vergleich mit den historischen
Daten lieferte u. a. Hinweise auf ausbreitungsfördernde oder -hemmende Faktoren. Auf Grundlage der vegetationskundlichen Auswertungen und von Recherchen bei den zuständigen Betriebsdienststellen wurden Empfehlungen für Pflegemaßnahmen im Verkehrsbegleitgrün ausgearbeitet. Im Verkehrsbe-gleitgrün des bundesdeutschen Fernstraßennetzes wird in der Regel mit dem Schlegelmäher gemulcht, im straßennahen Intensivbereich pro Jahr oder gar nicht. Selbst im Intensivbereich wird damit überwiegend nur zweischürig gepflegt, oft mit einer größeren Pause über den Hoch- und Spätsommer. Auch im Extensivbereich findet der einmalige Schnitt vorwiegend erst im September oder Oktober statt. Gänzlich brachgefallene Flächen werden höchstens im mehrjährigen Abstand einer Gehölzkontrolle unterzogen.
Das gepflegte Straßenbegleitgrün zeigte einen stärkeren grünlandartigen Charakter und war überwiegend artenreicher ausgebildet als die Brachebereiche. Die Brachen wurden zudem oft von wenigen
Saum- oder Ruderalarten dominiert. Durch den Mulchschnitt und eine an die Trophie der Standorte oft nicht angepasste Häufigkeit und Datierung der Pflegeschnitte sind aber auch im gepflegten Straßen-begleitgrün relativ hohe Anteile an Ruderalarten bzw. Stickstoff-, Stör- und Brachezeigern enthalten.Das vorhandene Potential des Straßenbegleitgrüns für den Natur- und Artenschutz wird damit meist nur Un- zureichend genutzt. Die Anzahl der Neophytenarten ist im Untersuchungsverlauf deutlich angestiegen. Nach 8 Arten im Jahr 1984/85 stieg die Anzahl auf 19 Arten im Jahr 2019. Davon sind 7 Arten als invasiv eingestuft. Meist waren nicht mehr als 3 Neophytenarten je Standort vertreten. Die Neophyten bildeten in den im Rahmen des Projektes näher begutachteten Mulden- und Böschungszonen auch keine Dominanzen aus, in den Banketten zum Teil schon. In anderen Bereichen entlang des deutschen Fernstraßennetzes konnten auch in den Böschungen immer wieder dominante Neophytenbestände festgestellt werden. Dabei handelt es sich oft um Staudenknöteriche. Auf den Untersuchungsflächen war das Schmalblättrige Greiskraut (Senecio inaequidens) insgesamt der auffälligste Neophyt, da es mit Abstand an den meisten Standorten auftrat und auch erst nach 1999 in die Bestände eingewandert ist. Die Art tritt vorwiegend im Bankettbereich auf. Das Verbleiben des Schnittgutes auf den Flächen und die relativ großen Pflegeintervalle begünstigen generell nitrophytische Hochstauden. Die Narbenöffnungen im Zuge sporadischer Gehölzrückschnitte, Verbrachungen und speziell im Bankett-bereich z. B. durch Abschälen der Narbe fördern weiterhin Stör- und Pionierzeiger. Die oft als Hoch-stauden ruderaler Standorte einzustufenden Neophyten finden somit im entsprechend gepflegten Verkehrsbegleitgrün oftmals günstige Voraussetzungen. Für die zuständigen Betriebsdienststellen fehlen oft klare oder einheitliche Vorgaben zur Vorbeugung und Bekämpfung von Neophyten und anderen Problemarten. Die Bereitschaft zur Änderung der Pflege in Hinsicht auf die Reduzierung problematischer Arten und auch auf eine Erhöhung der Biodiversität ist bei vielen Dienststellen prinzipiell vorhanden. Jedoch wurde als Voraussetzung genannt, dass dies von den übergeordneten Stellen und der Politik entsprechend gefordert und gefördert werden müsste. Die Pflege des Begleitgrüns an Bundesfernstraßen soll die Gewährleistung der Verkehrsfunktion, einen vertretbaren Aufwand bei der Pflegedurchführung sowie die Berücksichtigung der Belange des Natur- und Arten-schutzes inklusive der Abwehr von schädlichen Entwicklungen (z. B. Neophyten) gleichermaßen berücksichtigen. Auf dieser Basis weiterentwickelte Empfehlungen für die Regelpflege sind • in Intensivbereichen:– zusätzlicher Schnitt in der Reifephase problematischer Arten, – Entfernung des Schnittgutes zumindest in Intervallen, – zeitnahe Sanierung von Stör- und Offenstellen; • in Extensivbereichen: – Differenzierung in grünlandartige Bereiche und Säume, – zweimalige Mahd der Grünlandbereiche mit Mindestschnitthöhen, bei Bedarf Verlagerung in die Reifephase problematischer Arten, – Pflege der Saumbereiche je nach Sukzessionsfortschritt in mehrjährigem Abstand, – Entfernung des Schnittgutes in Intervallen. Als Ergänzung zur Regelpflege werden Angaben zur Definition und Einordnung von Neophytenbeständen sowie Möglichkeiten der Prävention und Bekämpfung vorgeschlagen.
Aktualisiert: 2023-01-16
> findR *

Heft 1142: Das Potenzial von Verkehrsnebenflächen zur Förderung der Biodiversität und ihre Rolle bei der Ausbreitung gebietsfremder Arten
Andrea Schleicher, Klaus Albrecht, Kilian Dorbath, Hagen S. Fischer, Maren K. Höfers, Judith Kehl,
Gert Verheyen, Joachim Pfau, Ralf Baufeld, Peter Gropengießer, Hanna Kaldenbach, Michael Kleyer
unter Mitarbeit von: B. Bartsch, L. Bolte, J.Geier, L,Hudel, H. van’t Hull, K.Klibingat, M. Röder
182 S., 52 Abb., 25 Tab., ISBN 978-3-95606-674-0, 2022 € 23,50
Ziel des Projekts ist es, eine Bestandsaufnahme von vorherrschenden Biotoptypen, der Vegetation und ausgewählten Tiergruppen an den drei Verkehrsträgern Straße, Schiene und Wasserstraße zu erhalten. Es soll eine Grundlage geschaffen werden für 1. Die Optimierung von Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität unter den im Untersuchungsraum gegebenen Bedingungen, 2. eine verkehrsträgerüber-greifende Verbesserung der ökologischen Vernetzung an bzw. von Verkehrswegen und 3. die gezielte und kosteneffektive Kontrolle von Neobiota. Die Untersuchungen fanden im Naturraum der Börden statt, einer intensiv agrarisch genutzten Region mit sehr produktiven Löss-Schwarzerde-Böden. Die Biotoptypenkartierungen zeigen, dass der Untersuchungsraum von einer intensiven Landwirtschaft ge- prägt ist. Rund die Hälfte der Fläche sind Äcker. Verkehrswege außerhalb von Siedlungen nehmen 5,5% ein. Wälder, Gehölze des Offenlands und Röhrichte/Säume/Staudenfluren mit hohem Natur-schutzwert sind selten. Nur 10 % der Fläche kann einem gefährdeten Biotoptyp zugeordnet werden. Die Nebenflächen der Verkehrswege werden zu großen Teilen von naturnahen Gehölzen eingenommen. Dadurch wird auch die räumliche Vernetzung von Gehölzlebensräumen entlang der Verkehrswege deutlich verbessert. Der Lebensraumverbund von Trockenlebensräumen profitiert nur vom Begleitgrün der Schienenwege. Die Verbreitung von Neophyten hängt im Untersuchungsgebiet nicht deutlich mit dem Vorhandensein von Verkehrswegen zusammen. Die regelmäßige Pflege von Verkehrsneben- flächen ist vermutlich ausschlaggebend für die im Vergleich zu angrenzenden Flächen eher geringeren Deckung krautiger, invasiver Neophyten. Von den betrachteten Verkehrsträgern heben sich Schienenwege durch ein tendenziell stärkeres Auftreten von Neophyten ab. Dies scheint zumindest teilweise auf günstige Ausbreitungsbedingungen zurückzuführen sein, wie am Beispiel der Neo-phytenart Riesen-Goldrute (Solidago gigantea) gezeigt wurde. Die Vegetationsaufnahmen belegen, dass die Verkehrsnebenflächen des Untersuchungsraums eine besondere Bedeutung für nähr-stoffarme, magere Säume besitzen, die ausschließlich auf den anthropogen geschaffenen Standorten entlang von Verkehrswegen vorkommen. Die Artenzahl gleicher Vegetationseinheiten unterscheidet sich aber kaum zwischen Verkehrsnebenflächen und umgebender Landschaft. Besonders hohe Artenzahlen wurde häufig entlang von Wasserstraßen, in Kreuzungssituationen und in der Umgebung von Naturschutzgebieten gefunden. Dies weist auf die Bedeutung großflächiger Böschungen in ver-schiedenen Expositionen hin. Die erhöhten Artenzahlen in der Nähe von Naturschutzgebieten belegen die Bedeutung der Vernetzung mit geeigneten Biotopen. Die geringen Unterschiede in der Artenzusammensetzung intensiv und extensiv gepflegter Bereiche der Verkehrsnebenflächen lassen darauf schließen, dass nicht die Pflegeintensität, sondern andere Faktoren, wie standörtliche Unterschiede, die lokale Artenzusammensetzung bestimmen. Bei den faunistischen Erfassungen wurden bei allen Tiergruppen (Vögel, Reptilien, Amphibien, Tagfalter, Laufkäfer und Spinnen) nur wenige gefährdete oder besonders geschützte Arten nachgewiesen. Für einige spielt das Verkehrsbegleitgrün eine wichtige Rolle. Die an den Verkehrswegen gepflanzten Hecken und Gehölze erfüllen wichtige Lebensraumfunktionen für an Hecken gebundene Vogelarten. Bei den Tagfaltern wurden an den Verkehrswegen höhere Artenzahlen und auch mehr gefährdete Arten festgestellt, was vermutlich auf die strukturelle Anreicherung der Hildesheimer Börde durch die Böschungen an Verkehrswegen zurückzuführen ist. Die Waldeidechse zeigt an Schienenwegen höhere Individuen-zahlen als an anderen Verkehrswegen oder in der freien Landschaft. Für andere Artengruppen stellen die Verkehrswege dagegen eine Minderung der Habitatqualität dar. So wurden bei den Feldbrütern in der Nähe von Verkehrswegen geringere Artenzahlen und Brutpaardichten festgestellt als fernab. Bei den Bodenspinnen und Laufkäfern wurden an den Verkehrswegen reduzierte Arten- und Individuenzah-
len festgestellt, möglicherweise bedingt durch Unterschiede in der Habitatausstattung. Neozoen wurden im Rahmen dieser Studie nur vereinzelt beobachtet. Der naturschutzfachliche Wert der Verkehrs-nebenflächen in der Hildesheimer Börde wird demnach bedingt durch die Erhöhung der Anteile und der Vernetzung naturschutzfachlich bedeutsamer Gehölze und die Ergänzung des naturräumlichen Inventars um nährstoffarme, teils wärmebegünstigte Lebensräume. Vor allem in Bereichen besonderer Standortgunst (Flächengröße, Exposition) und in räumlicher Vernetzung mit naturschutzfachlich bedeut-samen Spenderflächen bestehen besondere Potenziale zur Förderung der Biodiversität, die bereits bei
Planung und Anlage (Bodenarbeiten) berücksichtigt werden sollten. Zielgerichtete Pflegemaßnahmen,
wie ein späterer Erstschnitt und Abfuhr des Mahdguts, können auf geeigneten Standorten zusätzlich
dazu beitragen, das naturschutzfachliche Potenzial besser auszuschöpfen.
Aktualisiert: 2023-01-16
Autor:
Klaus Albrecht,
B. Bartsch,
Ralf Baufeld,
L. Bolte,
Kilian Dorbath,
Hagen S. Fischer,
J. Geier,
Peter Gropengießer,
Maren K. Höfers,
I. Hudel,
Hanna Kaldenbach,
Judith Kehl,
Michael Kleyer,
K. Klibingat,
Joachim Pfau,
M. Röder,
Andrea Schleicher,
H. van't Hull,
Gert Verheyen
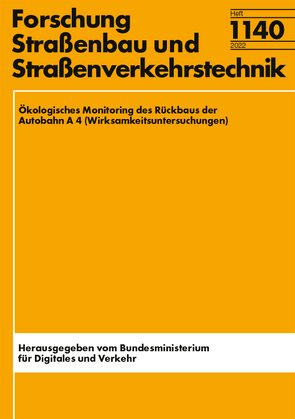
Heft 1140: Frank Hellwig, Dietrich Berger, Elisabeth Müller, Thomas Rohde, Stefan Halle, Jan Esefeld,
Gottfried Jetschke, Günter Köhler, Hans-Ulrich Peter, Winfried Voigt, Anika Rößler, Christoph Scheibert, Michael Franz, Martin Biedermann, Inken Karst, Wigbert Schorcht, Friedhelm Petzke:
Ökologisches Monitoring des Rückbaus der Autobahn A 4 (Wirksamkeitsuntersuchungen)
188 S., 137 Abb., 41 Tab., ISBN 978-3-95606-641-2, 2022 € 23,50
Die Aufhebung von Barrierewirkung und Habitatfragmentierungen sowie immissionsbedingter und sonstiger Randeffekte auf die angrenzenden Ökosysteme infolge des Rückbaus der Bundesautobahn 4 im Leutratal bei Jena wurden untersucht. Die quantitative Datenaufnahme (Staubimmission, Bodenwerte, Vegetation, Käfer (Coleoptera), Heuschrecken (Orthoptera), Gehäuseschnecken (Gastropoda), Brutvögel, Fledermäuse und andere Säuger) erfolgte transekt- oder biotopbezogen vor (2012/13) und nach (2016/17) Autobahnrückbau. Während die Bodenwerte keine messbaren Unterschiede vor und nach Rückbau zeigten, war die Staubemission stark reduziert. Die Vegetation veränderte sich nicht systematisch über den Untersuchungszeitraum. Aktivitätsdichten, Artenzahlen, Artdiversität und funktionale Diversität der Insekten veränderten sich deutlich. Quantitative Artenkompositionen der Insekten und Schnecken unterschieden sich signifikant und sequenziell zwischen den Untersuchungsjahren. Die Aktivitätsdichte der Brutvögel nahm deutlich zu, vorher bestehende distanzbezogene Gradienten verringerten sich. Die meisten Fledermausarten zeigten nach Autobahnrückbau erhöhte Aktivitäten in Trassennähe sowie eine Nutzung auch des tieferliegenden Luftraumes direkt über der ehemaligen Fahrbahn. Wildverbiss, Wildspuren und Snowtracking ergaben eine erhöhte Aktivitätsdichte größerer Säugetiere im gesamten Gebiet nahe sowie häufige Wildwechsel auch über die ehemalige Fahrbahn. Die Ergebnisse sind als Tendenzen zu werten. Die Komplexität der biotischen Daten sowie die stochastische Entwicklung der Umweltbedingungen (z. B. des jährlichen Witterungsverlaufs) erlauben keine statistisch gesicherte kausale Erklärung der Ergebnisse als alleinige Folge des Autobahnrückbaus.
Aktualisiert: 2023-01-16
Autor:
Dietrich Berger,
Martin Biedermann,
Jan Esefeld,
Michael Franz,
Stefan Halle,
Frank Hellwig,
Gottfried Jetschke,
Inken Karst,
Gottfried Köhler,
Elisabeth Müller,
Hans-Ulrich Peter,
Friedhelm Petzke,
Thomas Rohde,
Anika Rößler,
Christoph Scheibert,
Wigbert Schorcht,
Winfried Voigt

Heft 1141: Frank Weise, Matthias Fladt, Ivo Meyer
Bewertung der Innenhydrophobierung von Fahrbahndeckenbetonen als neuartige AKR-Vermeidungsstrategie
284 S., 82 Abb., 31 Tab., ISBN 978-3-95606-643-6, 2022 € 29,50
Zur Nutzbarmachung grenzwertig alkaliempfindlicher Gesteinskörnungen für Betonfahrbahndecken wurde basierend auf einer Literaturrecherche die Eignung von je einem Innenhydrophobierungsmittel auf der Basis eines Kalziumstearats (HM-A), eines Silan-Siloxan-Gemisches (HM-B) sowie eines der Vertraulichkeit unterliegenden Wirkstoffs (HM-C) für die neuartige AKR-Vermeidungsstrategie untersucht. Die Basis für die Eignungsuntersuchungen bildeten die Rezepturen im ARS 04/2013 für den OB (D>8)/UB sowie für den OB 0/8. Zur Herausarbeitung des Einflusses des Hydrophobierungsmittels auf die schädigende AKR fand in der groben Kornfraktionen ein alkaliempfindlicher Grauwackesplitt Anwendung. Aufgrund der unterschiedlichen Wechselwirkung zwischen dem LP-Bildner und dem Hydrophobierungsmittel wurde seine Dosierung beim HM-A reduziert sowie beim HM-B geringfügig und beim HM-C um ein Vielfaches erhöht. Ausgehend von den ausgewählten Rezepturen mit den unterschiedlichen Hydrophobierungsmitteln wurden bei den Untersuchungen u. a. folgende Erkenntnisse gewonnen: • Nachweis der Funktionalität aller drei Hydrophobierungsmittel im Festbeton durch signifikant reduzierte kapillare Aufnahme der Prüflösung. • Verschlechterung der mechanischen Eigenschaften und des Frost-Tausalzwiderstands des OB (D>8)/UB bei Zugabe aller Hydrophobierungsmittel. • Verzicht auf den Einsatz des HM-A im OB (D>8)/ UB aufgrund drastischer Verschlechterung der Verarbeitbarkeit des Frischbetons und hohem Festigkeitsverlust. • Verzicht auf den Einsatz des HM-B im OB (D>8)/ UB aufgrund der Überschreitung des Dehnungsgrenzwerts nach dem 9. bzw. 10. Zyklus (mit bzw. ohne zyklischer Vorschädigung) und der einhergehenden starken Abwitterung bei der KWL mit NaCl-Lösung. • Nachweis nachhaltiger Verminderung schädigender AKR in beiden Betonarten mit HM-C in Klimawechsellagerung und 60°C-Betonversuch mit externer Alkalizufuhr, allerdings zu Lasten der mechanischen Eigenschaften und des Frost-Tausalz-Widerstands. Fazit: Bei geeigneter Wirkstoffauswahl hat die Innenhydrophobierung das Potenzial für die Nutzbarmachung grenzwertiger Gesteinskörnung. Ihre Überführung in die Praxis erfordert jedoch eine weitere ganzheitliche Optimierung der Baustoffperformance. Das schließt auch die Verifizierung gezielter betontechnologischer Maßnahmen zur Verminderung der Verschlechterung der mechanischen Eigenschaften und des Frost-Tausalz-Widerstandes ein.
Aktualisiert: 2023-01-16
> findR *

Straßenseitenräume stellen einerseits für viele Tierarten wertvolle und gut vernetzte Habitate dar. Andererseits bedingen die Verkehrswege Verluste durch Kollisionen, Schadstoffimmissionen und Lärm. Dabei ist meist unklar, ob positive oder negative Wirkungen überwiegen, und ob sie die gesamte Population beeinflussen können. Überwiegen negative, populationsrelevante Wirkungen, könnten im Extremfall Individuen aus verkehrlich unbeeinflussten Habitaten an die Straße gelockt und damit die gesamte Population geschwächt werden. Ziel der vorliegenden Studie war es, die Relevanz einer solchen indirekten Fallenwirkung in Straßenseitenräumen zu untersuchen und gegebenenfalls erforderliche Minimierungsmöglichkeiten abzuleiten. Dazu wurden für die Arten Haselmaus, Mönchsgrasmücke und die Tagfalter Kleines Wiesenvögelchen und Hauhechelbläuling an einer Autobahn bzw. vielbefahrenen Straße über drei Jahre populationsökologische und teilweise genetische Untersuchungen durchgeführt. Für keine der Arten wurde eine indirekte Fallenwirkung in Straßenseitenräumen belegt. Im Hinblick auf die Haselmaus zeigte ein Vergleich der Dichten straßennaher und straßenferner Populationen, dass straßennahe Lebensräume im Vergleich zu straßenfernen höher- oder gleichwertig sein können. Die genetischen Untersuchungen belegten zudem, dass die Haselmauspopulationen in Straßenbegleitgehölzen vital sind und sie als Ausbreitungsachse nutzen. Bei der Mönchsgrasmücke waren die ermittelten Revierdichten und der Bruterfolg von straßennahen Populationen nicht generell geringer als von straßenfernen. Auch für die Tagfalter, speziell den Hauhechelbläuling, konnte gezeigt werden, dass straßennahe Populationen genetisch von den straßenfernen Populationen nicht unterschieden werden können. Auch die Populationsgrößen bzw. -dichten waren ähnlich, obwohl die adulten Tagfalter in Straßenseitenräumen vermutlich eine erhöhte Mortalitätsrate erlitten als in verkehrlich unbeeinflussten Habitaten. Diese wirkte sich jedoch nicht negativ auf die Populationen aus. Trotz verkehrsbedingter Beeinträchtigungen ist es folglich sinnvoll, in Straßenseitenräumen Maßnahmen zur Förderung der Artenvielfalt umzusetzen. Dabei spielen vor allem eine hohe Habitateignung, ausreichende Breite sowie eine möglichst gute Vernetzung eine wesentliche Rolle. Gleichwohl können sie aufgrund der vorhandenen Beeinträchtigungen nicht als adäquate Ersatzhabitate für ökologisch hochwertige Lebensräume gesehen werden.
Aktualisiert: 2023-05-04
> findR *
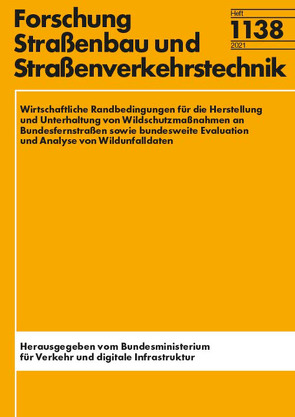
Die Zunahme der Straßennetzdichte, des Verkehrsaufkommens und der Motorisierung einerseits sowie die regional z. T. wachsende Wilddichte und die zunehmende Zerschneidung von Wildwechseln andererseits erhöhen das Risiko von Kollisionen zwischen Fahrzeugen und Tieren. Fahrzeuginsassen können entweder durch den direkten Aufprall mit dem Wildkörper oder durch Ausweichmanöver verletzt oder gar getötet werden und es entstehen oft hohe Sachschäden. Auf der anderen Seite gefährdet die Straßenverkehrsinfrastruktur und deren Betrieb Tiervorkommen auf verschiedene Weise, z. B. aufgrund erheblicher Barrierewirkungen oder aufgrund hoher Tierverluste. Das Forschungsprojekt leistet zwei Beiträge zum Themenkomplex Wildunfälle. Zum einen wurde eine Methode zur Identifizierung von Wildunfallhäufungsabschnitten entwickelt und diese bei gegebener Datengrundlage bundesweit angewandt (I.). Zum andern erfolgte eine Übersicht und Bewertung der bundesweit eingesetzten Wildschutzzaunsysteme, um Vorschläge zur Verbesserung abzuleiten (II.). I. Für den Zeitraum von 2012-2017 wurden bundesweit Wildunfalldaten abgefragt. Der Rücklauf ergab mehr als 800.000 Wildunfalldaten, die geografisch verortet und mithilfe von GIS-Programmen analysiert werden konnten. Die meisten Bundesländer sowie das Tierfund-Kataster Deutschland stellten auswertbare Daten zur Verfügung. Im Rahmen der Auswertung konnten dann 30.393 Wildunfallstrecken für den Zeitraum von 2012 bis 2017 ermittelt werden, die das Kriterium von mindestens 6 Unfällen mit einem maximalen Abstand von 200 m zwischen zwei Wildunfallpunkten erfüllen. Diese Wildunfallstrecken bilden 56,6 % aller gemeldeten Wildunfälle ab. Betroffen sind davon aber nur 4 % des Straßennetzes (29.580 km von 738.145 km). Auf 11.912 Streckenabschnitten liegt die Wildunfalldichte oberhalb von 15 Wildunfälle/ km. Wildunfallstrecken mit > 15 Wildunfällen werden als Wildunfallhäufungsabschnitte definiert. Die wichtigsten Wildunfallhäufungsabschnitte können durch das Projekt für einen Großteil der Bundesländer bzw. deren Landkreise nunmehr lagegenau dargestellt werden. Hier sollten Vermeidungsmaßnahmen prioritär durchgeführt werden. Für die Gebietskörperschaften, wie z. B. Landkreise oder Gemeinden, ohne geeignete Datengrundlagen sollte das Meldesystem möglichst schnell verbessert werden. Wildunfallstrecken mit hoher Stetigkeit, d. h. mit signifikanter Ereigniskontinuität, müssen noch ermittelt werden. Weitere Empfehlungen zum Umgang mit Wildunfällen sind: 1. Die Entwicklung eines bundesweit einheitlich anwendbaren und gut auswertbaren Meldeverfahrens, mit dem Wildunfallhäufungsabschnitte verschiedener Intensitätsstufen fortlaufend ermittelt werden können. Für ein solches Meldeund Auswertesystem sind qualitative Mindestanforderungen an die Meldungen abzustimmen und es beinhaltet die Bereitstellung von Auswertungsroutinen zur gewichteten Ermittlung von Wildunfallhäufungsabschnitten. Dazu sollten die Datenschnittstellen der einzelnen Unfallerfassungsprogramme der Bundesländer vereinheitlicht werden und Folgendes bereitstellen: a. Module zum Export einheitlicher Geodaten, b. Zugang zu anonymisierten Unfallhergangsbeschreibungen, um die verursachenden Tierzarten zu ermitteln (alternativ: Nennung der unfallverursachenden Tierarten). 2. Langfristig sollte das Straßenverkehrsunfallstatistikgesetz (StVUnfStatG) dahingehend geändert werden, dass alle Unfälle an das Statistische Bundesamt übermittelt werden. 3. Die landschaftlichen und straßenraumbezogenen Merkmale (Charakteristika), die die Herausbildung von Wildunfallhäufungen begünstigen, sollten auf Basis der Wildunfallhäufungsabschnitte für eine gezieltere Prävention ermittelt werden. II. Die Anwendung von Wildschutzzäunen in Deutschland erfolgt nach den Wildschutzzaunrichtlinien (WSchuZR), die zuletzt 1985 novelliert wurden. Im Zuge neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse und veränderter Rahmenbedingungen werden die Regelungen in den WSchuZR jedoch in vielen Belangen nicht mehr den aktuellen Verhält¬nissen gerecht. Dies zeigt sich z. B. an den flächendeckend angestiegenen Wilddichten in Deutschland, die mittlerweile die in den WSchuZR zugrunde gelegten Dichten für einen Handlungsbedarf erheblich übertreffen, sowie in der unzureichenden Pflege von Wildschutzzäunen und im Artenschutz, die in den WSchuZR bisher nicht berücksichtigt werden. Die Befragung von Zuständigen des Unterhaltungsdienstes für Bundesfernstraßen in zehn Regionen führte zum Ergebnis, dass Wildschutzzäune gemäß den WSchuZR mit Stacheldraht als Untergrabschutz die Verkehrssicherheit nicht gewährleisten können, da Wildtiere davon nicht genügend aufgehalten werden. Dies wird durch regelmäßig auftretende Wildunfälle unterstrichen, die sich innerhalb von gezäunten Straßenabschnitten ereignen. In einem zweiten Schritt wurden Ideen für einen modularen Wildschutzzaun aufgezeigt, der einen flächigen Einsatz in Deutschland ermöglicht. Das System sollte aus Maschendrahtgeflecht bestehen und kann z. B. bei nachträglicher Zuwanderung streng geschützter Arten wie der Wildkatze modular mit einem Überkletterschutz erweitert werden. Ein standardmäßig integrierter Untergrabschutz verhindert das Unterwühlen bzw. Anheben des Zauns und ermöglicht gleichzeitig eine praktikable Pflege der Vegetation. Wichtige Empfehlungen für die Zukunft sind daher Wildschutzzäune grundsätzlich mit funktionalem Untergrabschutz auszustatten und die Zäune von den Grundstücksgrenzen abzurücken. Damit wird zum einen gewährleistet, dass dem Unterhaltungsdienst für die Vegetationskontrolle entsprechend Platz zur Verfügung steht, um eine Pflege durchzuführen, zum anderen eine maschinelle Pflege vom Fahrzeug aus ermöglicht wird. Darüber hinaus wird die Erfassung und Dokumentation von Wildschutzzäunen im Bundesgebiet empfohlen.
Aktualisiert: 2023-01-16
> findR *

Heft 1137: U.Schulte:
Methoden der Baufeldfreimachung in Reptilienhabitaten, Landhabitaten von Amphibien und Habitaten der Haselmaus
172 S., 83 Abb., 24 Tab., ISBN 978-3-95606-586-6, 2021 € 22,50
Strukturreiche Böschungs- und Saumbereiche entlang von Verkehrsstraßen stellen wertvolle Sekundär-Lebensräume und Verbindungskorridore für Reptilien, aber auch Amphibien und die Haselmaus dar. Aufgrund des Fluchtverhaltens und der fehlenden Möglichkeit einer mechanischen Vergrämung besteht bei vielen Baumaßnahmen (Straßenneubau und -ausbau, Lärmschutzwände, Brückenbauwerke, Rastanlagen) ein erhöhtes Risiko der Tötung von Individuen. Für die zur Vermeidung von Tötungen angewandten Maßnahmen fehlen Standardisierungen und die für die Einschätzung ihrer Wirksamkeit notwendigen Erfahrungen und Belege weitestgehend. Zudem bestehen Unsicherheiten hinsichtlich der Signifikanzschwelle des individuenbezogenen baubedingten Tötungsrisikos. Über eine Auswertung von Projekten im Straßen- und Bahnbau, eine Expertenbefragung sowie eine umfangreiche Literaturrecherche wird in diesem FE a) ein Überblick zu den derzeit in der Praxis angewandten Methoden gegeben, b) die Wirksamkeit der Methoden artspezifisch beurteilt und c) das tatsächliche Tötungs- und Verletzungsrisiko der Arten abgeschätzt. Im Ergebnis zeigen sich große Unterschiede zwischen den betrachteten Arten(-gruppen). Für die Haselmaus existieren konkrete Empfehlungen zur Vergrämung mit oder ohne Abfang, die auch weitestgehend einheitlich angewandt wurden. Die Schutzmaßnahmen für Amphibien dienen primär der Baufeldsicherung. Befinden sich Amphibien innerhalb eines Baufeldes, ist ein Abfang in Verbindung mit oder ohne Verlagerung von Laichgewässern und Umsetzung oder Umsiedlung zwingend notwendig. Während bei Amphibien und Haselmaus ein zumindest zur Abwendung des Tötungsverbotes wirksames Methodenspektrum angewandt wird, bestehen bei Reptilien große Unsicherheiten bezüglich Vorgehensweise und Wirksamkeit von Maßnahmen (vor allem bei der Vergrämung durch Mahd oder das Auslegen von Folie). Generell lässt sich nicht jedes Bauvorhaben mit dem Schutz der Arten vereinbaren. Prioritär gilt es alle Möglichkeiten der Vermeidung („Vermeidungsgebot“ nach § 15 Abs. 1 BNat SchG) unter genauer Prüfung zumutbarer Alternativen auszuschöpfen. Ist eine komplette Vermeidung des Eingriffs nicht zumutbar, sollte der Eingriff dennoch so gering wie möglich ausfallen. Vorrangiges Ziel muss der Erhalt der betroffenen Population im angestammten Lebensraum sein. Sensible Kernbereiche der Lebensräume sollten von der Planung ausgenommen werden (Tabuzonen), sodass ein in-situ Erhalt der Population möglich ist und eine Umsetzung mit oder ohne Vergrämung in an das Baufeld angrenzende optimierte Bereiche erfolgen kann. Im Sinne eines vorausschauenden Artenschutzes empfiehlt es sich Korridore zu bestehenden Lebensräumen im Umfeld von Verkehrswegen zu entwickeln, bzw. zu fördern, die bei zukünftigen Baumaßnahmen als Kompensationsflächen verfügbar wären. Eine Zwischenhälterung kann nur erwogen werden, wenn das Baufeld nur temporär beansprucht wird und wieder rekolonisiert werden kann. Aufgrund einer Vielzahl an Unsicherheiten und Wissenslücken sollten Umsiedlungen von Reptilien nur in seltenen und stets sehr gut zu begründenden Ausnahmefällen durchgeführt werden. Hinsichtlich der Signifikanzschwelle des streng individuenbezogenen Tötungsrisikos ist nicht die Anzahl der Individuen, sondern die Wahrscheinlichkeit einer Schädigung dieser Individuen durch eine Baumaßnahme entscheidend für die Beurteilung der Signifikanz. Diese durch die Baumaßnahme prognostizierte Wahrscheinlichkeit der Schädigung muss die Wahrscheinlichkeit einer Schädigung aufgrund allgemeiner Lebensrisiken signifikant übersteigen. Maßgeblich für die Beurteilung, ob das Tötungsrisiko signifikant erhöht ist, sind einerseits die artspezifischen Verhaltensweisen, die Häufigkeit der Präsenz im Baufeld sowie die Wirksamkeit vorgesehener Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen. In diesem FE wurde das baubedingte Tötungsrisiko und dessen möglicherweise signifikante Erhöhung gegenüber den natürlichen Lebensrisiken von Individuen anhand von Literaturdaten zu natürlichen Mortalitätsraten, Life-history-traits, artspezifischen Verhaltensparametern sowie der allgemeinen Mortalitätsgefährdung der Art skaliert. Die individuenspezifische Festlegung des Tötungsverbotes hat in der Planungspraxis dazu geführt, dass Maßnahmen primär auf ein Vermeiden des Tötungsverbotes durch Evakuierungen von Individuen aus dem Baufeld abzielen. Da es aber nicht möglich ist, aller Individuen in einem Baufeld habhaft zu werden, wäre es aus naturschutzfachlicher Sicht ehrlicher und zielführender Vermeidungs- und anschließende Artenschutz-4 Maßnahmen stärker als bisher populationsbezogen anzuwenden. Demnach ginge es zwar weiterhin um die Ausschaltung der Gefahr einer systematischen Tötung von Individuen, aber im Sinne einer Ausschaltung der Gefahr für einen populationsrelevanten Anteil an Individuen. Das Ziel und die eigentliche Herausforderung sollte die langfristige Sicherung der Überlebensfähigkeit und des Erhaltungszustandes der betroffenen Population sein. Nach einer Übersicht zum Themenkomplex der Vermeidungs- und Schutzmaßnahmen, der Gesetzeslage und der Möglichkeit das baubedingte Mortalitätsrisiko einzelfallspezifisch einzuschätzen, finden sich im Anhang des Berichtes als zusammenfassendes Ergebnis zur Praxisanwendung Artsteckbriefe u. a. mit Angaben zu Methoden zur Bestandserfassung, zu Fangmethoden sowie zu Methoden der Baufeldfreimachung mit Priorisierung und Einschätzung der Eignung.
Aktualisiert: 2022-03-21
> findR *
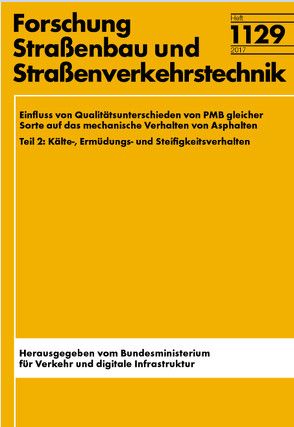
BASt Heft 1029: Einfluss von Qualitätsunterschieden PMB gleicher Sorte auf das mechanische Ver-halten von Asphalten – Teil 2: Kälte-, Ermüdungs- und Steifigkeitsverhalten
M. Hase, C. Oelkers, K. Schindler, A. Schröter, K. Zumsande
112 S., 227 Abb., 59 Tab., 978-3-95606-330-5, inkl. USB-Karte, 2017, EUR 19,00
Ziel dieses Forschungsvorhabens war es herauszufinden, ob sich unterschiedliches rheologisches Stoffverhalten verschiedener polymermodifizierter Bindemittel gleicher Sorte auf das Kälte-, Ermü-dungs- und Steifigkeitsverhalten auswirkt. Mit dieser Kenntnis können Anforderungswerte für Bin-demittel hinsichtlich rheologischer Bindemittelkenndaten empfohlen bzw. als Vertragsbestandteil in Funktionsbauverträgen oder Leistungsverzeichnissen aufgenommen werden.
Für die Untersuchungen wurden drei Bitumensorten (25/55-55 A, 10/40-65 A, 40/100-65 A) von jeweils vier verschiedenen Herstellern verwendet. Es wurden zwei Asphaltdeckschichtvarianten (AC 11 D S, SMA 11 S) und eine Asphaltbinderschichtvariante (AC 16 B S) mit jeweils zwei verschiedenen Verdichtungsgradniveaus untersucht.
Die Ergebnisse der Untersuchungen zur Ansprache der Bindemitteleigenschaften belegen, dass signi-fikante Unterschiede in technischen Eigenschaften von Bitumen gleicher Sorte und unterschiedlicher Hersteller in 74 % der untersuchten Fälle vorhanden sind.
Es konnten für die untersuchten Bitumensorten Anforderungswerte bzw. eine Anforderungsspanne an den Komplexen Schermodul, den Phasenwinkel sowie die Biegekriechsteifigkeit bei -25 °C zum Erreichen eines kälte- und ermüdungsbeständigen Asphaltes mit günstigem Steifigkeitsverhalten empfohlen werden.
Ferner wurden Asphalttragschichtvarianten (AC 22 T S) mit Bitumen der Sorte 25/55-55 A und 50/70 von je zwei Herstellern in analoger Weise untersucht.
Aus den rechnerischen Dimensionierungen mit Asphalttragschichtvarianten ging hervor, dass die Verwendung polymermodifizierter Bindemittel im Vergleich zum Einsatz von Straßenbaubitumen zu einem deutlich niedrigeren Ermüdungsstatus, verbunden mit einer höheren rechnerischen Nut-zungsdauer, führt.
Aktualisiert: 2023-01-16
> findR *
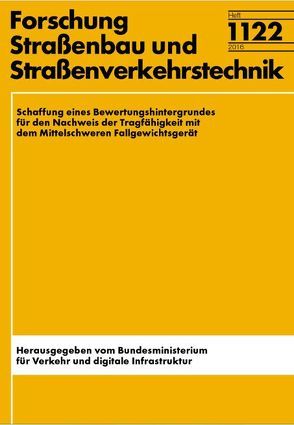
Für Tragschichten des Oberbaus sind nach ZTV SoB-StB 04 (2004) Anforderungswerte an die Tragfähigkeit im Bezug auf Ev2-Werte angegeben. Ziel der Arbeit war die Schaffung einer durch Versuche unter kontrollierten Randbedingungen gewonnenen Datenbasis, in denen der Zusammenhang des Ev2-Wertes zum Evd,M-Wert, welcher unter Verwendung des Mittelschweren Fallgewichtgerätes gemessen wird (TP Gestein StB, Teil 8.2.1), mithilfe statistischer Methoden interpretiert werden kann. Es wurden verschiedene Dicken der ungebundenen Tragschicht unter Verwendung des statischen und dynamischen Plattendruckversuchs mit dem Mittelschweren
Fallgewichtsgerat untersucht. Es wurden 4 verschiedene Materialien, die zu Tragschichten mit einer Dicke von 15 cm, 30 cm und 45 cm verdichtet wurden, geprüft (Rundkorngemisch, Kalkstein – gebrochen, Granit – gebrochen und RC-Beton). Das Planum bzw. die Unterlage (Forstschutzschicht) zu jedem Tragschichtaufbau bildete ein bindiger Feinsand (SU*) sowie ein Kies (GW).
Als Ergebnis wurde ein Vorschlag zu Anforderungswerten Evd,M geschaffen, mit denen die Werte Ev2 = 120 MN/m2, 150 MN/m2 und 180 MN/m2, mit einem Mittelschweren Fallgewichtsgerat nachgewiesen werden können. In Ergänzung dazu wurde ein bodendynamisches Modell geschaffen, welches alle wesentlichen Einflussgrößen der dynamischen Interaktion des Fallgewichtsgerätes mit dem Untergrund erfassen kann. Damit steht ein Werkzeug zur Verfügung, mit dem Messdaten aus Versuchen auf realen Tragschichten durch eine Modellbildung im Bezug auf bodendynamische Vorgange interpretiert werden können. Zudem wurden in Vergleichsversuchen am Kalibrierstand und unter Feldbedingungen geräte- bzw. herstellerspezifische Unterschiede dokumentiert. Diese konnten mit den Erkenntnissen aus einem zeitlich parallel laufenden Ringversuch vergleichen werden. Aus den Ergebnissen geht hervor, dass im Kalibrierstand nicht alle maßgebenden Effekte, die bei der Messung auf einem System Tragschicht auf Planum zu Tage treten, erfasst werden.
Es wird daher empfohlen, die gerätespezifischen Unterschiede in zukünftigen Forschungen weiter zu untersuchen sowie die Anforderungen zum Geräteaufbau zu konkretisieren.
Aktualisiert: 2023-01-16
> findR *
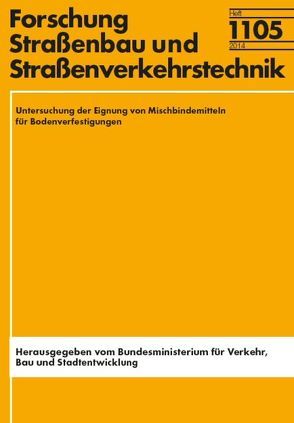
BASt Heft 1105: Untersuchung der Eignung von Mischbindemitteln für Bodenverfestigungen
K. J. Witt, J. Köditz, A. Damaschke
84 S., 9 Abb., 25 Tab., 30 z.T. farb. Prüfberichte und Diagramme im Anhang, ISBN 978-3-95606-065-6, 2014, EUR 17,00
Zur fachlichen Begründung einer Eignungsprüfung bei Bodenverfestigungen mit Mischbindemitteln wur-den 30 Boden-Bindemittel-Gemische nach den TP BF-StB Teil B 11.1 (2012) geprüft und ihre Verdicht-barkeit, Festigkeit und Frostbeständigkeit untersucht. Ultraschallmessungen lieferten zusätzliche Ergeb-nisse zur Festigkeitsentwicklung.
Als Grundlage für die Herstellung der Boden-Bindemittel-Gemische dienten 2 Böden (GU, TL), denen 5 Bindemittel (CL 90, MB 70/30, MB 50/50, MB 30/70, CEM I) in 3 Dosierungen (4, 7, 10 M.-%) beigemengt wurden.
Der Vergleich der mit Mischbindemitteln behandelten Proben und den Referenzproben mit reinem Baukalk (CL 90) bzw. reinem Zement (CEM I) zeigt:
- Mit Mischbindemitteln lassen sich die spezifischen Vorteile von Kalk und Zement koppeln. Die Böden sind besser verdichtbar, tragfähiger und frostbeständiger.
- Während beim Boden TL der Feinkornanteil die Wirkmechanismen des zugegebenen Kalkes fördert, ist beim Boden GU die Wirkung des Zementanteils im Bindemittel dominant.
- Die einaxiale Druckfestigkeit wird vom absoluten Zementanteil in den Böden GU und TL gesteuert.
- Die in den ZTV E-StB 09 (12.4.2.1) gesetzten Anforderungen für hydraulische Bindemittel (su_28d, ?L) werden nur bei der Behandlung des Bodens GU mit 10 M.-% MB 30/70 erfüllt.
- Die in den ZTV E-StB 09 (12.4.2.2) gesetzten Anforderungen für Baukalke (su_28dF) werden bei beiden Böden GU und TL durch Zugabe von 4, 7, 10 M.-% der Mischbindemittel MB 70/30, 50/50, 30/70 erfüllt.
- Über Ultraschallmessungen kann die Festigkeit der Boden-Bindemittel-Gemische zerstörungsfrei er-fasst und die weitere Entwicklung prognostiziert werden.
Aus den Ergebnissen konnte eine Empfehlung für den Eignungsnachweis bei Bodenverfestigungen mit Mischbindemitteln abgeleitet werden. Als Prüfverfahren scheinen geeignet: 1. Proctorversuch (DIN 18127) und 2. einaxialer Druckversuch (DIN 18136) nach Frostbeanspruchung.
Aktualisiert: 2023-01-16
> findR *
Im Zuge der Grunderneuerung der BAB A 30 zwischen km 67 und km 104 wurde im Bereich Osnabrück eine zweischichtige offenporige Deckschicht eingesetzt. Dabei kamen in zwei Bauabschnitten unterschiedliche Einbaukonzepte zum Einsatz. Ein Bauabschnitt wurde in Kompaktbauweise „Heiß in Heiß“ unter Verwendung eines Modulfertigers eingebaut, der zweite in herkömmlicher Bauweise „Heiß in Kalt“.
Aktualisiert: 2023-01-16
> findR *
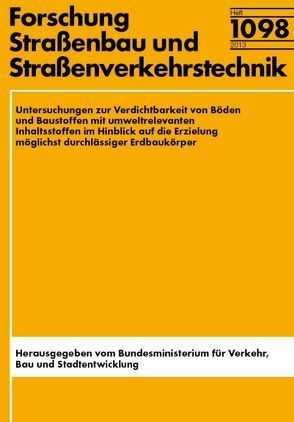
BASt 1098
Untersuchungen zur Verdichtbarkeit von Böden und Baustoffen mit umweltrelevanten Inhaltsstoffen im Hinblick auf die Erzielung möglichst gering durchlässiger Erdbaukörper
N. Vogt, D. Heyer, E. Birle, St. Stalter
72 S., 95 Abb., 17 Tab., ISBN 978-3-95606-033-5, 2013, EUR 16,50
Werden bei der Herstellung von Erdbauwerken Böden und Baustoffe mit umweltrelevanten Inhaltsstoffen verwendet, sind ab bestimmten Schadstoffbelastungen technische Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen, damit ein möglicher Austrag von Schadstoffen infolge Durchsickerung weitgehend verhindert werden kann. Eine besondere Form der technischen Sicherungsmaßnahme sieht vor, den Erdbaukörper aus diesen Böden und Baustoffen derart herzustellen, dass dieser selbst eine ausreichend geringe Durchlässigkeit aufweist. Bei der Beurteilung der Durchlässigkeitseigenschaften eines Erdbaukörpers ist in der Regel von ungesättigten Verhältnissen auszugehen. Für die numerische Simulation der hydraulischen Vorgänge im Erdbaukörper ist daher die Kenntnis der Bodenzustandsfunktionen der verwendeten Böden erforderlich.
Im Rahmen der vorliegenden Forschungsarbeit wurde zunächst untersucht, welche Anforderungen an Böden und Baustoffe mit umweltrelevanten Inhaltsstoffen hinsichtlich ihrer Zusammensetzung einzuhalten sind, damit diese prinzipiell für die Herstellung ausreichend gering durchlässiger Erdbaukörper geeignet sind. Dazu wurden neben einem organogenen Ton gemischtkörnige Kiese und Sande unter Variation des Feinkornanteils systematisch untersucht. Darauf aufbauend wurde das hydraulische Verhalten geeigneter Böden sowohl im gesättigten als auch im ungesättigten Zustand experimentell ermittelt. Schließlich wurden verschiedene gebräuchliche Pedo-Transfer-Funktionen dahingehend bewertet, inwiefern damit die Bodenzustandsfunktionen der untersuchten Böden aus den elementaren Bodeneigenschaften abgeleitet werden können.
Hinsichtlich der Herstellung ausreichend gering durchlässiger Erdbaukörper wurden anhand der Versuchsergebnisse für ausgewählte SU- und GU-Böden Anforderungen an die Einbaubedingungen in Bezug auf den Feinkornanteil in Verbindung mit dem Luftporenanteil formuliert. An verschiedenen verdichtet eingebauten SU- und GU-Böden wurden die Bodenzustandfunktionen experimentell bestimmt. Zur Abschätzung der im Labor aufwändig zu bestimmenden Saugspannungscharakteristik erwies sich für die betrachteten Böden die auf dem Gebiet der Geotechnik entwickelte Pedo-Transfer-Funktion nach Birle (2012) als besonders geeignet.
Aktualisiert: 2023-01-16
> findR *
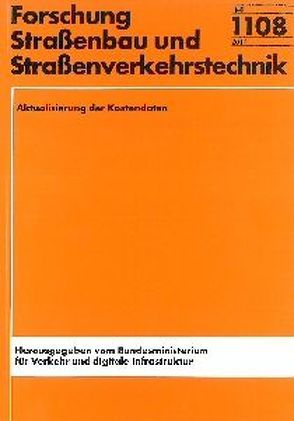
Heft 1108 Aktualisierung der Kostendaten
U. Zander, J. Birbaum
88 S., 36 z.T. farb. Abb., 44 Tab., ISBN 978-3-95606-112-7, 2014, EUR 17,50
Das vorliegende Forschungsprojekt „Aktualisierung der Kostendaten“ (FE 29.0196/2008/BASt) ist die Weiterführung des FE 09.127/2002/NGB. Ziel ist es, die hinterlegten Preise und funktionalen Zusammenhänge für die Kalkulation von Kosten im „Pavement Management System“ (kurz: PMS) mit dem €-Cost Programm zu aktualisieren und zu erweitern.
Im Zuge einer deutschlandweiten Erhebung wurden mittels Brief- und E-Mail Umfrage sowie persönlichen Gesprächen aktuelle Preise für Baustoffgemische des Straßenbaus (Gesteine, Asphalt und Beton) sowie die Kosten für die Verkehrssicherung an Baustellen ermittelt. Neben den bereits in €-Cost enthaltenen Mischgutsorten, wurden dabei auch neue Mischgüter abgefragt und die erhobenen Preise in das Programm integriert. Ließen sich bisher nur Maßnahmen mit Deckschichten aus Splittmastixasphalt kalkulieren, so kann jetzt zusätzlich aus Offenporigem Asphalt, Gussasphalt und Kompaktasphalt ausgewählt werden. Zudem ist es in der aktuellen Version von €-Cost möglich, neben der Asphalttragschicht auch eine ungebundene Tragschicht zu berücksichtigen.
Mittels Musterleistungsverzeichnissen wurden in einem weiteren Schritt Preise für Bauleistungen im Straßenbau und die anfallenden Kosten für die Baustelleneinrichtung bei verschiedenen Baufirmen abgefragt.
Für einige Bundesländer bzw. Regionen konnten dabei keine vollständigen Datensätze erhoben werden. Nach Auswertung der verfügbaren mengenabhängigen Preise konnte allerdings bei allen Mischgütern eine deutliche Tendenz bezüglich der Abhängigkeit des Stoffpreises von der Abnahmemenge festgestellt werden. Aufbauend auf diesen Daten wurde eine Kalibrierfunktion fN(M) erstellt. Diese hebt oder senkt durch multiplikative Verknüpfung den eigentlich nicht mengenabhängigen Stoffpreis für jede Re¬gion (SPregional) in Abhängigkeit von der angesetzten Masse/Menge.
Die Baustoffpreise sind zudem je nach Bundesland/Region stark unterschiedlich. Deshalb wurden aus den gewonnenen Daten Kostenfunktionen ermittelt, mit denen sich die voraussichtlichen Herstellkosten für Erhaltungsmaßnahmen der Asphalt- und Betonbauweise mengen- und regionsabhängig abschätzen lassen.
Für das Einrichten der Baustelle sowie die Verkehrssicherung wurden eigene Formelansätze abhängig von der Bauzeit und der Loslänge bestimmt.
Die Summe der Einzelkosten der Teilleistungen (SEKT) wird dann zusammen mit den Kosten für die Baustelleneinrichtung (BStK) und den Kosten für die Verkehrssicherung (VSK) sowie einem pauschalen Zuschlagsfaktor für das Wagnis und Gewinn (WuG) und den Allgemeinen Geschäftskosten (AGK) zu einer Angebotssumme aufsummiert.
Die ermittelten Kostenfunktionen und funktionalen Zusammenhänge wurden zu dem DV-Programm €-Cost 2010 zusammengefasst.
Aktualisiert: 2023-01-16
> findR *
Der 42. EAT hatte vier verschiedene Themen-Schwerpunkte, zum einen „Regelwerke und Normung“. Die Erfahrungsberichte gewährten Einblicke über neue Bauverfahren und Baustoffe. Ein weiteres Thema waren die Auswirkungen des Klimawandels auf die Straßeninfrastruktur. Den letzten Schwerpunkt bildeten die Bauverträge mit funktionalen Anforderungen.
Aktualisiert: 2023-01-16
> findR *
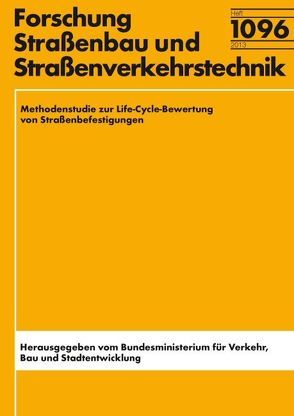
BASt 1096:
Methodenstudie zur Life-Cycle-Bewertung von Straßenbefestigungen
W. Ressel, K. Tejkl, Chr. Klöpfer
128 S., 67 z.T. farb. Abb., 36 Tab., ISBN 978-3-95606-031-1, 2013, EUR 20,00
Neue Bauvertragsformen, welche neben der Herstellung auch die Erhaltung beinhalten, erfordern zur Auswahl einer wirtschaftlich optimalen Bauweise die Betrachtung des gesamten Produktlebenszyklus. In der ersten Stufe des Forschungsprojekts wurden hierzu ausgehend von einer Literaturanalyse die methodischen Grundlagen einer Life-Cycle Bewertung von Straßenbefestigungen erarbeitet und ein konsensfähiges Bewertungsmodell aufgestellt. Dieses wurde in der der zweiten Stufe softwaretechnisch umgesetzt. Zentrales Element ist die langfristige Zustandsprognose zur Bestimmung von Art und Zeitpunkt notwendiger Erhaltungsmaßnahmen. Zur Anwendung kommen empirische Verhaltensfunktionen, basierend auf den Ergebnissen von Zustandserfassungen.
Das in der ersten Projektstufe entwickelte monetäre Bewertungsverfahren ermöglicht den deterministischen Bauweisenvergleich auf Grundlage der Baulastträgerkosten für Herstellung und Erhaltung sowie eines Restwertes. Zusätzlich werden für eine Bauweise auch gesamtwirtschaftliche Kosten der Straßennutzer und Allgemeinheit infolge maßnahmen- und zustandsbedingter Behinderungen ermittelt. In einer umfangreichen Sensitivitätsanalyse wurden Einflüsse verschiedener Parameter auf die Bewertung untersucht. Als Alternative wurde zudem ein nicht-monetäres Bewertungsverfahren, basierend auf dem prognostizierten Maßnahmenumfang für eine Bauweise entwickelt, im Späteren jedoch nicht weiterverfolgt. Beide Bewertungsverfahren wurden detailliert in Struktogrammen beschrieben und mit der Software „LCD – Life-Cycle Analyse an Straßenkonstruktionen in Deutschland“ zu Testzwecken umgesetzt.
In der zweiten Projektstufe erfolgte eine Überarbeitung des monetären Bewertungsverfahrens und die Umsetzung in der Software „LCD2“. Diese wurde im Hinblick auf die Unschärfe vieler Berechnungsparameter weitestgehend offen gestaltet, wodurch kontinuierliche Anpassungen möglich sind. Beispielhaft wurden für einige ausgewählte Fälle fiktive Bauweisenvergleiche durchgeführt.
Aktualisiert: 2023-01-16
> findR *

Im Rahmen dieses Projektes sollte anhand von Laborversuchen überprüft werden, in wiefern die Verwendung von Epoxydharz als Bindemittelzusatz und der damit entstehende Epoxy Asphalt einen Beitrag zur Entwicklung eines hochstandfesten und langlebigen Asphaltdeckschichtbelages liefern kann. Die Bearbeitung gliederte sich in drei Phasen. Die erste Phase beinhaltete grundlegende Untersuchungen mit unterschiedlichen Epoxydharzsystemen. Ziel dieser Versuche war die Identifizierung des Materialverhaltens im Asphaltmischgut, der dafür geeigneten Bedingungen sowie eine Bestimmung erster mechanischer Eigenschaften. In der zweiten Phase wurden mit dem in Phase I ausgewählten Epoxydharzsystem in unterschiedlichen Konzentrationen die wichtigsten Bindemittel- und Mischgutkennwerte von Epoxy Asphalt mit Hilfe von stan-dardisierten Prüfverfahren ermittelt und den Kennwerten von konventionellem Bindemittel bzw. Asphalt gegenübergestellt. In Phase III wurden zusätzlich die Reaktion des Epoxydharzes im Bitumen, die Extrahierbarkeit von Epoxy Asphalt, eine Bewitterung von Probekörpern sowie die Griffigkeitsentwicklung unter einer Verkehrsbelastung untersucht.
Aktualisiert: 2022-09-22
> findR *

Die erste Anwendung von EPS-Hartschaum als Leichtbaustoff in Deutschland erfolgte im März 1995. Nach den Untersuchungen in der Modellstraße der BASt mit EPS-Unterbau, die wesentliche Grundlage für das "Merkblatt für die Verwendung von EPS-Hartschaumstoffen beim Bau von Straßendämmen" waren, galt es, diese neue, aus dem Skandinavischen bekannte Bauweise in der Praxis zu erproben und Erfahrungen damit zu sammeln. Dazu wurde im Zuge der BAB A 31 bei Emden zwischen einem Schlafdeich und der Brücke über das "Larrelter Tief" eine Versuchsstrecke eingerichtet. Diese Stelle bot sich dafür an, weil trotz erfolgter Überschüttung des wenig tragfähigen Untergrundes im Laufe der Jahre mit einer Setzungsmulde zwischen den Bauwerken zu rechnen war. Durch den Einbau von EPS-Hartschaumblöcken in einer Dicke von 2,5 m wurde der Untergrund noch weiter entlastet und damit die Tiefe der Setzungsmulde verringert.
Im vorliegenden Bericht wird die Baumaßnahme von den ursprünglichen Planungen bis zur Entscheidung für den EPS-Einbau beschrieben. Dabei wird detailliert auf die umfangreichen Baugrunduntersuchungen vor und während der Bauausführung eingegangen. Durch die Überschüttung wurde eine deutliche Zunahme der undränierten Scherfestigkeit der holozänen Weichschichten erreicht. Die Ergebnisse der baubegleitenden Messungen (Setzungen, horizontale Verformungen und Porenwasserdruck) und die daraus abgeleiteten Folgerungen für die Gebrauchstauglichkeit der Straße werden beschrieben. Die stofflichen Eigenschaften von EPS-Hartschaum sind ebenfalls in dem Bericht zusammengestellt. Die rd. 1.000 m3 EPS-Blöcke wurden innerhalb einer Woche im März 1995 auf dem vorbereiteten Feinplanum verlegt und mit Feinsand überschüttet. Die vielfältigen Einbauerfahrungen und die Ergebnisse der Verdichtungs- und Tragfähigkeitsprüfungen an der Schüttung werden mitgeteilt. Vor der Verkehrsfreigabe wurde ein statischer Belastungsversuch mit einem Schwerfahrzeug der Bundeswehr auf der Binderschicht durchgeführt. Um eventuelle Veränderungen der Tragfähigkeit des Oberbaues aufzuzeigen, wurde zwischen 1995 und 1999 jährlich mit dem Falling Weight-Deflectometer (FWD) gemessen. Die letztmalig im Jahr 2003 durchgeführten Verformungsmessungen zeigen, dass die erwartete Setzungsverminderung im Bereich der Versuchsstrecke eingetreten ist.
Der Bericht enthält außerdem die Beschreibung der EPS-Anwendung im Zuge der Geh- und Radwegüberführung über die BAB A 31 bei Emden sowie ein Beispiel für ein Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung dieser Bauweise.
Aktualisiert: 2023-01-16
> findR *
Gemäß Erlass des BMVBW StB 26/38.56.05-10/20 Va 94 vom 02.05.1994 werden bei größeren Baumaßnahmen Bitumenproben entnommen und diese im Rahmen von Kontrollprüfungen unter-sucht. Die Ergebnisse der Bitumenkontrollprüfungen für die Jahre 2000 bis 2005 wurden von der Bundesanstalt für Straßenwesen gesammelt und statistisch ausgewertet. Die statistische Auswertung von Bitumenkontrollprüfungen hat die folgenden Ziele: Übersicht der im Straßenbau verwendeten Produkte, Gewinnung von Daten zur Beurteilung der Bitumen- und der Prüfqualität sowie die Identifizierung von Anomalien.
Aktualisiert: 2023-01-16
> findR *
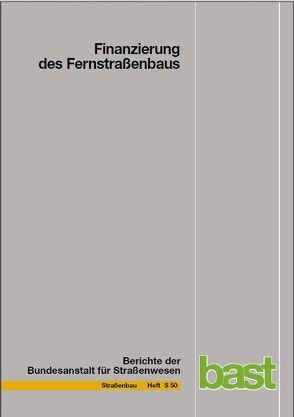
M. Sauthoff berichtet über bestehende Refinanzierungsmöglichkeiten für Aufwendungen zum Bau und zur Unterhaltung öffentlicher Straßen. B. Witting berichtet über die Erfahrungen mit öffentlicher privater Partnerschaft und unterschiedlichen Finanzierungsmodellen am Beispiel der Wamowquerung in Rostock, das als Pilotprojekt wichtige – positive wie negative – Erkenntnisse zu einer Fortführung der Finanzierung von Straßenbauprojekten nach dem FstrPrivFinG bietet. Der Beitrag von W. Maß zum Bau von Staatsstraßen in gemeindlicher Sonderbaulast beleuchtet die Schnittstelle von Straßen- und Haushaltsrecht am Beispiel des bayerischen Landesrechts und der hierzu ergangenen Rechtsprechung nebst Hinweisen auf Bundesrecht. Ein Beitrag über die vergaberechtlichen Probleme der Privatfinanzierung im Bau von Fernstraßen behandelt Probleme, die sich aus der Berührung der unterschiedlichen Rechtsgebiete des Straßenrechts, des Pri-vatisierungsrechts und des Vergaberechts ergeben.
Aktualisiert: 2023-01-16
> findR *
MEHR ANZEIGEN
Bücher zum Thema Straßenbau und Straßenverkehrstechnik
Sie suchen ein Buch über Straßenbau und Straßenverkehrstechnik? Bei Buch findr finden Sie eine große Auswahl Bücher zum
Thema Straßenbau und Straßenverkehrstechnik. Entdecken Sie neue Bücher oder Klassiker für Sie selbst oder zum Verschenken. Buch findr
hat zahlreiche Bücher zum Thema Straßenbau und Straßenverkehrstechnik im Sortiment. Nehmen Sie sich Zeit zum Stöbern und finden Sie das
passende Buch für Ihr Lesevergnügen. Stöbern Sie durch unser Angebot und finden Sie aus unserer großen Auswahl das
Buch, das Ihnen zusagt. Bei Buch findr finden Sie Romane, Ratgeber, wissenschaftliche und populärwissenschaftliche
Bücher uvm. Bestellen Sie Ihr Buch zum Thema Straßenbau und Straßenverkehrstechnik einfach online und lassen Sie es sich bequem nach
Hause schicken. Wir wünschen Ihnen schöne und entspannte Lesemomente mit Ihrem Buch.
Straßenbau und Straßenverkehrstechnik - Große Auswahl Bücher bei Buch findr
Bei uns finden Sie Bücher beliebter Autoren, Neuerscheinungen, Bestseller genauso wie alte Schätze. Bücher zum
Thema Straßenbau und Straßenverkehrstechnik, die Ihre Fantasie anregen und Bücher, die Sie weiterbilden und Ihnen wissenschaftliche
Fakten vermitteln. Ganz nach Ihrem Geschmack ist das passende Buch für Sie dabei. Finden Sie eine große Auswahl
Bücher verschiedenster Genres, Verlage, Autoren bei Buchfindr:
Sie haben viele Möglichkeiten bei Buch findr die passenden Bücher für Ihr Lesevergnügen zu entdecken. Nutzen Sie
unsere Suchfunktionen, um zu stöbern und für Sie interessante Bücher in den unterschiedlichen Genres und Kategorien
zu finden. Unter Straßenbau und Straßenverkehrstechnik und weitere Themen und Kategorien finden Sie schnell und einfach eine Auflistung
thematisch passender Bücher. Probieren Sie es aus, legen Sie jetzt los! Ihrem Lesevergnügen steht nichts im Wege.
Nutzen Sie die Vorteile Ihre Bücher online zu kaufen und bekommen Sie die bestellten Bücher schnell und bequem
zugestellt. Nehmen Sie sich die Zeit, online die Bücher Ihrer Wahl anzulesen, Buchempfehlungen und Rezensionen zu
studieren, Informationen zu Autoren zu lesen. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen das Team von Buchfindr.