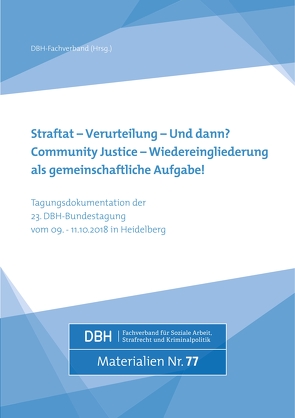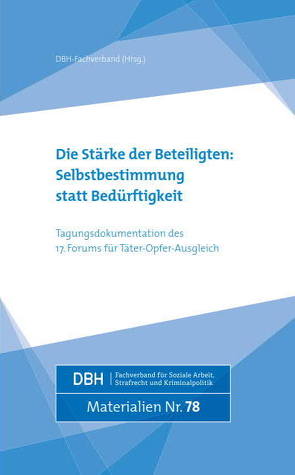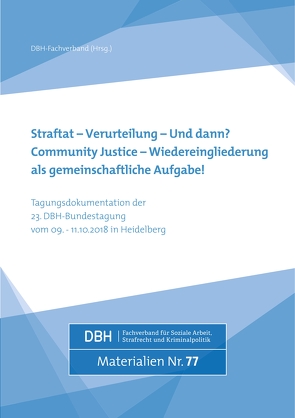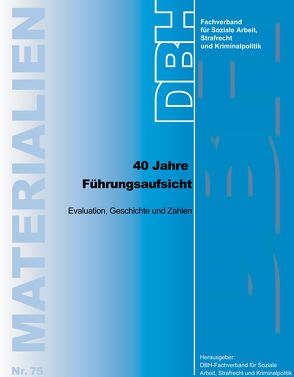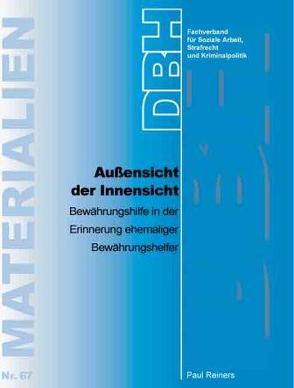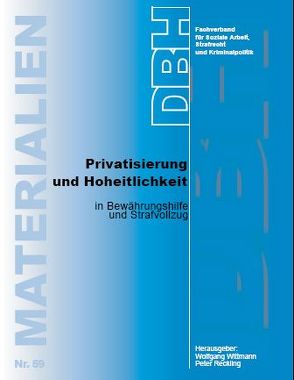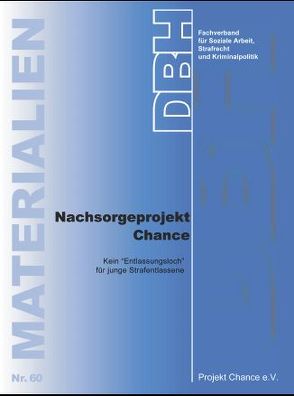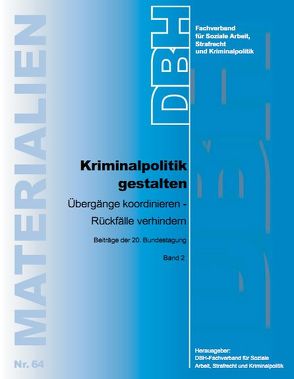Gibt es für die notwendige Transformation unserer Gesellschaft eine Theorie, die sozialen Frieden anstrebt und Menschenrechte in den Mittelpunkt stellt? Im vorliegenden Buch verdeutlicht Otmar Hagemann, der sich als Soziologe, Viktimologe und Kriminologe versteht, sein Konzept der heilenden Gerechtigkeit (Restorative Justice) gleichermaßen als Theorie, Paradigma und Philosophie auf dem Weg zu einer „Restorative Society“. Der Begriff stammt von deutschen Theologen, wird heute häufig als Alternative zur strafrechtlichen Konfliktbearbeitung oder als dritter Weg zwischen Strafe und Behandlung in modernen Gesellschaften verstanden, sollte aber möglichst als Konzept auf allen Ebenen aller Lebensbereiche angewendet werden, in denen problematische Situationen bestehen oder entstehen. Insofern können uns indigene Kulturen, die häufig nicht diesen Begriff benutzen, aber die damit gemeinten Werte und Prinzipien traditionell umsetzen, als Vorbild für nachhaltige, zukunftsweisende soziale Umgangsformen in Konfliktsituationen dienen. Der vorliegende Band bringt Ergebnisse der ca. 35-jährigen intensiven wissenschaftlichen Auseinandersetzung des Autors mit dem Thema Gerechtigkeit und sozialer Frieden ans Licht - insbesondere in Zusammenhang mit strafrechtlich relevanten Konflikten, aber auch darüber hinaus.
Das Buch richtet sich an Mediator:innen (in Strafsachen), Akteur:innen aus Rechtswissenschaften und Justizpraxis, Opfer- und Straffälligenhilfe, Polizei, Kriminologie/Viktimologie, Kriminalpolitik, Friedensbewegung, Schule, Kinder- und Jugendhilfe, Abolitionismus/Transformative Justice, Psycholog:innen, Seelsorger:innen, Lehrer:innen, Studierende und alle, die sich für eine Welt der Vielfalt, der Menschlichkeit, Gerechtigkeit und des sozialen Friedens interessieren und ggf. engagieren möchten.
Es erscheint in der neuen Publikationsreihe des Servicebüros für Täter-Opfer-Ausgleich und Konfliktschlichtung des DBH e. V., der bundesweiten Zentralstelle zur weiteren Etablierung der Konfliktvermittlung in Strafsachen: „Restorative Justice: Täter-Opfer-Ausgleich & Konfliktregelung“.
Aktualisiert: 2023-05-18
> findR *

Gibt es für die notwendige Transformation unserer Gesellschaft eine Theorie, die sozialen Frieden anstrebt und Menschenrechte in den Mittelpunkt stellt? Im vorliegenden Buch verdeutlicht Otmar Hagemann, der sich als Soziologe, Viktimologe und Kriminologe versteht, sein Konzept der heilenden Gerechtigkeit (Restorative Justice) gleichermaßen als Theorie, Paradigma und Philosophie auf dem Weg zu einer „Restorative Society“. Der Begriff stammt von deutschen Theologen, wird heute häufig als Alternative zur strafrechtlichen Konfliktbearbeitung oder als dritter Weg zwischen Strafe und Behandlung in modernen Gesellschaften verstanden, sollte aber möglichst als Konzept auf allen Ebenen aller Lebensbereiche angewendet werden, in denen problematische Situationen bestehen oder entstehen. Insofern können uns indigene Kulturen, die häufig nicht diesen Begriff benutzen, aber die damit gemeinten Werte und Prinzipien traditionell umsetzen, als Vorbild für nachhaltige, zukunftsweisende soziale Umgangsformen in Konfliktsituationen dienen. Der vorliegende Band bringt Ergebnisse der ca. 35-jährigen intensiven wissenschaftlichen Auseinandersetzung des Autors mit dem Thema Gerechtigkeit und sozialer Frieden ans Licht - insbesondere in Zusammenhang mit strafrechtlich relevanten Konflikten, aber auch darüber hinaus.
Das Buch richtet sich an Mediator:innen (in Strafsachen), Akteur:innen aus Rechtswissenschaften und Justizpraxis, Opfer- und Straffälligenhilfe, Polizei, Kriminologie/Viktimologie, Kriminalpolitik, Friedensbewegung, Schule, Kinder- und Jugendhilfe, Abolitionismus/Transformative Justice, Psycholog:innen, Seelsorger:innen, Lehrer:innen, Studierende und alle, die sich für eine Welt der Vielfalt, der Menschlichkeit, Gerechtigkeit und des sozialen Friedens interessieren und ggf. engagieren möchten.
Es erscheint in der neuen Publikationsreihe des Servicebüros für Täter-Opfer-Ausgleich und Konfliktschlichtung des DBH e. V., der bundesweiten Zentralstelle zur weiteren Etablierung der Konfliktvermittlung in Strafsachen: „Restorative Justice: Täter-Opfer-Ausgleich & Konfliktregelung“.
Aktualisiert: 2023-05-09
> findR *

Gibt es für die notwendige Transformation unserer Gesellschaft eine Theorie, die sozialen Frieden anstrebt und Menschenrechte in den Mittelpunkt stellt? Im vorliegenden Buch verdeutlicht Otmar Hagemann, der sich als Soziologe, Viktimologe und Kriminologe versteht, sein Konzept der heilenden Gerechtigkeit (Restorative Justice) gleichermaßen als Theorie, Paradigma und Philosophie auf dem Weg zu einer „Restorative Society“. Der Begriff stammt von deutschen Theologen, wird heute häufig als Alternative zur strafrechtlichen Konfliktbearbeitung oder als dritter Weg zwischen Strafe und Behandlung in modernen Gesellschaften verstanden, sollte aber möglichst als Konzept auf allen Ebenen aller Lebensbereiche angewendet werden, in denen problematische Situationen bestehen oder entstehen. Insofern können uns indigene Kulturen, die häufig nicht diesen Begriff benutzen, aber die damit gemeinten Werte und Prinzipien traditionell umsetzen, als Vorbild für nachhaltige, zukunftsweisende soziale Umgangsformen in Konfliktsituationen dienen. Der vorliegende Band bringt Ergebnisse der ca. 35-jährigen intensiven wissenschaftlichen Auseinandersetzung des Autors mit dem Thema Gerechtigkeit und sozialer Frieden ans Licht - insbesondere in Zusammenhang mit strafrechtlich relevanten Konflikten, aber auch darüber hinaus.
Das Buch richtet sich an Mediator:innen (in Strafsachen), Akteur:innen aus Rechtswissenschaften und Justizpraxis, Opfer- und Straffälligenhilfe, Polizei, Kriminologie/Viktimologie, Kriminalpolitik, Friedensbewegung, Schule, Kinder- und Jugendhilfe, Abolitionismus/Transformative Justice, Psycholog:innen, Seelsorger:innen, Lehrer:innen, Studierende und alle, die sich für eine Welt der Vielfalt, der Menschlichkeit, Gerechtigkeit und des sozialen Friedens interessieren und ggf. engagieren möchten.
Es erscheint in der neuen Publikationsreihe des Servicebüros für Täter-Opfer-Ausgleich und Konfliktschlichtung des DBH e. V., der bundesweiten Zentralstelle zur weiteren Etablierung der Konfliktvermittlung in Strafsachen: „Restorative Justice: Täter-Opfer-Ausgleich & Konfliktregelung“.
Aktualisiert: 2023-05-09
> findR *
Alternative Strafvollzugsmodelle aus der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft werden in diesem Band vorgestellt. Anlass ist der Rückblick auf 10 Jahre Strafvollzug in freien Formen in Sachsen.
Seehaus e.V. betreibt seit 2011 mit dem Seehaus Leipzig einen Jugendstrafvollzug in freien Formen. Sachsen ist das erste Bundesland in dem nun auch Strafvollzug in freien Formen für Erwachsene möglich sein wird. In Ergänzung dazu zeigen andere Träger mit ihren Konzepten weitere Alternativen zum Strafvollzug auf. Auch der Blick ins Ausland liefert hierzu Anregungen und Ideen. Einen Ausblick geben Wissenschaftler und Politiker zu ihrer Vision eines Justizsystem der Zukunft und von Restorative Justice als Zukunftsperspektive für das Justizsystem.
Aktualisiert: 2023-03-30
> findR *

Klient:innen der Bewährungshilfe, von Beratungsstellen und Wohneinrichtungen sind immer häufiger von psychischen Störungen und Erkrankungen belastet und die Angehörigen dieser Institutionen, die mit Straffälligen oder Haftentlassenen zu tun haben, sind besonderen Unsicherheiten und Herausforderungen ausgesetzt. Zugleich scheinen die Anforderungen an die Komplexität der Arbeitsweise mit psychisch erkrankten Klientel infolge neuerer fachlicher Entwicklung gestiegen zu sein. Mit dem Buch soll ein fachlicher Beitrag zur sachlichen Bewältigung der besonderen Anforderungen an das Personal in diesem Bereich geleistet werden.
Dazu werden die Wissensbestände zu Krankheitsbildern, unterschiedlichen Entstehungs-, Verlaufs- und Persistenzursachen, Möglichkeiten therapeutischer Behandlung, Psychodedukation, pädagogischen und rechtlichen Intervention aufbereitet. Es werden Empfehlungen dargestellt, wie und aufgrund welcher möglicher Situationen und Konstellationen psychisch kranke Probanden:innen spezifisch anders zu behandeln seien als gesunde.
Aktualisiert: 2022-02-22
> findR *
Wie können Betroffene von Straftaten Widerstandskräfte gegen
die Folgen der Opferwerdung entwickeln und bereits vorhandene Ressourcen nutzen, um ihre Selbstbestimmung zurückzuerlangen? Wie können Täter*innen aktiv Verantwortung für ihr Handeln übernehmen? Auf welche Ressourcen können sie zurückgreifen, um das Geschehene wiedergutzumachen und künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten führen zu können?
In der vorliegenden Dokumentation des 17. Forums für Täter-Opfer-Ausgleich geben Autor*innen aus Wissenschaft und Praxis auf diese Fragen Antworten. Berücksichtigt wird auch die Perspektive von Betroffenen, die solche Stärkungsprozesse selbst durchleben oder durchlebt haben. Außerdem beinhaltet das Buch Beiträge zu aktuellen Themen rund um Täter-Opfer-Ausgleich und Restorative Justice, die auf der Grundlage der Arbeitsgruppen sowie des Rahmenprogramms der Tagung entstanden sind.
Aktualisiert: 2021-08-30
> findR *
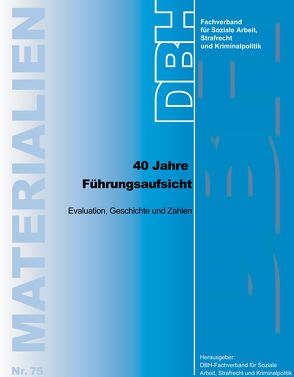
Vor 40 Jahren wurde die Führungsaufsicht als Sanktion im deutschen Strafrecht eingeführt. In diesem Band beschäftigen sich mehrere Autoren mit der Entwicklung der Führungsaufsicht und dem aktuellen Stand der systematischen Betrachtung der Anwendung dieses Instruments. Die Führungsaufsicht hat die frühere, von 1871 bis 1974 geltende Polizeiaufsicht abgelöst und wurde um ein betreuendes Element ergänzt/und ihre Funktion wurde durch die Hinzufügung eines betreuenden Elements ausgeweitet. Damit wurde sie Teil des Aufgabenbereichs der Bewährungshilfe. Im Vergleich zu ihrer Vorgängerin hat die Führungsaufsicht also eine bislang relativ kurze Geschichte mit neuerdings allerdings dynamischer Entwicklung.
Die Führungsaufsicht stellt eine ambulante Maßregel der Besserung und Sicherung dar und passt sich in ihrem rechtssystematischen Charakter an andere Maßregeln an, d. h. resozialisierende, integrative Elemente sind eng verbunden mit solchen der Sicherung und Verhinderung erneuter Straffälligkeit. Allerdings ist sie nicht ausgerichtet auf eine spezifische Gefährlichkeit, sondern auf eine allgemeine Kriminalitätsgefährlichkeit von Probanden und damit auch nicht auf die Verhinderung eines einschlägigen Rückfalls, sondern allgemein auf die Verhinderung erneuter Straffälligkeit.
Nach gesetzlichen Änderungen 2007 und 2011 und infolge einer immer häufigeren Anwendung - im Jahr 20015 bundesweit über 37.000 Fälle - rückt das Instrument der Führungsaufsicht mittlerweile immer mehr in die öffentliche Wahrnehmung. 40 Jahre nach Einführung der Führungsaufsicht wurde in einer DBH-Fachtagung eine Zwischenbilanz gezogen. In diesem Buch werden die Ergebnisse einer grundlegenden, vom Bundesjustizministerium in Auftrag gegebenen empirischen Untersuchung über die Anwendung der Führungsaufsicht, vorgestellt. Die Entwicklung seit 1974 und die systematische Stellung des Instruments werden in einem Fachartikel skizziert. In einem weiteren Beitrag aus Mecklenburg-Vorpommern wird das dortige Modell einer zentralen Führungsaufsichtsstelle innerhalb eines Landesamts für Straffälligenarbeit praxisnah vorgestellt. Abschließend wird ein Überblick zu aktuellen Fallzahlen in den Bundesländern seit der Reform 2007 präsentiert.
Aktualisiert: 2021-08-30
> findR *

Der vorliegende Band dokumentiert die 22. Bundestagung des DBH-Fachverbandes zum Thema „Im Norden zu neuen Horizonten – Kriminalpolitik gestalten, Inhaftierungen vermeiden, Straffälligenhilfe ausbauen“, die im September 2015 in Damp / Schleswig-Holstein stattfand. An ihr nahmen insgesamt 150 Personen aus der Bewährungshilfe, der freien Straffälligenhilfe, dem Strafvollzug, den Landesjustizministerien und anderen Bereichen der Arbeit mit straffällig Gewordenen aus allen Bundesländern teil. Neben Vorträgen wurden dort auch Workshops und Thementische als Diskussionsforen angeboten. Im Nachgang zur Tagung werden in diesem Band noch einige Beiträge hier präsentiert.
Die Textbeiträge spiegeln einerseits Dauerthemen unserer Arbeits- und Berufsfelder wider, wie das Verhältnis zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren und die anhaltende Aufgabe der Gestaltung ihrer Zusammenarbeit (Cornel), aber auch Fragen der Professionalität des Handelns zwischen Rechtsstaatsbezogenheit und Berufsphilosophie(n) (Grosser). Anderseits kommen darin neuere Themen zur Geltung, wie das der Evaluierung (Dölling), Fragen des Datenschutzes (Anders) oder der Berücksichtigung von Opferbelangen und der Anwendung von Elementen der Restorative Justice innerhalb des Strafvollzugs (Haarländer). Des Weiteren wird aus der Perspektive des Staatsschutzes der jihadistische Salafismus als eine Strömung der salafistischen Bestrebungen in Deutschland vorgestellt. Nachdem Anhänger dieses gewaltbereiten Teils des Islamismus mittlerweile Freiheitsstrafen verbüßen, liegt die Auseinandersetzung mit diesem religiösen oder politisch-ideologischen Phänomen auch für die Bewährungs- und Straffälligenhilfe nahe.
An dieser Sammlung von Einzelbeiträgen lassen sich nicht nur Entwicklungen der letzten Jahre und Jahrzehnte erkennen, sondern auch die Vielfalt von Fragen und Themen mit der die verschiedenen Berufe im Bereich der Strafrechtspflege, Bewährungs- und Straffälligenhilfe konfrontiert sind. Dass nicht nur die Problemvielfalt, sondern auch die Problemwahrnehmung und Auffassungen über ihre Lösungen teilweise weit auseinander gehen, kann dabei nicht überraschen und ist als ein Befund unter anderen auch Gegenstand einer der vorgelegten Ausarbeitungen (siehe Dölling).
Aktualisiert: 2021-08-30
> findR *

In diesem Buch berichten die Autoren über das erfolgreiche RESI-Modellprojekt in Köln, wo in den Jahren 2009 bis 2012 in einem Trägerverbund durch eine individuelle Intensiv-Betreuung von 24 straffällig gewordenen Kölner Jugendlichen die Rückfallquoten nach Feststellungen der wissenschaftlichen Begleitung auf 13 % abgesenkt werden konnten. Die laufenden Projektkosten betrugen ein Fünftel vergleichbarer Kosten des Strafvollzugs.
Hans-Joachim Plewig stellt zusammenfassend unter der Perspektive der Nachhaltigkeit die Erkenntnisse dar, die durch das RESI-Projekt gewonnen werden konnten. Knapp 4 Jahre nach Beendigung des Projekts liefern Anne Rossenbach und Monica Wunsch eine Nachbetrachtung aus der Sicht der Praxis. Bernd Maelicke weist erneut in seinem Beitrag „Wie Wasser von Klippe zu Klippe geworfen“ auf die strukturellen Mängel und Schwächen des Systems der Resozialisierung hin. Anja Katzmarzik berichtet von Ihrer Begleitung eines Jugendlichen Strafgefangenen vor und nach seiner Entlassung aus der Jugendanstalt. Dieser thematische RESI-Schwerpunkt wird ergänzt durch eine aktuelle Stellungnahme des Leiters des Kriminologischen Dienstes des Landes Nordrhein-Westfalen.
Trotz dieser bundesweit einmaligen Erfolgsquote musste das Projekt beendet werden und wurde somit zum Aufgeben gezwungen. Eine Fortführung und Verbreitung des Modells ist angesichts der aktuellen Sicherheits- und Integrationsproblematik unbedingt erforderlich.
Aktualisiert: 2021-08-30
> findR *

Die Betreuung und Kontrolle von gefährlichen Straftätern nach der Haftverbüßung ist eine brisante Problematik, die aufgrund spektakulärer Einzelfälle immer wieder zu emotional aufgewühlten Diskussionen in Medien und Politik führt. Vor allem anlässlich schwerer Rückfälle einzelner Täter, die bereits einschlägig vorbestraft waren, sind dann auch in Deutschland überschießende Forderungen nach dauerhaftem Kriminalpolitik „Wegschließen“ oder weit drastischeren Maßnahmen vor allem mit Blick auf Sexualstraftäter zu hören. Der Gesetzgeber hat in den vergangenen Jahren darauf meist in der Form reagiert, dass einschneidende Strafverschärfungen verabschiedet wurden. Fachlich fundierte Auseinandersetzungen über die angemessene Anwendung von Prävention und Repression bei gefährlichen Straftätern sind weit weniger spektakulär und erreichen die Öffentlichkeit nur selten. Für die Arbeit der Fachkräfte im Straf- und Maßregelvollzug, derder ambulanten Betreuung gilt dies noch weit mehr. Die Beiträge in diesem Band befassen sich mit Grundlagen, Voraussetzungen und Methoden der Betreuung und Kontrolle von gefährlichen Straftätern aus juristischer, sozialwissenschaftlicher und berufspraktischer Sicht. Sie geben zahlreiche Anregungen darüber, wie diese Arbeit vor dem Hintergrund hoher Erwartungen, wissenschaftlicher Befunde und praktischen Erfahrungswissens weiterentwickelt, differenziert und nachvollziehbar gestaltet werden kann.
Aktualisiert: 2021-08-30
> findR *
In diesem Buch geht es um die rückblickende Sicht und Würdigung des Berufsfeldes durch fünf Bewährungshelfer und eine Bewährungshelferin, die viele Jahre ihres Lebens aktiv in diesem Arbeitsfeld verbracht haben. Mit ihnen hat der Autor darüber Gespräche geführt, die hier veröffentlicht werden.
In einem einführenden Teil wird die historische und rechtsgeschichtliche Entwicklung des Rechtsinstituts Bewährungshilfe konturiert und so einem breitgefächerten Leserkreis der Zugang zu diesem Arbeitsfeld der Sozialarbeit geschaffen.
Durch die Interviews wird ein authentischer Einblick in die Zeit vermittelt, in der sich die Bewährungshilfe in Deutschland aus den ersten Versuchsreihen heraus zu einem anerkannten und bedeutenden Rechtsinstitut entwickelt hat.
Insgesamt ist der Band ein Beitrag zur Geschichte der Bewährungshilfe, aber es ist nicht die Geschichte der Bewährungshilfe. Es ist die Geschichte derer, die hier ihre Eindrücke wiedergeben.
Aktualisiert: 2021-08-30
> findR *
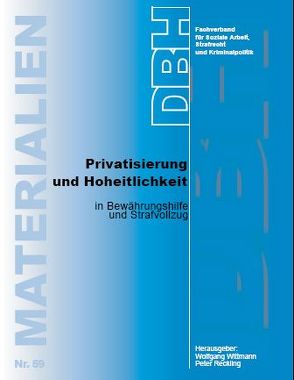
Seit mehreren Jahren ist eine Diskussion über die Übertragung von Justizaufgaben auf freie Träger der Straffälligenhilfe und private Anbieter im Gange. Das Ergebnis ist weitgehend offen geblieben, so dass es nunmehr faktisch in einigen Bereichen und Regionen einzelne Modelle der Übertragung gibt und in anderen der Status quo erhalten blieb. In der Auseinandersetzung werden unterschiedliche Argumente vorgetragen, die einerseits von der Sensitivität gegenüber nichthoheitlich legitimierten Eingriffen getragen und von verfassungsrechtlichen Argumenten gestützt sind, andererseits solche, die Kosten-, Effektivitäts- und Flexibilitätsargumente vorbringen.
In diesem Band sind Beiträge zum Thema versammelt, die die fach- und berufspolitische Diskussion widerspiegeln. Sie bilden das Spektrum in der mittlerweile unübersichtlich werdenden Menge an Publikationen und Stellungnahmen weitgehend ab.
Die Beiträge erstrecken sich auf das Feld der Bewährungshilfe und des Strafvollzuges. Sie stammen von Vertretern verschiedener Bereiche, der Berufs- und Fachverbände, der Justizverwaltung, den Gewerkschaften und der Wissenschaft. Sie wurden teilweise zuerst als Redebeiträge auf Fachtagungen gehalten. Sie sollen einen Überblick vermitteln, wie aus unterschiedlicher Sicht heraus argumentiert und sich der Problematik angenähert wird.
Aktualisiert: 2021-08-30
> findR *
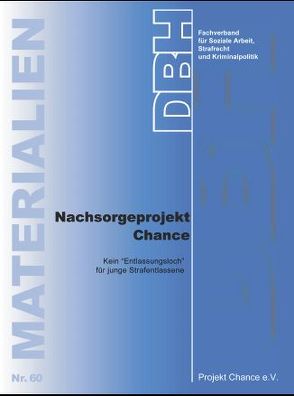
Die Schnittstelle zwischen Strafvollzug und der ambulanten Nach-betreuung hat sich in der Praxis immer als äußerst problematisch und als unbefriedigend geregelt ergeben. Dabei besteht in dieser speziel-len Phase für die Kriminalprävention die größte Herausforderung, da die Rückfallgefahr in den ersten Monaten nach der Haftentlassung am größten ist. Die Verzahnung der stationären und ambulanten Dienste wurde schon immer als wesentlich reformbedürftig angese-hen und es wurden von vielen Praktikern und Experten gut gemeinte Konzepte entwickelt. Meist sind diese nach einer Erfolg versprechen-den Anfangsphase dem Alltag der Normalität – und damit der institu-tionellen Trennung von stationärer und ambulanter Straffälligenhilfe - zum Opfer gefallen. Die Rückfallraten von 80% der Jugendlichen, die aus dem Jugendstrafvollzug entlassen werden, sind so erschreckend hoch, dass nach alternativen Wegen gesucht werden muss.
Das Zusammenwirken der verschiedenen mit diesen Aufgaben der stationären und ambulanten Betreuung von Straffälligen betrauten Institutionen und deren Fachkräfte, ist ein wesentlicher Faktor, um eine positiv wirkende Resozialisierung zu erreichen. Diese Wirkung muss messbar sein. Die Fähigkeiten der Entlassenen, ihre besondere Lebenssituation zu bewältigen muss verbessert und zugleich die Rückfallvermeidung erhöht werden.
Die aktuelle Fachdiskussion und alle Untersuchungen weisen nach, dass eine wirkungsorientierte Steuerung der Resozialisierungsarbeit im Strafvollzug nicht mit dem Tag der Entlassung enden darf, sondern dass erst durch die vollzugsübergreifende Integrationsplanung, die Nachsorge und ein verbessertes Netzwerkmanagement andauernde Eingliederungserfolge mit Reduzierung der Rückfallgefahr realisiert werden können.
Andernorts sind deshalb Spezialdienste eingerichtet worden, die insti-tutionsübergreifend die notwendige Verzahnung zwischen den am-bulanten und stationären Maßnahmen sicherstellen (auch das Bun-desverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 31. Mai 2006 eine „verzahnte Entlassungsvorbereitung“ für den Jugendstrafvollzug ge-fordert).
Mit dem Nachsorgeprojekt Chance schafft das Land Baden-Württemberg eine organisatorische Voraussetzung, diesem Mangel im Bereich der jugendlichen Straftäter zu begegnen. In dem Hand-buch werden das Nachsorgeprojekt und das Qualitätskonzept aus-führlich beschrieben. Aus der Sicht der Praktiker und der Forschung werden ersten Erfahrungen benannt.
Ein weiterer besonders zu betonender Faktor des Nachsorgeprojektes Chance ist einerseits der Zusammenschluss der Landesverbände mit einem Wohlfahrtsverband zu einem einzigen Dienstleister für den Trä-gerverein Projekt Chance e.V. und andererseits der Zusammen-schluss der örtlichen bzw. regionalen Vereine in einem gemeinsamen Projekt. Die Landesverbände haben erkannt, dass es sinnvoll ist, ge-meinsam zu handeln und sich abzustimmen. Das war auch schon bei der Bewerbung um die Übernahme der Bewährungshilfe in Baden-Württemberg versucht worden, führte aber kurzfristig nicht zum an-gestrebten Erfolg. Jetzt hatte man genug Vorlauf und Erfahrungen sammeln können. Das gemeinsame Auftreten der regionalen Verei-ne unter einem Landeszusammenschluss, hat sich in der Zusammen-arbeit mit dem Ministerium als sehr erfolgreich bewährt. Die konkurrie-renden Elemente konnten damit reduziert und das gemeinsame An-liegen gestärkt werden. Es ist zu hoffen, dass sich diese Erkenntnis auch in anderen Bereichen der Straffälligenhilfe durchsetzt. Andere Regionen können dabei vom vorbildlichen Vorgehen der Verbände und Vereine in Baden-Württemberg etliches lernen.
Aktualisiert: 2021-08-30
> findR *

Die Gemeinnützige Arbeit als strafrechtliche Sanktion boomt: Im Jugendstrafrecht ist sie mittlerweile zur häufigsten Sanktion geworden und auch im Allgemeinen Strafrecht gerät das her-kömmliche System der Strafen in Bewegung. Zuletzt hat das Bundesministerium der Justiz im Dezember 2003 Eckpunkte einer Reform des strafrechtlichen Sanktionensystems veröffentlicht, die auf eine deutliche Erweiterung des Einsatzes Gemeinnütziger Arbeit hinauslaufen. In der Praxis hat sich vor allem die Ableistung Gemeinnütziger Arbeit zur Abwendung einer Ersatzfreiheitsstrafe als fester Bestandteil des Sanktionensystems etabliert.
Dieser Entwicklung steht eine uneinheitliche Praxis gegenüber. Sie ist vor allem dadurch gekennzeichnet, dass es bislang Standards weder für die Vermittlung zu den Arbeitsstellen noch für das weitere Verfahren gibt. Auch die Frage, ob die Arbeitsleistung sozialpädagogisch begleitet werden kann, hängt häufig eher von örtlichen Verhältnissen ab als vom Bedarf der Betroffenen.
In dieser Situation haben sich Fachleute auf den Weg gemacht, Qualitätsstandards für Fach- und Vermittlungsstellen von Gemeinnütziger Arbeit zu erstellen, die in diesem Handbuch zu-sammengefasst sind. Mit diesem Werk wird Neuland betreten: So werden nicht nur Rahmen-bedingungen und Verfahrensweisen beschrieben, die aus strafrechtlicher Sicht notwendig sind, um ein Vermittlungsverfahren zur Gemeinnützigen Arbeit zu gestalten, die behandelten Themen ordnen sich gleichzeitig ein in die Qualitätsdiskussion in der Sozialen Arbeit, bringen also diesen Teil der Straffälligenhilfe auf den aktuellen Stand des fachlichen Diskurses.
Das vorliegende Handbuch enthält nicht nur wertvolle Anregungen für die Praxis, sondern vermittelt darüber hinaus die zentrale Erkenntnis, dass eine angemessene Vermittlung in und Begleitung bei der Gemeinnützigen Arbeit nicht „nebenher“ geleistet werden kann. Die beschriebenen Qualitätsstandards sind zwar grundsätzlich in unterschiedlichen Organisationsformen umsetzbar, klar wird jedoch, dass die ausschließliche Abwicklung der genannten Aufgaben durch Verwaltungskräfte bei den Vollstreckungsbehörden den Anforderungen nicht genügen kann.
Für die Zukunft dieser Sanktion ist zu hoffen, dass die vorliegende Veröffentlichung den Anstoß gibt zu einer Diskussion, die über die hier beschriebenen Qualitätsstandards hinaus auch die positiv-spezialpräventiven Potenziale der Arbeitsleistungen selbst erfasst.
In diesem Sinne sind die vorliegenden Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Qualitätsstandards Gemeinnützige Arbeit“ ein Meilenstein für die Weiterentwicklung der Sanktionen, die bei der Gemeinnützigen Arbeit neben dem quantitativen Ausbau auch qualitative Aspekte umfassen muss.
Aktualisiert: 2021-08-30
> findR *
In diesem Fachbuch schreiben ausgewiesene Expertinnen und Experten aus wissenschaftlicher und praktischer Sicht über die Problematik des Übergangsmanagements zwischen Strafvollzug und Nachbetreuung und regen zu Verbesserungen an.
Deutschland hat zwar die „sichersten“ Gefängnisse, die Resozialisierungserfolge bei jugendlichen Strafgefangenen fallen mit einer Rückfallquote von ca. 80 % hingegen sehr gering aus. Gefangene werden nach verbüßter Strafe häufig unvorbereitet und ohne Unterstützung in die Freiheit entlassen, mit extrem hohen Rückfallrisiken in der Zeit nach der Entlassung.
Aktualisiert: 2021-08-30
> findR *

Seit dem 1. Januar 2011 ist die elektronische Aufenthaltsüberwachung von als gefährlich eingeschätzten Entlassenen aus dem Strafvollzug bundesweit als Weisung im Katalog der Führungsaufsicht nach § 68 b Abs. 1 S. 1 Nr. 12 StGB zulässig. Diese im Zuge der Reformierung der Sicherungsverwahrung gesetzlich geschaffene Möglichkeit schränkt die Bewegungsfreiheit der überwachten Person im Rahmen bestimmter „Gebots-„ und „Verbotszonen“ ein.
Durch die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) und des Bundesverfassungsgerichts wurde dem rechtswidrig gewordenen Zustand einstweilen mit der Entlassung von Sicherungsverwahrten abgeholfen. In vielen Fällen war die unmittelbare Reaktion darauf die Einrichtung von Dauerobservationen durch Polizei und Intensivbegleitung durch die ambulanten Sozialen Dienste der Justiz. Die Antwort des Gesetzgebers bestand in der Neuordnung des Rechts der Sicherungsverwahrung und der begleitenden Regelungen, wozu auch die Anordnung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung gehört.
Der Umgang mit gefährlich eingeschätzten Straftätern gehört schon seit Langem zur Praxis der ambulanten Sozialen Dienste der Justiz, fand aber bis dahin keine große öffentliche Aufmerksamkeit. Es handelt sich dabei um den Umgang mit Probanden der Führungsaufsicht, Entlassenen aus den Forensischen Psychiatrien, Sexualstraftätern und um in die Einbindung in landesweite Überwachungsprogramme (HEADS, KURS etc.).
Die Beiträge in diesem Buch befassen sich mit den Fragen der Menschenwürde, des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung, der persönlichen Freiheit, der Berufsfreiheit, des Bestimmtheitsgrundsatzes, des Rechtsstaatsprinzips und des Gebots zur Resozialisierung. Sie erstrecken sich auf juristische und kriminologische Aspekte des Problems, aber auch auf praktische Fragen des öffentlichen Umgangs und der sozialarbeiterischen Bewältigung.
Das neue Instrumentarium, „die elektronische Aufenthaltsüberwachung“, wird aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Einerseits werden die Motive des (Bundes)gesetzgebers, die Erfahrungen mit der seit Jahren existierenden hessischen „Elektronischen Fußfessel“, mit den Gerichtlichen Weisungen im Rahmen der Führungsaufsicht und die kritische Auseinandersetzung von Wissenschaftlern behandelt.
Die besondere Situation in der Kleinstadt Marburg wird ebenso beschrieben, wobei auch auf den Umgang mit besorgten Bürgern, die als Nachbarn auf den Zuzug von Entlassenen aus der Sicherungsverwahrung protestierten, eingegangen wird.
Schließlich beschreiben zwei Bewährungshelfer/innen Ihre Erfahrungen im Umgang mit Probanden, die als gefährlich bezeichnet werden. Die eine beschreibt, wie notwendig es ist, intensiv und nah an der Person stehend zu betreuen und. dabei auch Alltagsfragen zu behandeln, oder sie zumindest als Zugangsthema zu nutzen. Der andere kommt zu dem Resümee, dass viele Voraussagen der mangelnden Integrationsbereitschaft einfach nicht zutreffen, sondern scheinbar vielmehr durch das „Binnenklima“ im Strafvollzug geprägt werden.
Aktualisiert: 2021-08-30
> findR *
Im September 2009 führte der der DBH-Fachverband zum 20. Mal seine Bundestagung mit der Beteiligung von vielen Fachleuten aus der Bewährungs- und Straffälligenhilfe und angrenzenden Berufsfeldern durch. Das große Interesse, das hiermit dem Schwerpunkt der Tagung, dem Übergang zwischen dem Strafvollzug und der Nachbetreuung durch Bewährungs- und Straffälligenhilfe sowie anderen Einrichtungen des sozialen Hilfesystems gezeigt wurde, ist seitdem keineswegs geringer geworden, sondern eher weiter gestiegen.
Aktualisiert: 2022-03-28
> findR *

Angesichts der (wieder einmal) verstärkten öffentlichen Debatte um Jugendgewalt in den letzten Jahren scheinen auch Gewaltpräventionsprojekte an öffentlichem Interesse zu gewinnen. Insbesondere das in den 1980er Jahren in der Jugendanstalt Hameln von einer interdisziplinären Arbeitsgruppe entwickelte Anti-Gewalt- bzw. später dann Anti-Aggressivitäts-Training (AAT) hat weite Verbreitung erfahren. Doch nicht nur AATs oder daran angelehnte soziale Trainings, auch Evaluationen haben Konjunktur. Dies hängt nicht nur – aber auch – damit zusammen, dass die Genehmigung von Projekten immer häufiger von parallel durchzuführenden Fremd- oder Eigenevaluationen abhängig gemacht wird. In Evaluationen werden Wirkungen und Effekte der Projektaktivität, aber auch formale Prozess- und Durchführungsqualitäten beurteilt. Dabei können unterschiedliche Bewertungsfragen im Mittelpunkt stehen, je nachdem, welche Gesichtspunkte die Evaluationen zum Gegenstand haben.
Die Autorin beschäftigt sich in dieser Arbeit sowohl mit der konkreten Durchführung von AATs als auch mit daran anschließenden Evaluationen. Insofern kann dieses Buch als eine Evaluation von Evaluationen gesehen werden. Sie ist gleichermaßen lesenswert für die am AAT als solchem interessierten Kolleg/innen wie auch für jene, die auf der Suche nach einer exemplarischen Evaluation sind, die gut nachvollzogen werden kann
Aktualisiert: 2021-08-30
> findR *
MEHR ANZEIGEN
Oben: Publikationen von DBH
Informationen über buch-findr.de: Sie sind auf der Suche nach frischen Ideen, innovativen Arbeitsmaterialien,
Informationen zu Musik und Medien oder spannenden Krimis? Vielleicht finden Sie bei DBH was Sei suchen.
Neben praxiserprobten Unterrichtsmaterialien und Arbeitsblättern finden Sie in unserem Verlags-Verzeichnis zahlreiche Ratgeber
und Romane von vielen Verlagen. Bücher machen Spaß, fördern die Fantasie, sind lehrreich oder vermitteln Wissen. DBH hat vielleicht das passende Buch für Sie.
Weitere Verlage neben DBH
Im Weiteren finden Sie Publikationen auf band-findr-de auch von folgenden Verlagen und Editionen:
Qualität bei Verlagen wie zum Beispiel bei DBH
Wie die oben genannten Verlage legt auch DBH besonderes Augenmerk auf die
inhaltliche Qualität der Veröffentlichungen.
Für die Nutzer von buch-findr.de:
Sie sind Leseratte oder Erstleser? Benötigen ein Sprachbuch oder möchten die Gedanken bei einem Roman schweifen lassen?
Sie sind musikinteressiert oder suchen ein Kinderbuch? Viele Verlage mit ihren breit aufgestellten Sortimenten bieten für alle Lese- und Hör-Gelegenheiten das richtige Werk. Sie finden neben