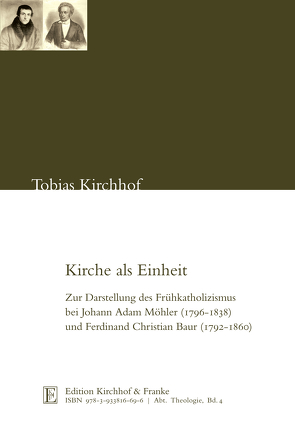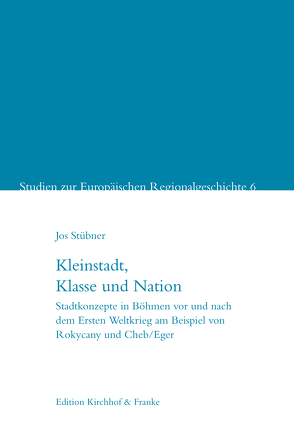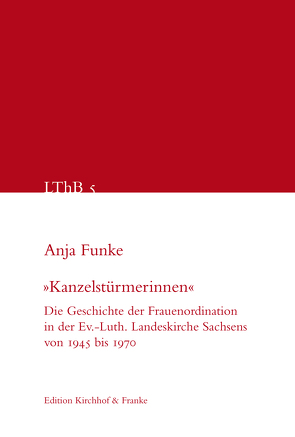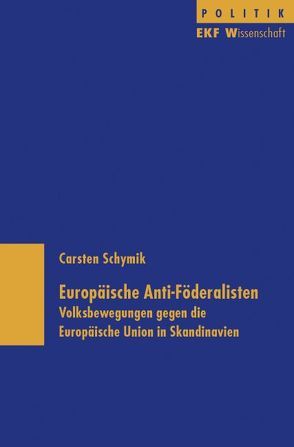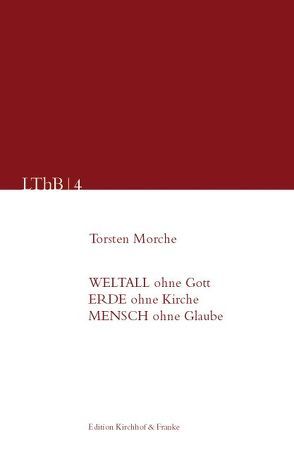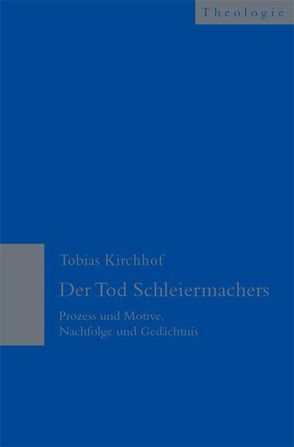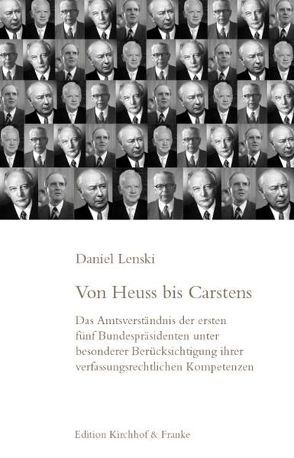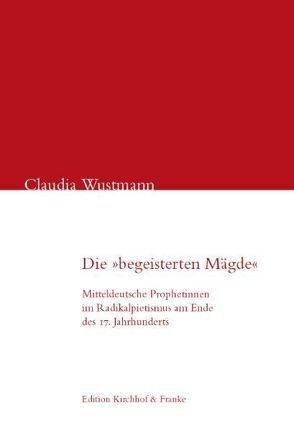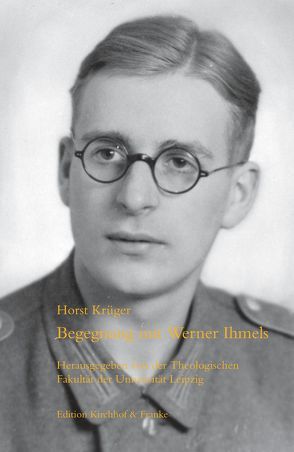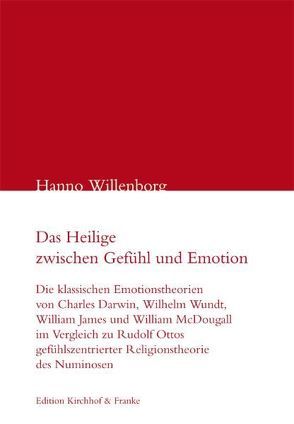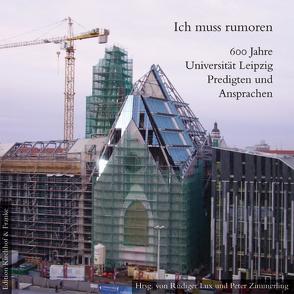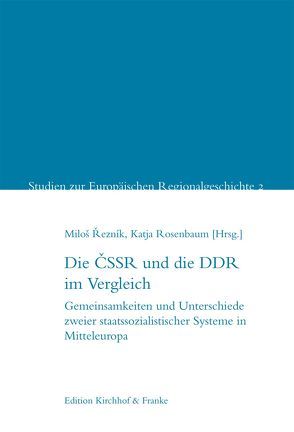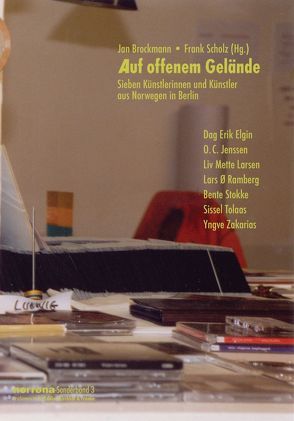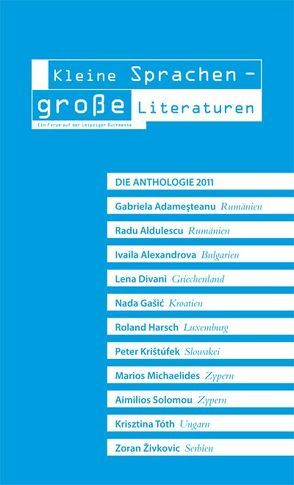Die 'begeisterten Mägde' – so nannte man am Ende des 17. Jahrhunderts einige Frauen, die im Milieu des radikalen Pietismus als Prophetinnen auftraten und die zeitweilig eine beträchtliche Anhängerschaft hinter sich versammeln konnten. Warum vermochten gerade diese Frauen es, Menschen in ihrem unmittelbaren Umfeld, aber auch prominente Vertreter des Pietismus wie August Hermann Francke davon zu überzeugen, dass sie göttliche Offenbarungen empfangen hätten?
Um diese Frage zu beantworten, wird die Situation rekonstruiert, in der die Offenbarungsträgerinnen an die Öffentlichkeit traten. Die daraus gezogenen Schlüsse geben auf einer mikrohistorischen Ebene Einblick in die Lebensumstände des ausgehenden 17. Jahrhunderts, bilden aber gleichzeitig einen Beitrag zum religionssoziologischen Diskurs über die Bedingungen der Möglichkeit von Offenbarungsberichten.
Die Studie greift dabei etliche von der Religionswissenschaft derzeit lebhaft diskutierte Fragen, wie die nach dem Zusammenhang von religiöser Dynamik und Nonkonformismus, Religion und Gender oder nach religiösen Individualisierungs- und Pluralisierungsprozessen, auf und leistet einen Beitrag zu diesen aktuellen Diskursen.
Personenregister:
Achilles, Andreas
Alberti, Valentin
Albrecht, Ruth
Andersson, Bo
Anna Dorothea Herzogin zu Sachsen-Weimar
Anton, Paul
Arndt, Johann
Arnold, Gottfried
Asseburg, Rosamunde Juliane von der
August der Starke
Augustinus
Bainbridge, William S.
Baur von Eyseneck, Juliane Marie
Beckmann (Mediziner um 1700)
Benigna Gräfin zu Solms-Laubach
Benz, Ernst
Beyreuther, Erich
Beyreuther, Gottfried
Böhme, Jakob
Boor, Friedrich de
Born, Martin
Bourdieu, Pierre
Bourignon de la Porte, Antoinette
Bouviere de la Mothe, Jeanne Marie → Jeanne Marie Guyon de Chesnoy
Breithaupt, Justus Joachim
Brelie-Lewin, Doris von der
Brückner, Georg Heinrich
Brumm (Gothaer Laborant um 1700)
Buchmann (Leipziger um 1692)
Buttlar, Eva von
Calixt, Georg
Carpzov, Benedikt Friedrich
Carpzov, Johann Benedikt
Carstenius (Quedlinburger Pfarrer)
Crasselius, Bartholomäus
Crophius, Johann Baptist
Elrichs, Anna Maria
Elrichs, Magdalena
Elsner, Bartholomeus
Erfurtische Liese → Anna Maria Schuchart
Ernst I. der Fromme von Gotha
Falckner, Daniel
Feller, Joachim
Fergen, Henrich
Feustking, Johann Henrich
Francke, August Hermann
Francke, Gotthilf August
Franz von Sales
Fratscher, Nikolaus
Freud (Frau um 1690)
Freylinghausen, Johann Anastasius
Friedrich I. in Preußen, Kurfürst von Brandenburg
Frölich, Eva Margaretha
Gäbler, Ulrich
Gerhardt, Paul
Gestrich, Andreas
Gichtel, Johann Georg
Gißibl, Bernhard
Glörfeld, Johann
Göring, Joachim
Goeters, Wilhelm
Goethe, Johann Wolfgang von
Gräfner, Agnes
Graf, Maria
Graser, Auguste
Grüling (Arzt um 1690)
Grünberg, Paul
Grundmann, Herbert
Guyon de Chesnoy, Jeanne Marie
Hanisch, Friedrich Siegmund
Hanisch, Rosina
Heimburger, David
Heinrich (Leipziger Oberleichenschreiber um 1690)
Heppe, Heinrich
Hertz, Michael
Hesse, Hermann
Hochmann von Hochenau, Ernst Christoph
Hoffmann, Friedrich
Homberg, Johann
Ignatius von Loyola
Jacobs, Anna Eva
Jacobs, Melchior
Jahn, Anna Margaretha
Jakubowski-Tiessen, Manfred
Johannes vom Kreuz
Johann Georg III. Kurfürst von Sachsen
Johann Georg IV. Kurfürst von Sachsen
Karlstadt, Andreas Bodenstein von
King, Ursula
Kirchner, Georg
Kirchner, Susanna Magdalena
Knyphausen (Baron um 1692)
Knyphausen, Dodo von
Körner (Frau um 1690 in Gotha)
Kratzenstein, Heinrich
Kromayer, Augustin Friedrich
Labadie, Jean de
Landwehr, Achim
Lange, Joachim
Lange, Johann Christian
Lange, Nikolaus
Languth (Leipziger um 1692)
Laqueur, Thomas
Leade, Jane
Lehmann, Hartmut
Leibniz, Gottfried Wilhelm
Linck, Catharina Margaretha
Lodensteyn, Jodocus van
Ludolph, Hiob
Lüders, Justus
Luther, Martin
Makarios der Ägypter
May (Leipziger Wäscherin um 1692)
Meinecke (Quedlinburger Arzt um 1692)
Meinig, Dorothea
Meisner, Balthasar
Merlau, Johanna Eleonora von und zu
Mey → May
Meyer, Barthold
Molinos, Miguel de
Moore, Cornelia Niekus
Mori, Ryoko
Mühlenberg, Heinrich Melchior
Müntzer, Thomas
Naumann, Elias
Neander (Leipzigerin um 1692)
Neuß, Heinrich Georg
Nicolai, Philipp
Notmeyer, Albrecht
Olearius, Johann Christian
Paulus, Beate
Paulus, Philipp
Perkins, William
Peschke, Erhard
Petersen, Johann Wilhelm
Petersen, Johanna Eleonora → Johanna Eleonora von und zu Merlau
Pfeiffer, August
Pfeiffer, Johann Laurentius
Platon
Poiret, Pierre
Poniatovia, Christina
Pordage, John
Prätorius, Johannes
Prinz (Hofrat in Halle um 1692 und Frau)
Rath (Leipziger Hofschuster um 1690 und Frau)
Rechenberg, Adam
Regel, Elisabeth
Reinecke, Catharina
Reitz, Johann Henrich
Richter, Gregor
Ringhammer, Friedrich Ernst
Ritschl, Albrecht
Rosen, Hans Caspar
Roth, Albrecht Christian
Rudolf August Herzog zu Braunschweig-Wolfenbüttel
Sack, Johann Georg
Sarasin, Philipp
Schade, Johann Caspar
Scharfe, Martin
Scharff (Leipziger um 1692)
Scharschmied, Anna Catharina
Schilling, Johann Andreas
Schmaltz, Johann Gottfried
Schmid (Arzt um 1690)
Schmidt, Jacob
Schmidt, Johann Eusebius
Schmied, Jacob → Jacob Schmidt
Schrader, Hans-Jürgen
Schreiber (Hofrätin in Halberstadt um 1690)
Schröder, Johann Heinrich
Schubart (Leipzigerin um 1690)
Schuchart, Anna Maria
Schütz, Johann Jakob
Schulz, Martin
Schwartz, Adelheid Sibylle
Schwartz, Candida Benedikta
Schwartze, Christoph
Scott, Robert
Scriver, Christian
Seckendorff, Veit Ludwig von
Seiwert, Hubert
Semler, Gebhard Levin
Silesius, Angelus
Solmnitz, Sophia Maria von
Spener, Philipp Jakob
Sprögel, Anna Maria
Sprögel, Johann Heinrich
Sprögel, Susanna Margaretha
Stammer, Adrian Adam von
Stark, Rodney
Steidele, Angela
Stephan, Horst
Süsse, Heinrich
Taege-Bizer, Jutta
Tauler, Johannes
Tentzel, Ernst
Theresa von Avila
Thomas von Kempen
Thomas von Aquin
Thomasius, Christian
Tostleben, Christoph
Troeltsch, Ernst
Undereyck, Theodor
Veit, Patrice
Vergerius, Georg Friedrich
Vesti, Justus
Vogler, Jacob
Volkmann (Quedlinburger Arzt um 1692)
Walker Bynum, Caroline
Wallmann, Johannes
Weber, Max
Weidenhain, Johann Caspar
Weidling (Erfurter Gerber um 1690)
Weigel, Valentin
Weinzierl, Matthias
Welz, Justinian Ernst Baron von
Wiegleb, Johann Hieronimus
Witt, Ulrike
Wolff, Christiane Sophie von
Wolff, Sophie Tranquilla von
Wurm, Anna Magdalena
Wurtzler, Johann Christoph
Zimmermann, Johann Jakob
Zinzendorf, Nikolaus Ludwig Graf von