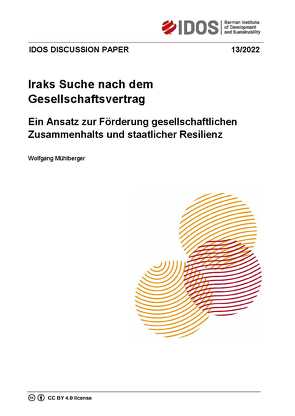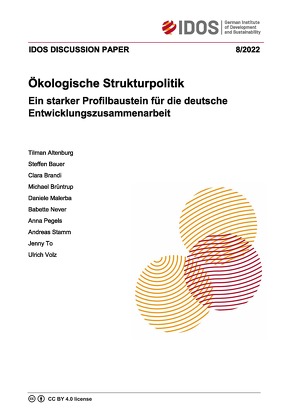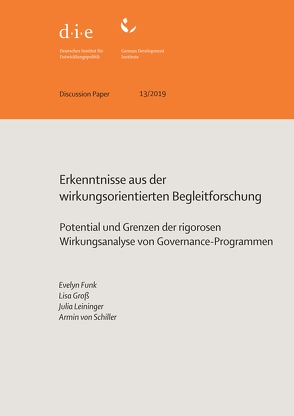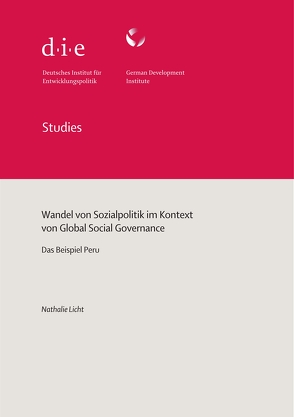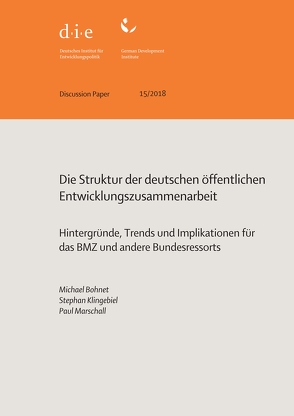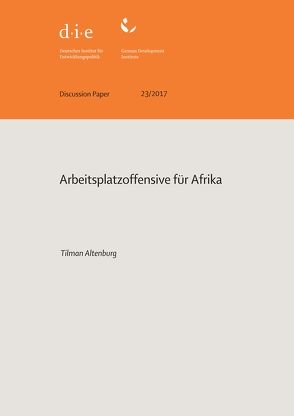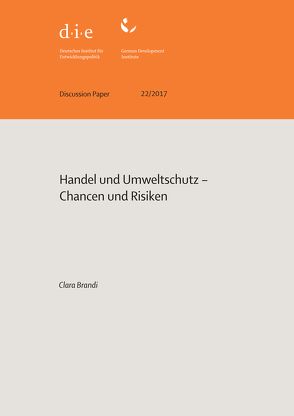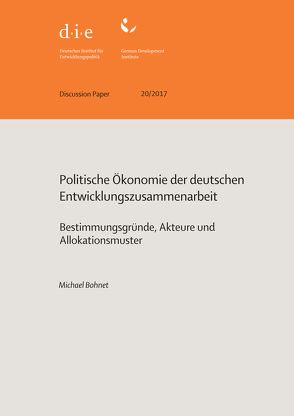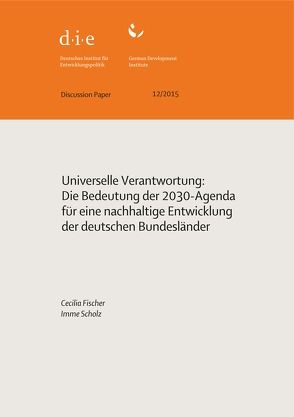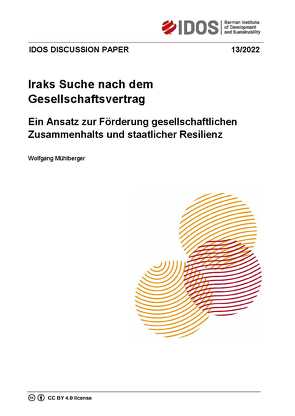
Zweck dieser Studie ist es, die Beziehungen zwischen Staat und Gesellschaft im Irak durch die konzeptionelle Linse des Gesellschaftsvertrages zu betrachten. Aus diesem Zugang können sich zudem potenzielle Betätigungsfelder für außenstehende Akteure ableiten lassen – wie zum Beispiel die deutsche Entwicklungszusammenarbeit (EZ) und die Technische Zusammenarbeit (TZ). Sie können dazu beitragen, die Neuverhandlung dieses angespannten Beziehungsgeflechts zu unterstützen. Dieser Analyse liegt das Verständnis eines Gesellschaftsvertrages zugrunde, welches das Verhältnis zwischen Regierten und Regierung primär als Verhandlungsprozess betrachtet und sich beispielsweise entlang der sogenannten 3Ps (participation/Beteili-gung, provision/öffentliche Güter und protection/Schutz-Rechtsstaat) operationalisieren lässt. Insofern fließen in das Verständnis zeitgenössische Ansätze ein, aber auch die klassischen Überlegungen der französischen und angelsächsischen Denker, welche die individuelle Freiheitseinschränkung im Gegenzug zu staatlich gewährleisteter Rechtssicherheit betonen.
Die Studie teilt sich dazu in drei Abschnitte. In einem ersten Schritt werden die schwache Staatlichkeit und die Zerrüttung der Gesellschaft im heuristischen Kontext des Gesellschaftsvertrages erörtert. Des Weiteren wird die Rolle externer Akteure bei der Entwicklung des Irak nach 2003 beschrieben. Dabei werden das politische Proporzsystem und dessen gesellschaftspolitische Implikationen näher beleuchtet. Im dritten Teil werden als Synthese der ersten beiden Abschnitte Überlegungen angestellt, wie externe Akteure aus der Entwicklungszusammenarbeit einen Beitrag zur friedlichen Ausverhandlung des dysfunktionalen irakischen Gesellschaftsvertrages leisten können. Diese Überlegungen vollziehen sich vor dem systemischen Hintergrund eines Rentenstaates mit hybrider Regierungsführung und sie nehmen sowohl die äußerst brüchige Beziehung zwischen Regierung und Bevölkerung in den Blick als auch die bislang tendenziell gescheiterten externen Interventionen. So zeigen sich die Schwachpunkte des über weite Strecken dysfunktionalen irakischen Gesellschaftsvertrages, die gleichzeitig Ansatzpunkte liefern, ihn zu verbessern und neu zu verhandeln.
Aktualisiert: 2022-12-30
> findR *
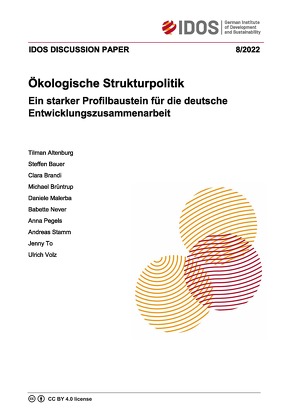
Die Weltwirtschaft steuert in Richtung ökologischer Nachhaltigkeit. Aufgrund einer immer stringenteren umwelt- und klimapolitischen Regulierung setzen sich neue nachhaltige Technologien und Geschäftsmodelle durch. Diese wiederum verändern Wettbewerbsbedingungen und Standortvorteile. Kluge Strukturpolitik antizipiert solche Veränderungen; sie lenkt und fördert die heimische Wirtschaft dahingehend, dass sie frühzeitig die Chancen dieses Strukturwandels nutzt. Das gilt auch für die Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung in der Entwicklungszusammenarbeit. Mit einer Fokussierung auf ökologische Strukturpolitik als Entwicklungsmotor könnte die deutsche Entwicklungszusammenarbeit ihr in Teilbereichen – z. B. Förderung erneuerbarer Energien, Ökostandards in Lieferketten – bereits angelegtes besonderes Profil weiter ausbauen. Im vorliegenden Impulspapier schlagen wir sieben Themen vor, die in Zukunft ein stärkeres Gewicht bekommen sollten. Diese reichen von der Gestaltung wirtschaftspolitischer Rahmenbedingungen (z. B. öko-sozialer Fiskalreformen) bis hin zur Nutzung spezifischer neuer Marktpotenziale in Bereichen wie nachhaltiger Stadtentwicklung, Bioökonomie und grünem Wasserstoff. Allen Themen ist gemeinsam, dass hier ein beschäftigungswirksamer Strukturwandel sowie klima- und umweltpolitische Ziele synergetisch miteinander verknüpft werden.
Aktualisiert: 2022-12-30
> findR *
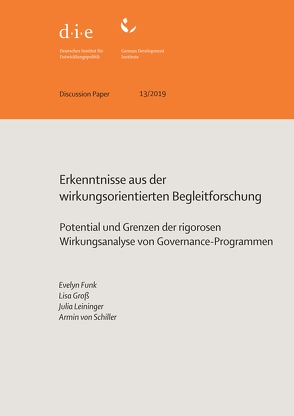
Wie kann die Wirkung von Governance-Programmen erfolgreich analysiert werden? In der vorliegenden Publikation dokumentieren die Autor/innen praxisorientierte und verallgemeinerbare Erkenntnisse über die Durchführung rigoroser Wirkungsanalysen in entwicklungspolitischen Governance-Programmen. Das Projekt „Wirkungsinitiative Afrika“ am Deutschen Institut für Entwicklungspolitik (DIE) folgte bei der Analyse von Wirkungen dem Ansatz der wirkungsorientierten Begleitforschung. Die wirkungsorientierte Begleitforschung verbindet zwei Elemente: a) die Messung einer Wirkung unter Einsatz (quasi-) experimenteller Designs und b) die Untersuchung kausaler Mechanismen mit Hilfe theoriegeleiteter Ansätze. Diese Kombination ermöglicht es Aussagen darüber zu treffen, ob und wieviel Wirkung erzielt wurde (quasi-experimentelle und experimentelle Ansätze), aber auch warum und wie diese Wirkung aufgetreten ist (theoriebasierte Ansätze). Ein solcher mixed-methods-Ansatz kann zu einem umfassenden Verständnis der Wirksamkeit einer Maßnahme beitragen. Die wirkungsorientierte Begleitforschung zeichnet sich zudem über einen langen Zeitraum von mindestens 18 Monaten aus. Damit bildet sie eine besonders intensive Form der Kooperation zwischen Forschung und Praxis. Diese Vorgehensweise ermöglicht einen kontinuierlichen Austausch zwischen Forschenden und Praktiker/innen und begünstigt die rechtzeitige Formulierung von Empfehlungen, die noch während der Implementierung des Programms in die Praxis einfließen können. Die wirkungsorientierte Begleitforschung gilt dann als erfolgreich, wenn sie ihr vollständiges Potential in dreierlei Hinsicht entfaltet: (1) Gestaltung von operativen und strategischen Lernprozessen; (2) Entwicklung von Kompetenzen zum Thema (Wirkungs-) Evaluation im jeweiligen Programm; (3) Beitrag zu einer effektiven internen und externen Rechenschaftslegung.
Das vorliegende Discussion Paper beschreibt Faktoren, die allgemein zu einer erfolgreichen Wirkungsanalyse von Governance-Maßnahmen beitragen, und erörtert auf prozeduraler Ebene, was bei jedem einzelnen Schritt einer wirkungsorientierten Begleitforschung zu beachten ist. Die Erkenntnisse sollen all denjenigen eine Orientierung bieten, die an wirkungsorientierten Begleitforschungsprojekten interessiert oder darin involviert sind.
Aktualisiert: 2022-12-30
> findR *
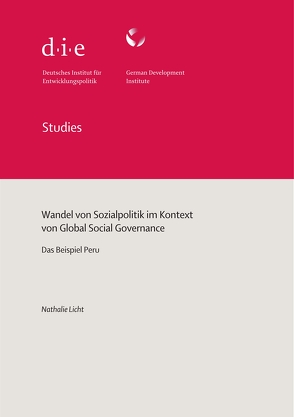
Nachdem in den 1980er und 1990er Jahren Sozialpolitik in Lateinamerika vor allem von internationalen Akteuren durch die strengen Vorgaben der Strukturanpassungsprogramme (SAPs) in den Hintergrund gedrängt worden war, stehen sozialpolitische Fragen in vielen Ländern wieder auf der politischen Agenda. Welchen Einfluss haben aktuell globale Akteure und Policies auf die Sozialpolitik in Nationalstaaten? Am Fallbeispiel Peru wird beleuchtet, wie sich die Muster der Interaktion und Diffusion zwischen Nationalstaaten und externen Akteuren seit dem Washingtoner Consensus radikal veränderten – von einer vertikalen, teilweise erzwungenen Diffusion, vor allem während der SAPs, zu einer freiwilligen, horizontalen Diffusion über Verhandeln und Kommunikation. Inzwischen stehen horizontale Beziehungen, Lernprozesse, Wissensaustausch und Reziprozität im Mittelpunkt. Diese transnationalen Austauschprozesse können nationale Gestaltungsspielräume erweitern und die Leistungsfähigkeit der nationalen Sozialpolitik verbessern. Transnationaler Austausch, grenzüberschreitender Wissenstransfer sind in der vernetzten Weltgesellschaft zu konstruktiven Elementen nationaler Problemlösung geworden. Aus der Untersuchung ergeben sich wichtige Herausforderungen für eine effektive Global Social Governance im 21. Jahrhundert: Sie muss der gewachsenen Bedeutung von globalem Wissensmanagement, transnationalen Wissensnetzwerken und globaler Kooperationen Rechnung tragen.
Aktualisiert: 2022-12-30
> findR *
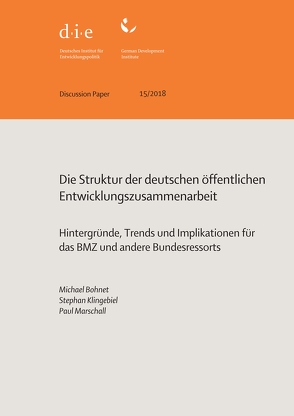
Die Struktur der deutschen öffentlichen Entwicklungsleistungen (ODA) ist im Umbruch. Die Intensivierung der Globalisierung, die Verschärfung der Klimafrage sowie die Flüchtlingskrise trugen wesentlich zu einem bedeutenden Anstieg der deutschen ODA bei. Diese haben sich seit 2012 mehr als verdoppelt und beliefen sich 2016 auf 22 Mrd. Euro. Der Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD (2018) sieht ODA-anrechenbare Ausgaben als prioritären Bereich vor. Es sind deutliche Verschiebungen bei der ODA-Zurechnung auf die Aufgabenträger erkennbar. Der Beitrag des BMZ an der Gesamt-ODA ist 2016 auf 33 Prozent gesunken, der Anteil der anderen ODA-Leistungsträger betrug 2016 67 Prozent (andere Ressorts, EU-Haushalt, Schuldenerlasse, Bundesländer, Marktmittel, Flüchtlingsausgaben). Der Beitrag skizziert die Trends im Detail, liefert kritische Reflexionen zur ODA-Zurechnung und gibt dazu zwei mögliche strategische Interpretationen. Die erste versteht Entwicklungszusammenarbeit (EZ) nicht mehr allein als vergleichsweise kleines Handlungsfeld des BMZ. Andere Ressorts spielen eine wachsende Rolle. Die zweite betont die Schwierigkeiten, einen kohärenten deutschen entwicklungspolitischen Ansatz zu verfolgen, die mit den Verschiebungen der deutschen ODA und der Verteilung der Mittel auf mehr Akteure einhergehen. Deshalb besteht zusätzlicher Koordinierungs- und Abstimmungsbedarf zwischen den Ressorts.
Aktualisiert: 2022-12-30
> findR *
Angesichts von Unterbeschäftigung, Armut und Massenflucht brauchen wir eine Arbeitsplatzoffensive für Afrika. Das für das BMZ verfasste Gutachten zeigt, wo Wirtschaftspolitik ansetzen müsste, um produktive Beschäftigung zu fördern und wie Entwicklungspolitik dieses unterstützen kann.
Aktualisiert: 2022-12-30
> findR *
Im Fokus des Papier steht die Rolle des Freihandelsregimes für die Ausgestaltung von Umweltpolitiken, die Folgen des Regulierungswettbewerbs für das Niveau von Umweltschutzregulierungen und das Verlagerungsproblem im Kontext des internationalen Handels.
Aktualisiert: 2022-12-30
> findR *
Die Studie beleuchtet die Bestimmungsgründe für die Höhe und Struktur der deutschen EZ. Sie gibt einen Überblick über Entscheidungsprozesse und die damit verbundenen Prioritätensetzungen. Dabei werden die bilaterale und multilaterale EZ analysiert und die Akteure und Instrumente beleuchtet.
Aktualisiert: 2022-12-30
> findR *
Die 2030-Agenda ist ein Meilenstein auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung. Sie fordert von den deutschen Bundesländern ihre Nachhaltigkeits- und Entwicklungspolitik besser zu verzahnen und im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit neu auszurichten, um menschliches Wohlergehen zu sichern.
Aktualisiert: 2022-12-30
> findR *
Aktualisiert: 2022-12-30
> findR *
Aktualisiert: 2022-12-30
> findR *
Aktualisiert: 2022-12-30
> findR *
Aktualisiert: 2022-12-30
> findR *
Aktualisiert: 2022-12-30
> findR *
Aktualisiert: 2022-12-30
> findR *
Aktualisiert: 2022-12-30
> findR *
Aktualisiert: 2022-12-30
> findR *
Aktualisiert: 2022-12-30
> findR *
Aktualisiert: 2022-12-30
> findR *
Aktualisiert: 2022-12-30
> findR *
MEHR ANZEIGEN
Oben: Publikationen von German Institute of Development and Sustainability (IDOS) gGmbH
Informationen über buch-findr.de: Sie sind auf der Suche nach frischen Ideen, innovativen Arbeitsmaterialien,
Informationen zu Musik und Medien oder spannenden Krimis? Vielleicht finden Sie bei German Institute of Development and Sustainability (IDOS) gGmbH was Sei suchen.
Neben praxiserprobten Unterrichtsmaterialien und Arbeitsblättern finden Sie in unserem Verlags-Verzeichnis zahlreiche Ratgeber
und Romane von vielen Verlagen. Bücher machen Spaß, fördern die Fantasie, sind lehrreich oder vermitteln Wissen. German Institute of Development and Sustainability (IDOS) gGmbH hat vielleicht das passende Buch für Sie.
Weitere Verlage neben German Institute of Development and Sustainability (IDOS) gGmbH
Im Weiteren finden Sie Publikationen auf band-findr-de auch von folgenden Verlagen und Editionen:
Qualität bei Verlagen wie zum Beispiel bei German Institute of Development and Sustainability (IDOS) gGmbH
Wie die oben genannten Verlage legt auch German Institute of Development and Sustainability (IDOS) gGmbH besonderes Augenmerk auf die
inhaltliche Qualität der Veröffentlichungen.
Für die Nutzer von buch-findr.de:
Sie sind Leseratte oder Erstleser? Benötigen ein Sprachbuch oder möchten die Gedanken bei einem Roman schweifen lassen?
Sie sind musikinteressiert oder suchen ein Kinderbuch? Viele Verlage mit ihren breit aufgestellten Sortimenten bieten für alle Lese- und Hör-Gelegenheiten das richtige Werk. Sie finden neben