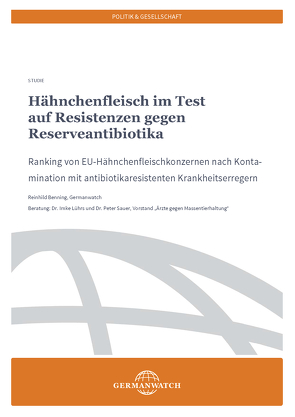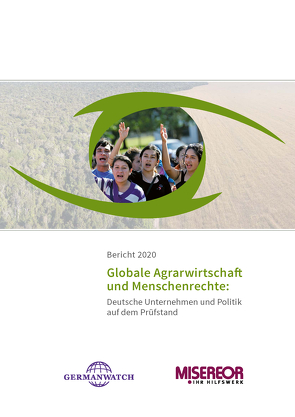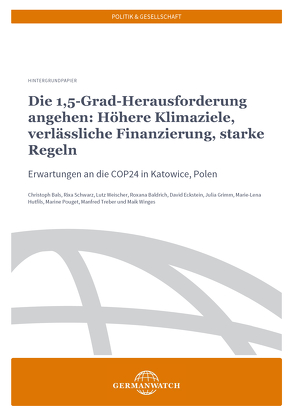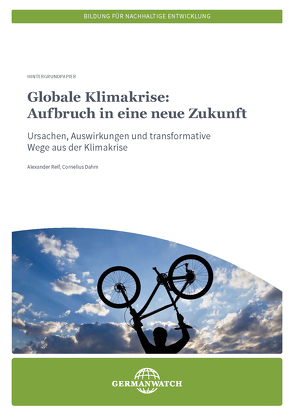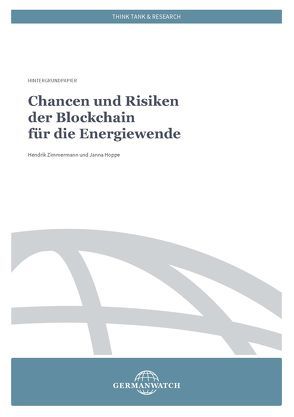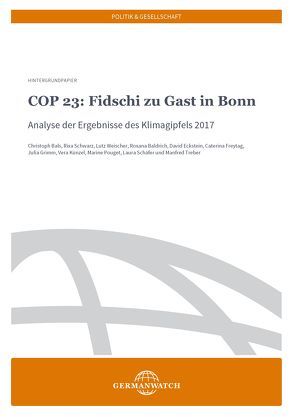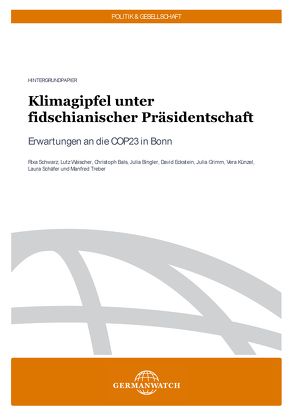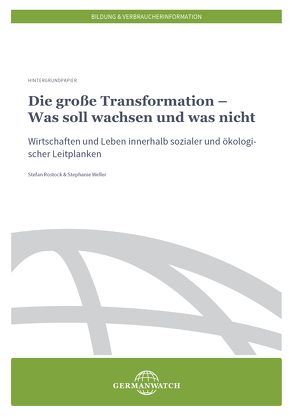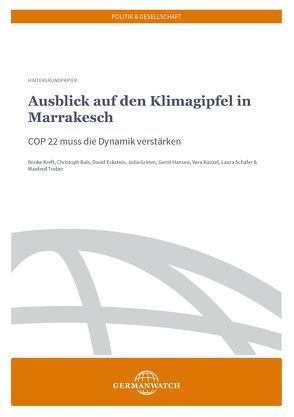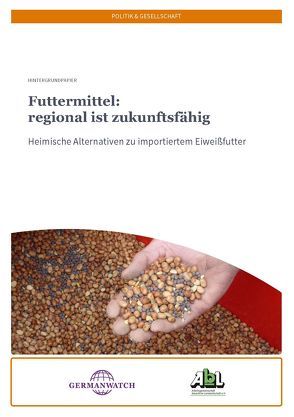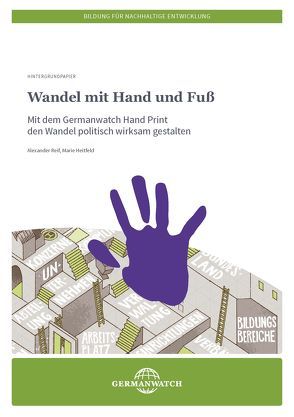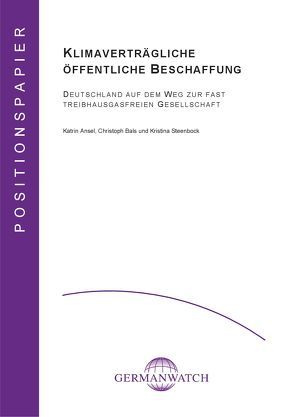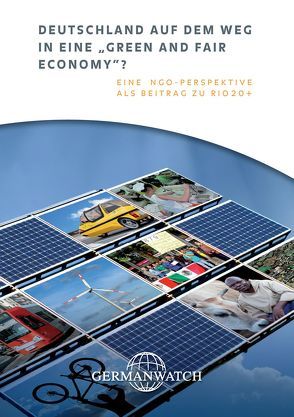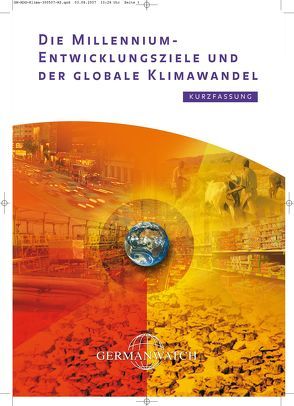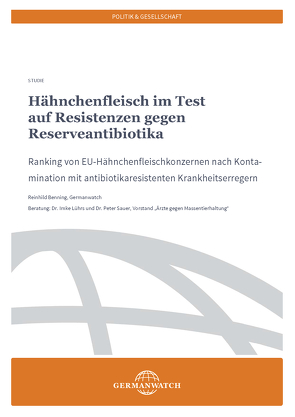
Jede zweite Hähnchenfleischprobe ist mit antibiotikaresistenten Krankheitserregern belastet.
Das ergab die Untersuchung von 165 Fleischproben der Top 3 EU-Geflügelfleischkonzerne,
gekauft aus dem Billigsortiment von Lidl und Aldi sowie aus dem Werksverkauf der Konzerne.
Am stärksten belastet ist Hähnchenfleisch der PHW-Gruppe mit 59 Prozent der Proben, gefolgt
von der französischen LDC-Gruppe mit 57 Prozent kontaminierter Proben. Bei der niederländischen
Plukon Food Group ist jedes dritte Hähnchen belastet. Antibiotikaresistente
Krankheitserreger stellen eine wachsende Gesundheitsgefahr dar. Nehmen Menschen bei der
Zubereitung oder dem Verzehr des Fleisches resistente Erreger auf, kann dies zu schweren
Infektionen führen, bei denen Antibiotika kaum oder gar nicht mehr wirken.
Im Schnitt weist ein Drittel der Hähnchenfleischproben aus insgesamt fünf EU-Staaten (DE,
ES, FR, NL, PL) Krankheitserreger auf, die gegen Chinolone resistent sind. Diese Reserveantibiotika-
Gruppe wird von der WHO als besonders wichtig eingestuft und hat allerhöchste Priorität
für die menschliche Gesundheit. Einheitliche EU-Regeln gegen deren routinemäßigen
Einsatz in industriellen Tierhaltungen fehlen bisher. In den USA wurden Chinolone bereits
2005 für Masthühner verboten und seitdem gingen die Resistenzraten bei den Tieren deutlich
zurück.
Die EU-Kommission erwägt bis Ende 2020, die wichtigsten Antibiotika-Gruppen für Menschen
vorzubehalten, um Resistenzen gegen diese Reserveantibiotika aus Tierhaltungen zu bekämpfen.
Die vorliegenden Testergebnisse belegen die Notwendigkeit für ein EU-weites Verbot
der Reserveantibiotika in industriellen Tierhaltungen. Zugleich ist ein Systemwandel in
der Zucht und Haltung von Lebensmittel liefernden Tieren erforderlich, da tiergerechtere Verfahren
den bisherigen routinemäßigen Antibiotikaeinsatz vermeiden können. Verbraucherinnen
und Verbrauchern wird geraten, auf ökologische Produkte von Tieren aus bäuerlichen
Tierhaltungen umzusteigen, bei denen – wenn überhaupt – ganz erheblich geringere Resistenzraten
gefunden werden.
Aktualisiert: 2023-01-04
> findR *
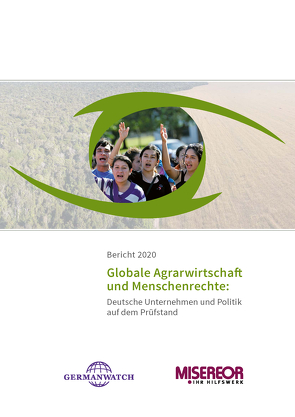
Ernährungsindustrie und Landwirtschaft gehören zu den Sektoren, in denen es weltweit am häufigsten zu Menschenrechtsverletzungen kommt. Betroffen sind Produzent*innen, Konsument*innen sowie Anwohner*innen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. In einer gemeinsamen Studie haben Germanwatch und Misereor Menschenrechtsverletzungen im Agrarsektor dokumentiert und die menschenrechtliche Sorgfalt deutscher Unternehmen analysiert. Demnach erfüllt keins der 15 untersuchten Unternehmen in ausreichendem Maße die Anforderungen der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Kritisch bewertet die Studie auch die Rolle der Bundesregierung. In der Handelspolitik habe sie es bislang versäumt, die Rolle von Menschenrechten zu stärken. Zugleich sind deutsche Unternehmen bislang nicht gesetzlich verpflichtet, die Menschenrechte bei ihrer weltweiten Geschäftstätigkeit zu achten – anders als in einigen europäischen Nachbarländern. Allerdings haben aufgrund des schlechten Abschneidens deutscher Unternehmen beim Monitoring ihrer menschenrechtlichen Sorgfalt die Bundesminister für Arbeit und Soziales sowie für Entwicklung im Dezember 2019 Eckpunkte für ein deutsches Lieferkettengesetz angekündigt.
Zudem gibt es in Deutschland noch keinen ausreichenden Zugang zu Abhilfe für Betroffene von Menschenrechtsverletzungen. Grund ist einerseits die mangelnde Grundlage im deutschen Recht, andererseits gibt es viele prozessuale Hürden. Aber auch das außergerichtliche staatliche Beschwerdeverfahren über die Nationale Kontaktstelle für die OECD-Leitsätze weist erhebliche Mängel auf.
Aktualisiert: 2023-01-04
> findR *
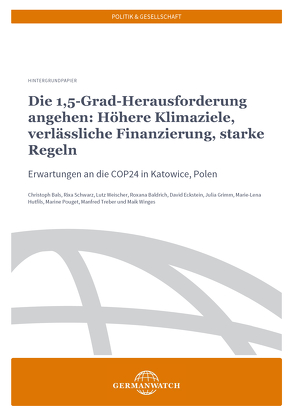
Auf dem diesjährigen Klimagipfel COP24 in Katowice vom 2.-14. Dezember 2018 sollen die
Vertragsstaaten die Umsetzungsregeln für das Paris-Abkommen beschließen. Auch Nachbesserungen
im Klimaschutz und verlässlichere Klimafinanzierung stehen auf der Agenda.
Die Staaten treffen sich zu einem für die Klimapolitik entscheidenden Zeitpunkt. Die Auswirkungen
des Klimawandels nehmen spürbar zu – der Hitzesommer 2018 war in vielen Teilen
der Erde zu erfahren. Der Weltklimarat IPCC formulierte in seinem jüngst veröffentlichten
Bericht mit neuer Dramatik, dass nur noch wenige Jahre Zeit bleiben, um die Klimakrise in
den Griff zu kriegen. Doch die internationale Staatengemeinschaft ist nicht zuletzt wegen der
US-Regierung gehemmt. Auch in Deutschland hat die Regierung jahrelang nicht genug dafür
getan, die Klimaziele zu erreichen. Es formiert sich eine starke Klimabewegung am Hambacher
Wald und anderswo. Aber auch die fossilen Energieversorger kämpfen um ihre Geschäftsmodelle.
Deutschland steht vor einem Entscheidungsmoment – viele Augen werden
sich von Katowice aus auf die Kohlekommission richten.
Dieses Hintergrundpapier zeigt die wichtigsten erforderlichen Beschlüsse von Katowice und
die politischen Streitpunkte dazu auf – v. a. in den Bereichen Ambitionssteigerung, Klimafinanzierung,
Transparenz, sowie Anpassung und klimawandelbedingte Schäden und Verluste.
Aktualisiert: 2023-01-04
Autor:
Roxana Baldrich,
Christoph Bals,
David Eckstein,
Julia Grimm,
Marie-Lena Hutfils,
Marine Pouget,
Stefan Rostock,
Rixa Schwarz,
Manfred Treber,
Lutz Weischer,
Maik Winges
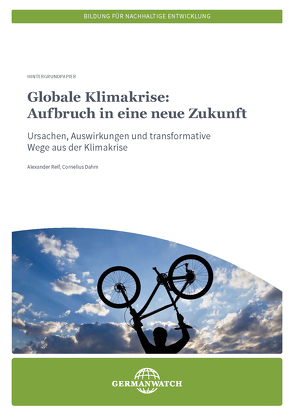
Die globale Klimakrise ist längst keine theoretische Möglichkeit mehr, die sich aus den Berechnungen von Computermodellen ergibt. Sie ist ein gefährliches Spiel mit dem Feuer, das sich jetzt auf unserem Planeten abspielt und in Zukunft noch stärkere Auswirkungen haben wird (Kapitel 2 und 4). Diese Publikation erläutert
Ursachen (Kapitel 3) und Folgen (Kapitel 4-6) des Klimawandels und erläutert, warum wir uns bereits inmitten einer Klimakrise befinden.
Die gesamte Weltgemeinschaft steht vor der großen Herausforderung, einen gefährlichen Klimawandel zu verhindern, also den globalen Temperaturanstieg, wie im Pariser Klimaabkommen 2015 vereinbart, auf maximal
2 °C im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen und Anstrengungen zu unternehmen, ihn auf unter 1,5 °C zu halten. Der Kampf gegen die Klima-
krise durch Klimaschutzmaßnahmen (Mitigation), Anpassung
(Adaptation) und der Umgang mit Schäden und Verlusten (Loss and Damage) ist insbesondere für die Hauptbetroffenen überlebenswichtig (Kapitel 7).
Um die Klimakrise zu bewältigen, müssen weltweit gesellschaftliche und politische Lösungsstrategien entwickelt
und umgesetzt werden (Kapitel 8). Besonders in Zeiten dynamischer Umbrüche und gesellschaftlicher
Entwicklungen gilt es, demokratische, kooperative
und multilaterale Handlungsperspektiven zu stärken (Kapitel 9). Kapitel 10 stellt zahlreiche transformative
Strategien für das Ende der Klimakrise vor. Kapitel 11 erläutert die Notwendigkeit eines Kultur- und Wertewandels, der Klima- und Umweltschutz, Solidarität und Gerechtigkeit, Gemeinwohl und Genügsamkeit sowie
die Menschenrechte in den Mittelpunkt rückt.
Aktualisiert: 2023-01-04
> findR *

Reparatur hat einen schwerenStand und droht immer weiter ins Hintertreffen zu geraten. In den USA wollten sich AktivistInnen damit nicht zufrieden geben und haben einen alternativen Gesetzesvorschlag entwickelt. Der in mittlerweile 17 Bundesstaaten eingereichte Right to Repair-Gesetzesvorschlag hat sowohl in den USA als auch in Europa und Deutschland große Aufmerksamkeit erhalten. Mit konkreten Vorschlägen sollen die Rahmenbedingungen für die Reparatur verbessert werden, speziell die Verfügbarkeit von Ersatzteilen, Reparaturanleitungen, Werkzeug und Diagnose-Software für einzelne VerbraucherInnen, TüftlerInnen in der freien Reparaturszene und auch für professionelle Werkstätten. Zurückkgreifen kann die Bewegung auf Erfahrungenaus dem Kfz-Sektor und dem Agrar-Sektor. In diesem Paier wird der US-Right to Repair Act genauer analysiert. Wir betrachten den Entstehungskontext in den USA, untersuchen den Inhalt auf Erfolgsfaktoren und ergründen, inwieweit eine ähnliche Lösung für Deutschland und die EU sinnvoll sein könnte.
Aktualisiert: 2023-01-04
> findR *
Entscheidend für die Energiewende sind vor allem die Rahmenbedingungen, denn der Rahmen
bildet eine Basis für die für Investitionen benötigte Planungssicherheit und beeinflusst
die Profitabilität von Geschäftsmodellen. Diese Studie adressiert den Zusammenhang zwischen
Rahmenbedingungen und Geschäftsfeldern im Strom- und Energiesektor aus der
früheren (Atom und Kohle) sowie der jüngeren Vergangenheit (Erneuerbare Energien). Sie
zeigt, dass in Deutschland „neue“ Energieformen immer zunächst von der Regierung subventioniert
wurden.
Aktualisiert: 2023-01-04
> findR *
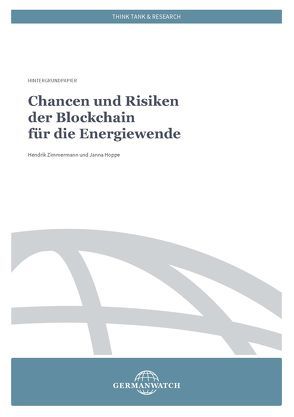
Die Blockchain, eine Art gemeinsam geschriebenes, digitales Buch, ist eine Transaktionstechnologie,
die in den nächsten Jahren zahlreiche Branchen grundlegend verändern könnte.
Nicht selten wird ihr das Potenzial zugesprochen, die Welt in gleichem Ausmaß zu verändern,
wie es ab 1990 das Internet getan hat. Blockchain-Anwendungen setzen auf dezentrale
Peer-to-Peer-Netzwerke, Kryptografie und Spieltheorie und versprechen neben Transparenz
und Manipulationssicherheit ein signifikantes Kostensenkungspotenzial, indem Intermediäre
durch Software-Lösungen ersetzt werden. Dies könnte etablierte Dienstleister wie Banken,
Notariate oder Börsen in vieler Hinsicht obsolet machen und die Art und Weise ändern, in
denen zwei und mehr Personen weltweit interagieren.
Auch der Energiesektor ist von diesen Veränderungen betroffen und erste Start-ups zeigen,
dass Stromhandel zwischen Privatpersonen ohne ein beteiligtes Energieunternehmen denkund
machbar ist. Ferner kann die Blockchain eingesetzt werden, um Speichertechnologien
in dezentrale Energiesysteme einzubinden, die Balancierung von Angebot und Nachfrage zu
vereinfachen, Ladungen und Abrechnungen im Bereich der Elektromobilität automatisiert
durchzuführen oder die Echtheit von Grünstromzertifikaten zu gewährleisten.
Neben Funktionsweise, möglichen Anwendungsbereichen und entsprechenden Chancen,
zeigt dieses Hintergrundpapier auch auf, welche Risiken adressiert werden müssen und wo
noch Handlungsbedarf in der Entwicklung der Technologie liegt. So kann ein Blockchain-
Netzwerk zum Beispiel nur mithilfe einer immensen Rechenleistung aufrechterhalten werden,
die in einem hohen Energieverbrauch und damit einhergehendem ökologischen Rucksack
resultiert. Auch ist die Blockchain-Technologie ungeeignet, um große Mengen an Daten
zu speichern und zudem für viele Einsatzmöglichkeiten noch zu langsam. Ebenso ist der
Rechtsrahmen unklar und die Frage nach Datenschutz und Transparenz muss auch in diesem
Kontext neu gestellt und berücksichtigt werden.
Die Energiewende könnte durch Blockchain-Technologien eine neue Dynamik entfalten. Die
Blockchain hat das Potential, Machtstrukturen und Rollen in der Energielandschaft zu verändern.
Auch dies birgt Chancen und Risiken. Wer sich mit Substanz in die politische, ökonomische
und technologische Gestaltung dieses Zukunftsthemas einbringen möchte, sollte
sich mit dem Thema Blockchain jetzt beschäftigen.
Aktualisiert: 2023-01-04
> findR *
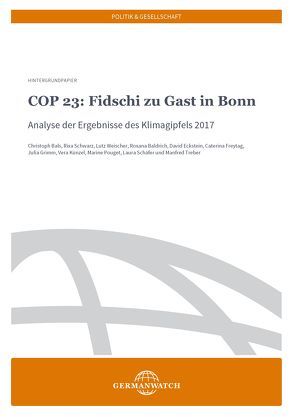
Die Weltklimakonferenz COP 23 tagte vom 6. bis in die frühen Morgenstunden des 18. November
2017 in Bonn unter der Präsidentschaft von Fidschi. Der vielleicht größte Erfolg der
COP 23 ist der sogenannte Talanoa-Dialog 2018, der die erste Nachbesserungsrunde der
nationalen Klimapläne bis 2020 festlegt. Die Erwartung ist nun, dass sich die großen Emittenten
nächstes Jahr im Dezember dazu bekennen, ihre Ziele für die eigene Emissionsminderung
und für die Unterstützung ärmerer Länder für 2030 zu erhöhen. Im Zentrum der Verhandlungen
stand die Ausgestaltung der Umsetzungsregeln des Paris-Abkommens. Hier
erreichte die COP 23 nur die allernötigsten Fortschritte. Viele Schlüsselfragen bleiben für den
Beschluss der Umsetzungsregeln auf der COP 24 im polnischen Katowice im Dezember 2018
noch offen.
Deutschland geriet durch die COP 23 im eigenen Land nicht nur durch die sehr legitimen
Forderungen der Entwicklungsländer zu den Verpflichtungen der Industriestaaten für die Zeit
vor 2020 und Klarheit über zukünftig an sie zu zahlende Klimafinanzierung unter Druck. Die
20 Mitgliedsländer der Anti-Kohle-Allianz (Powering Past Coal) etwa verpflichten sich, in den
nächsten Jahren oder spätestens 2030 vollständig aus der Kohleverstromung auszusteigen.
In dieser von Großbritannien, Kanada und den Marschall-Inseln initiierten Allianz fehlt
Deutschlands Mitgliedschaft. 2018 braucht entschlossene Entscheidungen zum Kohleausstieg,
zur Finanzierung Erneuerbarer statt fossiler Energien, zu Anpassungsmaßnahmen und
dem Schutz der bereits vom Klimawandel Betroffenen. Ein neues System geteilten Leaderships
in der internationalen Klimapolitik muss sich 2018 weiter entwickeln und bewähren.
Deutschland kann und sollte dabei eine Rolle spielen – aber das erfordert endlich die ernsthafte
Umsetzung eingegangener internationaler Verpflichtungen im eigenen Land.
Aktualisiert: 2023-01-04
Autor:
Roxana Baldrich,
Christoph Bals,
David Eckstein,
Caterina Freytag,
Julia Grimm,
Vera Künzel,
Marine Pouget,
Laura Schäfer,
Rixa Schwarz,
Manfred Treber,
Lutz Weischer
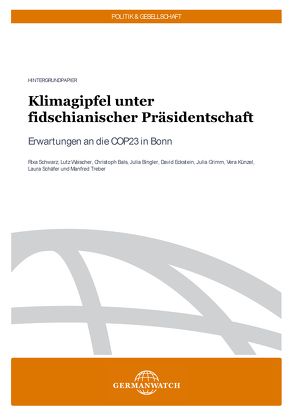
Das Paris-Abkommen ist seit einem knappen Jahr in Kraft, aber wie seine Umsetzung konkret gestaltet werden soll, wird weiterhin zwischen den Vertragsstaaten verhandelt. Diese Umsetzungsrichtlinien sollen 2018 final verabschiedet werden. Die Erarbeitung eines entsprechenden Textentwurfs ist das zentrale Ziel des Klimagipfels COP23, der vom 6. bis 17. November in Bonn tagen wird. Erstmalig wird mit Fidschi ein pazifisches Land und ein Mitglied der Allianz der kleinen Inselstaaten den Vorsitz eines Klimagipfels haben.
Abgesehen von den Umsetzungsrichtlinien werden für Fidschi der visionäre Charakter der COP23, Verschränkungen mit der Agenda 2030, Ozeane und der Talanoa-Spirit für den Dialog mit allen Interessensgruppen im Zentrum stehen.
Dieses Hintergrundpapier zeigt auf, welche Entscheidungen in Bonn verhandelt und vorbereitet werden – v. a. in den Bereichen Transparenz, Ambitionssteigerung, Klimafinanzierung sowie Anpassung und klimawandelbedingte Schäden und Verluste.
Aktualisiert: 2023-01-04
> findR *
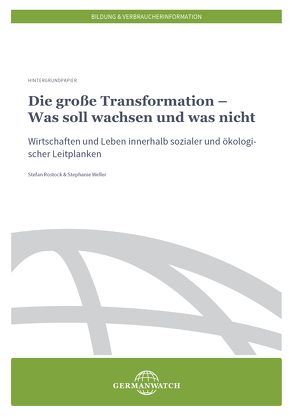
Schon seit Beginn der umwelt- und entwicklungspolitischen Arbeit stellen sich dort Fragen,
die eng mit den Grundfragen des Wirtschaftens verbunden sind. In den letzten Jahren ist die
Frage des Wirtschaftswachstums stärker in den Blick gerückt. Mit dieser Broschüre zeigt
Germanwatch einige der Hintergründe und Grundpositionen und diskutiert mögliche
Schlussfolgerungen für zivilgesellschaftliche Akteure. Es werden die wichtigsten Gründe, die
für und gegen die Notwendigkeit von Wirtschaftswachstum sprechen, diskutiert. Da Wachstum
derzeit oft als Notwendigkeit gesehen wird, soll es im zweiten Kapitel um Wirtschaftswachstum
als Paradigma gehen. Es wird genauer geschaut, was darf – aus sozialer und ökologischer
Sicht – wachsen und was nicht. Ziel ist es hier, die Verhärtungen in der Debatte
aufzubrechen und „Wachstum“ als leeres Wahlkampfschlagwort zu hinterfragen. Da der
Rebound-Effekt ein zentraler Punkt der Wachstumsdebatte ist, hat dieser ein eigenes Kapitel
bekommen. Außerdem werden noch die Themen Bevölkerungswachstum sowie Ungleichverteilung
und Abstiegsängste aufgegriffen. Es werden Konzepte aus dem globalen Süden
vorgestellt, die Anregungen für alternative Politik geben können. Im dritten Kapitel der Broschüre
werden Lösungsansätze behandelt. So werden Resonanzen, die Konzepte Degrowth,
Postwachstum, Suffizienz und Green Growth vorgestellt und es geht außerdem um soziale
Sicherungssysteme und Arbeit in einem System ohne Wachstum sowie um Suffizienzpolitik.
Ferner werden Herausforderungen für zivilgesellschaftliche Handlungsoptionen dargelegt.
Die Broschüre soll zivilgesellschaftlichen Akteuren Mut machen, sich in die Wachstumsdebatte
einzumischen und die Frage: „Wie wollen wir leben?“ stärker über Milieugrenzen hinweg zu
diskutieren.
Aktualisiert: 2023-01-04
> findR *

In den letzten drei Jahren hat die Debatte zu Wirtschaft
und Menschenrechten ein neues Niveau erreicht. Mit den
UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind
seit 2011 alle Staaten aufgefordert, diese auf nationaler
Ebene umzusetzen. In Deutschland stand seit 2014 der
Nationale Aktionsplan (NAP) im Mittelpunkt, den die Bun-
desregierung nach zweijährigem Konsultationsprozess im
Dezember 2016 verabschiedet hat. Gleichzeitig gab es Im-
pulse durch neue EU-Richtlinien und die Verhandlungen
über ein UN-Menschenrechtsabkommen zu transnatio
-
nalen Konzernen und anderen Unternehmen. In Kapitel 2
analysieren die Autor/-innen diese allgemeinen Entwick
-
lungen im Themenfeld Wirtschaft und Menschenrechte,
die auch den Rahmen für die anschließende Betrachtung
des Energiesektors bilden. Mit der Energiewirtschaft steht
ein Sektor im Mittelpunkt dieses Berichts, der starke glo
-
bale Bezüge aufweist und immer wieder mit Menschen-
rechtsverletzungen in Verbindung gebracht wird. Die Stu-
die geht der Frage nach, inwieweit deutsche Unternehmen
und die Bundesregierung die Anforderungen der UN-Leit
-
prinzipien bislang umsetzen.
Aktualisiert: 2023-01-04
> findR *
Das Klimaabkommen von Paris tritt weniger als ein Jahr nach seiner Verabschiedung bereits
am 4. November 2016 in Kraft. Der vom 7. bis 18. November 2016 stattfindende Klimagipfel
COP 22 in Marrakesch ist ein guter Anlass, ein Zwischenfazit zu ziehen und zu betrachten, wo
die internationale Klimapolitik steht. Dieses Hintergrundpapier zeigt auf, welche Entscheidungen
in Marrakesch zu erwarten sind – im Bereich Transparenz, Steigerung der Ambition, Klimafinanzierung
sowie Anpassung und klimawandelbedingte Schäden.
Aktualisiert: 2023-01-04
> findR *
Der zunehmende Anbau von Soja ist weiter einer der wichtigsten Treiber von Umweltzerstörung
und Landvertreibung in Lateinamerika. Dabei gibt es Alternativen zur sojabasierten
Fütterung. Bohnen, Erbsen, Kleegras und andere Leguminosen können Stickstoff aus
der Luft binden und sich damit selbst sowie benachbarte Pflanzen düngen. Ihr regelmäßiger
Anbau hilft dabei, Mineraldünger einzusparen und die Bodenqualität zu verbessern.
Diese Pflanzen können Soja gut als Eiweißfutter ersetzen, wenn die Kühe keine Höchsterträge
bei der Milch- und Fleischleistung bringen müssen. Gerade in Zeiten der durch Überproduktion
verursachten Preiskrise bei Milch und Schweinefleisch bietet eine regionale,
artgerechtere Fütterung ein Argument, um die Erzeugnisse zu höheren Preisen vermarkten
zu können. Gleichzeitig lässt sich die Produktion begrenzen.
Aktualisiert: 2023-01-04
> findR *
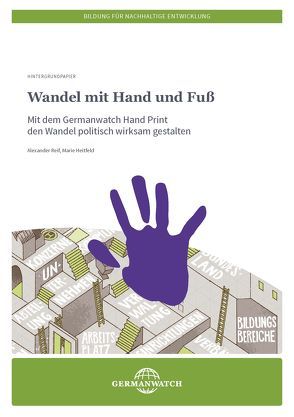
Wir wissen, dass wir einen Wandel hin zur Nachhaltigkeit
brauchen. Wir wissen, warum wir ihn wollen. Wir haben genügend Ideen und Vorstellungen darüber, was sich ändern soll. Das Wissen und Bewusstsein über die Notwendigkeit einer nachhaltigen Entwicklung ist in unserer Gesellschaft vorhanden, und dennoch ist konsequentes
Verhalten nach diesem Prinzip eher selten und im Alltag nur schwer umzusetzen. Welche Ursachen stecken dahinter und wie können wir den Wandel aktiv vorantreiben? Oft werden in der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) und im Globalen Lernen die zugrundeliegenden
strukturellen Rahmenbedingungen, die zukunftsfähige und nachhaltige Lebensweisen bisher verzögern oder verhindern, nicht ausreichend thematisiert.
Der Germanwatch Hand Print ist ein Konzept für BNE-AkteurInnen, die genau hier ansetzen möchten. Er ermutigt
sie, verstärkt einmischende und in reale Strukturen hineinwirkende Formen des Engagements zu nutzen. Nach dem Motto „Strukturen verändern, Wandel gestalten“
fokussiert er auf strukturveränderndes und politisches Engagement. Denn man hat einen wesentlich größeren Hebel, um den Wandel voranzubringen,
wenn man gemeinsam an diesen beiden Strängen zieht. Der Germanwatch Hand Print ist für Aktive und Engagierte konzipiert, die den Wandel mitgestalten wollen. Der Ansatz soll sie in ihrem Engagement unterstützen.
Die vorliegende Broschüre ist insbesondere für Bildungs-
MultiplikatorInnen aus den Bereichen Globales Lernen und Bildung für nachhaltige Entwicklung gedacht, die eben solche aktiven Menschen ansprechen oder in Organisationen, (Jugend-)Verbänden und Initiativen
zielgruppenspezifische (Bildungs-)Arbeit leisten. Sie stellt die Idee des Hand Prints vor, erläutert zentrale
strukturelle Herausforderungen auf dem Weg zur Nachhaltigkeit und ermutigt dazu, diese Strukturen auch in der eigenen Bildungsarbeit zu hinterfragen und zu adressieren. Der lösungs- und handlungsorientierte Ansatz hat für die eigene BNE-Arbeit den Anspruch,
vom Wissen zum Handeln und vom Handeln zum Wandel zu gelangen.
Aktualisiert: 2023-01-04
> findR *
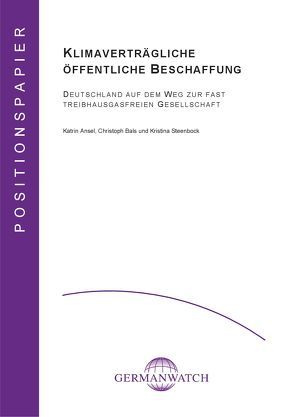
Klimaverträgliche Beschaffung ist ein wichtiger Baustein des großen Strukturwandels,
der notwendig ist, damit Deutschland seinen angemessenen Beitrag
leisten kann, die Erderwärmung im globalen Durchschnitt gegenüber dem vorindustriellen
Zeitalter auf unter 2 Grad Celsius zu begrenzen. Sie ist zudem eine
Maßnahme, die Lösungen sowohl für den Klimaschutz als auch für die Ökonomie
vereint: Strategischer und intelligenter Einkauf kann neue Technologien pushen,
Arbeitsplätze schaffen und die öffentlichen Kassen entlasten.
Trotz einiger guter Ansätze sowohl auf der gesetzlichen wie auch auf der Umsetzungsebene
wird die enorme Marktmacht der öffentlichen Hand in Deutschland
noch unzureichend genutzt. Germanwatch fordert daher insbesondere die Bundesregierung,
aber auch die Bundesländer und die Kommunen dazu auf, die öffentliche
Beschaffungspraxis mit den nationalen Klimaschutzzielen abzustimmen
und zielführende Maßnahmen zu entwickeln, damit klimaverträgliche energieeffiziente
Beschaffung zur Regel wird. Das vorliegende Positionspapier führt in die
Potentiale der klimaverträglichen Beschaffung und den Umsetzungsstand in
Deutschland ein, zeigt Hemmnisse auf und liefert Vorschläge für verbesserte
Rahmenbedingungen und Umsetzungsinstrumente.
Es wäre wünschenswert, wenn dieses Thema in der energie- und klimastrategischen
Debatte der nächsten Monate in Deutschland - auch in Form von parteiübergreifenden
Initiativen - eine gewichtige Rolle spielen würde.
Aktualisiert: 2023-01-04
> findR *

Die vorliegende Studie ist eine weitere Fortschreibung und Neubearbeitung unserer Studien zur
deutschen „Offiziellen Entwicklungsunterstützung“ (ODA) von 2005 und 2008. Grundlage für
den Text sind die langen Reihen in Statistiken und Grafiken im hinteren Teil, deren Daten
vorwiegend vom DAC/OECD, dem Statistischen Bundesamt und aus dem Internetangebot des
BMZ stammen. Die deutsche und europäische Diskussion zum Thema ist eingebaut. Der
Schwerpunkt liegt auf den ausreichenden Zusagen (Verbalität) und den weit dahinter zurückbleibenden
Leistungen (Realität) der deutschen Seite. Für den „Erfolg“ von Entwicklungsanstrengungen
ebenso wichtige Themen wie Good Governance oder Korruption(sbekämpfung)
treten in den Hintergrund. Die Studie beschäftigt sich überwiegend mit deutschem und europäischem
Erfolg und Versagen, weniger mit dem der Entwicklungsländer.
Der Anstieg der ODA-Quote aus dem Loch von 1998 (0,26%) auf 0,35% im Jahr 2005 war fast
ausschließlich auf den steilen Anstieg der Schuldenerlasse zurückzuführen, 2006 bis 2008
(0,38%) stiegen daneben auch die entwicklungsrelevanten Mittel aus dem BMZ-Haushalt, die
auch verhinderten, dass es 2009 einen zu starken Rückfall gab (0,35%). Einen Zuwachs wird es
nach 2010, wenn überhaupt nur noch in sehr bescheidenem Maße geben, es sei denn, die Hoffnungen
auf die Finanztransaktionssteuer erfüllten sich - und ein relevanter Teil von deren Erträgen
würde wirklich in die EZ fließen. Das Zwischenziel von 0,51% für 2010 ist von Minister
Niebel bereits als „unerreichbar“ bezeichnet worden, das seit nunmehr 40 Jahren von (fast)
allen Parteien und allen Bundesregierungen immer wieder versprochene 0,7%-Ziel für 2015 ist
stark gefährdet.
Das Ärgernis „Studienplatzkosten“ ist nur geringfügig kleiner geworden und die von uns 2008
noch als „Gefahr“ bezeichnete ODA-Anrechnung der Klimakosten ohne Erhöhung der Quote
ist Realität. Das ist so nicht akzeptabel.
Aktualisiert: 2023-01-04
> findR *
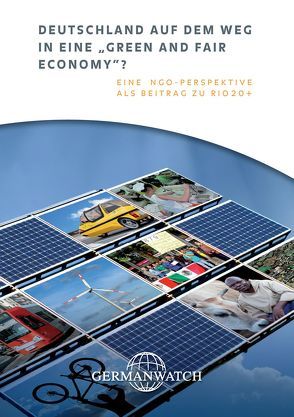
Ziel dieses Hintergrundpapiers ist es, die Green-
Economy-Debatte aus NGO-Perspektive zu beleuchten
und damit die deutsche Debatte im Rahmen des
„Rio20+”-Prozesses zu stimulieren.
Deutschland ist zusammen mit der EU ein bedeutender
Akteur im „Rio20+”-Prozess, u. a. weil mit
dem Atomausstieg und den Beschlüssen zur Energie-
wende in unserem Land einige bedeutsame
Transformationsprozesse
hin zu einer „Green and Fair
Economy“ bereits begonnen haben. Es ist wichtig,
dass Deutschland die Debatte rund um den UNGipfel
im Juni 2012 mit einer kohärenten Nachhaltigkeits-
und Green-Economy-Strategie bereichert.
Dieses Papier führt in die deutsche und internationale
Debatte ein, macht den Versuch einer
Begriffsklärung und formuliert Erwartungen an den
„Rio20+”-Gipfel. Zu vier zentralen Handlungsfeldern
– Nachhaltigkeitsstrategie, Klima und Energie,
Landwirtschaft
und Unternehmensverantwortung –
formuliert Germanwatch basierend auf seiner langjährigen
Expertise konkrete Politikvorschläge, die
sich an die Akteure in der deutschen Politik richten.
Die Rolle der Wirtschaft für den Umbau zu einer
„Green and Fair Economy“ wird dabei in besonderer
Weise diskutiert.
Fortschritte auf dem Weg zur Green Economy erscheinen
aus Sicht von Germanwatch nur möglich,
wenn bestimmte Akteure mit entschiedenem Han-
deln voranschreiten und wenn erfolgreich über Rahmensetzungen
verhandelt wird. Gleichzeitig benötigen
wir neue Allianzen zwischen Staaten, innovativen
Unternehmen oder Kommunen, die das Handeln
und Verhandeln vorantreiben.
Aktualisiert: 2023-01-04
> findR *

Unsere Welt ist derzeit von großen Machtverschiebungen gekennzeichnet. In dieser
Situation findet im südafrikanischen Durban vom 28.11. bis 9.12.2011 ein Klimagipfel
statt, der mit entscheidet, welchen Weg die internationale Klimapolitik in Zukunft einschlagen
wird.
Wird es in Zukunft ein internationales, rechtlich verbindliches Klimaregime geben?
Die EU und einige relativ progressive Industrieländer halten mit der Entscheidung für
eine zweite Verpflichtungsperiode des Kioto-Protokolls ab 2013 (oder zumindest für
den Beschluss, die Kyoto-Regeln mit den Cancún-Zielen für 2020 weiterzuführen) die
Lokomotive für entsprechende Entscheidungen in der Hand. Die Gleise, auf die die
Lokomotive gesetzt werden soll, sind aber ein Mandat aller Staaten, also auch der anderen
Industrie- und Schwellenländer, möglichst bis 2015 zu einem rechtlich verbindlichen
Abkommen zu gelangen. Wenn beide zusammenkommen, Lokomotive und
Gleise, würde das die Tür aufstoßen für eine neue Phase der internationalen Klimapolitik,
jenseits überkommener Nord-Süd-Muster. Eng verknüpft damit ist die Frage der
Überprüfung („Review“) und Schließung der Lücke zwischen dem im mexikanischen
Cancún (Klimagipfel 2010) erstmals international beschlossenen Zwei-Grad-Limit
und den ebenfalls dort vereinbarten – noch rechtlich unverbindlichen – Klimaschutzzielen.
Diese großen Zukunftsfragen um das Kioto-Protokoll und die Perspektive für
ein rechtlich verbindliches Gesamtabkommen werden die Debatten in Durban
bestimmen.
Das zweite zentrale Thema ist die Klimafinanzierung. Insbesondere die Frage, ob es
gelingt, den im Grundsatz vor einem Jahr beschlossenen Green Climate Fund umsetzungsfähig
auf die neu gelegten Schienen zu setzen, ist dabei zentral. Er könnte ein
Kernstück der neuen internationalen Klimaarchitektur werden. Denn nach dem Kopenhagener
Gipfel von 2009 ist es verfehlt, diese nur an den Ergebnissen der Klimagipfel
(den Orten des Verhandelns) zu messen. Mindestens ebenso viel Dynamik
kommt vom Handeln einzelner Staaten (etwa Energiewende) oder von Koalitionen
zwischen Vorreitern. Der Green Climate Fund soll insbesondere transformatives Handeln
im Bereich Klima- und Regenwaldschutz sowie Anpassung finanzieren und damit
einhergehend innovative Koalitionen erlauben. Auch auf der Umsetzungsebene
sind wichtige Beschlüsse zu den Vereinbarungen von Cancún zu erwarten, die solche
Kooperationen unterstützen.
Dieses Hintergrundpapier skizziert zentrale Debatten für den Klimagipfel in Durban
und benennt aus Sicht von Germanwatch Erwartungen an ein realisierbares und klimapolitisch
ausreichend ambitioniertes Ergebnis.
Aktualisiert: 2023-01-04
> findR *
Der UN-Klimagipfel in Bali (Dezember 2007) hat einerseits Verhandlungen eingeleitet,
die bis 2009 zu einem neuen internationalen UN-Klimaabkommen führen sollen.
In vier großen Verhandlungspaketen soll um 1. Treibhausgasreduktion, 2. Anpassung
an den Klimawandel, 3. Technologietransfer und 4. Finanzierung für Klima- sowie
Wälderschutz und Anpassung verhandelt werden. Andererseits hat der Gipfel auch
verdeutlicht, wie groß die Hürden noch sind für ein Abkommen, das wirklich im
kommenden Jahrzehnt eine internationale Klimawende einleitet. Hierzu muss sich
noch viel an politischem Willen bilden, um wirklich kritische Bereiche – vom Verkehr
bis zur Kohle – anzugehen. Ohne eine aktive Zivilgesellschaft ist unwahrscheinlich,
dass dies gelingt.
Aktualisiert: 2023-01-04
> findR *
inwieweit die MDGs bis zum Jahr 2015 erreicht werden
können. Auch für die Zeit danach sind die Folgen des
Klimawandels entscheidende Rahmenbedingungen für
die Entwicklungsperspektive von Millionen von Menschen.
Die vorliegende Publikation fasst die wesentlichen
Ergebnisse einer ausführlichen Analyse zu diesem
Thema zusammen. Sie benennt beispielhaft Handlungsmöglichkeiten
für die Politik und verschiedene
andere Akteure.
Die Millennium-Entwicklungsziele (MDGs) sind zur
zentralen Messlatte internationaler Entwicklungszusammenarbeit
und Armutsbekämpfung geworden. Sie
sind in doppelter Weise mit dem globalen Klimawandel
verknüpft: Zum einen leisten Fortschritte beim Erreichen
der MDGs einen wesentlichen – wenn auch oft
nicht hinreichenden – Beitrag zum Abbau der Verletzlichkeit
gegenüber den unvermeidbaren Folgen des
Klimawandels. Zum anderen wird das Ausmaß der
Klimaveränderungen mit darüber entscheiden, ob und
Aktualisiert: 2023-01-04
> findR *
MEHR ANZEIGEN
Oben: Publikationen von Germanwatch Nord-Süd Initiative e.V.
Informationen über buch-findr.de: Sie sind auf der Suche nach frischen Ideen, innovativen Arbeitsmaterialien,
Informationen zu Musik und Medien oder spannenden Krimis? Vielleicht finden Sie bei Germanwatch Nord-Süd Initiative e.V. was Sei suchen.
Neben praxiserprobten Unterrichtsmaterialien und Arbeitsblättern finden Sie in unserem Verlags-Verzeichnis zahlreiche Ratgeber
und Romane von vielen Verlagen. Bücher machen Spaß, fördern die Fantasie, sind lehrreich oder vermitteln Wissen. Germanwatch Nord-Süd Initiative e.V. hat vielleicht das passende Buch für Sie.
Weitere Verlage neben Germanwatch Nord-Süd Initiative e.V.
Im Weiteren finden Sie Publikationen auf band-findr-de auch von folgenden Verlagen und Editionen:
Qualität bei Verlagen wie zum Beispiel bei Germanwatch Nord-Süd Initiative e.V.
Wie die oben genannten Verlage legt auch Germanwatch Nord-Süd Initiative e.V. besonderes Augenmerk auf die
inhaltliche Qualität der Veröffentlichungen.
Für die Nutzer von buch-findr.de:
Sie sind Leseratte oder Erstleser? Benötigen ein Sprachbuch oder möchten die Gedanken bei einem Roman schweifen lassen?
Sie sind musikinteressiert oder suchen ein Kinderbuch? Viele Verlage mit ihren breit aufgestellten Sortimenten bieten für alle Lese- und Hör-Gelegenheiten das richtige Werk. Sie finden neben