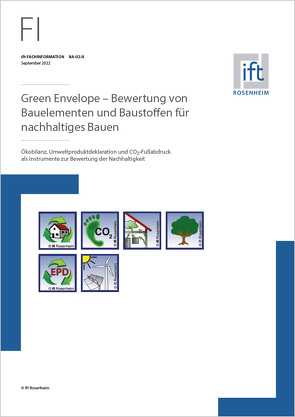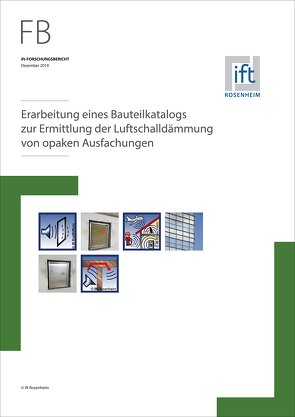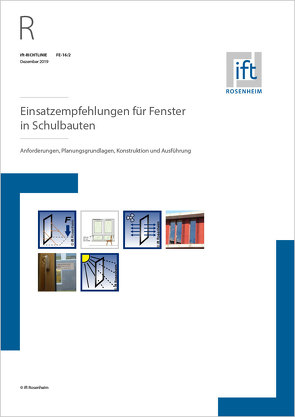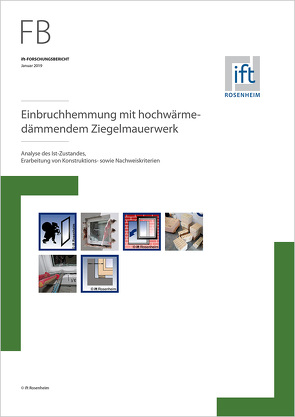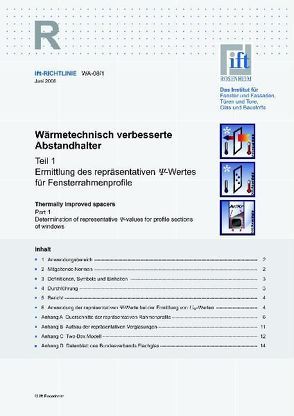Praktisch alle Bauwerke benötigen für ihre Nutzung Öffnungen, die aus Gründen des Komforts, Sicherheit, Schall- oder Wärmedämmung verschließbar sein sollen. Hierfür dienen seit frühester Zeit Türen* oder Tore. Die Unterscheidung zwischen Türen und Toren folgt dem vorgesehenen Verwendungszweck: Während Tore primär dem Durchgang von Waren oder Fahrzeugen dienen, sind Türen für die Nutzung von Personen gedacht. Die frühere Orientierung an den Maßen („große Tür ist ein Tor“) erwies sich als nicht zielführend. Die Nutzung von Türen ist allgegenwärtig, und ihr Komfort wie auch ihre Dauerhaftigkeit und universelle Nutzung wird ganz wesentlich bereits in der Planungsphase festgelegt. Grundlage einer erfolgreichen Planung und Auswahl geeigneter Komponenten muss stets die zu erwartende Nutzung des Gebäudes bzw. der Räume sein.
Diese ift-Richtlinie soll dem Anwender helfen, die für seine Bedürfnisse passende Tür auszuwählen. Dabei geht es in dieser Richtlinie um die technischen („Leistungs-“)Merkmale einer Innentür. Daneben stehen optische Merkmale wie z.B. Oberfläche, Geometrie oder Design, die gesondert zu betrachten sind.
Aktualisiert: 2023-05-18
> findR *

Praktisch alle Bauwerke benötigen für ihre Nutzung Öffnungen, die aus Gründen des Komforts, Sicherheit, Schall- oder Wärmedämmung verschließbar sein sollen. Hierfür dienen seit frühester Zeit Türen* oder Tore. Die Unterscheidung zwischen Türen und Toren folgt dem vorgesehenen Verwendungszweck: Während Tore primär dem Durchgang von Waren oder Fahrzeugen dienen, sind Türen für die Nutzung von Personen gedacht. Die frühere Orientierung an den Maßen („große Tür ist ein Tor“) erwies sich als nicht zielführend. Die Nutzung von Türen ist allgegenwärtig, und ihr Komfort wie auch ihre Dauerhaftigkeit und universelle Nutzung wird ganz wesentlich bereits in der Planungsphase festgelegt. Grundlage einer erfolgreichen Planung und Auswahl geeigneter Komponenten muss stets die zu erwartende Nutzung des Gebäudes bzw. der Räume sein.
Diese ift-Richtlinie soll dem Anwender helfen, die für seine Bedürfnisse passende Tür auszuwählen. Dabei geht es in dieser Richtlinie um die technischen („Leistungs-“)Merkmale einer Innentür. Daneben stehen optische Merkmale wie z.B. Oberfläche, Geometrie oder Design, die gesondert zu betrachten sind.
Aktualisiert: 2023-01-19
> findR *
Das Interesse am Thema Nachhaltigkeit und an nachhaltigen und energieeffizienten Gebäuden mit Nachhaltigkeitszertifikaten (DGNB, BNB, LEED oder BREEAM) nimmt ständig zu. Die Fachinformation zeigt auf, welche Möglichkeiten Hersteller von Bauprodukten wie Fenster, Fassaden, Türen, Tore und Verglasungen haben, und wie Stakeholder (z.B. Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Architekten und Gebäudezertifizierer) unterstützt werden können.
Der Begriff Nachhaltigkeit ist in aller Munde und wird deshalb auch vielfältig interpretiert. Der Duden bezeichnet nachhaltiges Handeln im ökologischen Sinn als „nur in dem Maße, wie die Natur es verträgt“. In der Praxis zielt man auf die gleichberechtigte Umsetzung von umweltbezogenen, wirtschaftlichen und sozialen Zielen, die auch als die drei Säulen der Nachhaltigkeit bezeichnet werden.
Aktualisiert: 2023-03-30
> findR *
Es handelt sich um eine gemeinschaftliche Richtlinie HFA Holzforschung Austria, Wien, des ift Rosenheim und der BFH Berner Fachhochschule, Biel, unter Mitwirkung von Frei Sicherheitsberatung mit dem Ziel, Anforderungen und einheitliche Bewertungsweisen für einbruchhemmende Produkte mit elektromechanischen Bauteilen und/oder elektronischen Berechtigungsmitteln festzulegen. Diese Richtlinie regelt jene Punkte, die aus dem Anwendungsbereich der EN 1627:2021 ausgenommen sind.
Die in dieser Richtlinie definierten Zutrittskontrollsysteme arbeiten offline, und es existieren entsprechende Normen für eine mit der Mechanik vergleichbare Sicherheit. Es sind mittlerweile auch online arbeitende Systeme sowie Smartphone-basierte System verfügbar, jedoch gibt es keine veröffentlichten Normen oder Richtlinien für die Definition von deren Sicherheit. Im Einzelfall kann ein solches System zur Zutrittsberechtigung geeignet sein.
Aktualisiert: 2023-01-26
> findR *

Abstandhalter in Isolierglassystemen haben die Aufgabe, den Zusammenbau des Isolierglases möglichst einfach und sicher zu ermöglichen und zusammen mit den anderen Komponenten über die erwartete Lebensdauer gemäß EN 1279-1 das Isolierglas dauerhaft abzudichten sowie den auf sie einwirkenden Belastungen ohne funktionsbeeinträchtigende Veränderungen zu widerstehen.
Da Abstandhalterprofile, deren letzte Lage auf dem Abstandhalterrücken als „nicht metallen“ zu beschreiben ist, derzeit nicht in den Austauschregeln der Produktnorm erfasst sind, soll für diese Gruppe ein Verfahren zur Austauschbarkeit im Sinne einer späteren Version der EN 1279-1 sowie ein Prüfszenario zur Ergänzung in EN 1279-4 beschrieben und erprobt werden.
Diese Prüfverfahren werden in der vorliegenden Richtlinie VE-17/1 beschrieben und sollen die dauerhaft gleichbleibende Qualität der Produkte sicherstellen. Sie basieren auf Rundversuchen und anderen bereits bestehenden und bewährten Richtlinien (siehe Literaturnachweis).
Aktualisiert: 2023-01-18
> findR *
Öffnungsbegrenzer werden als Komfortbauteile angeboten, sind aber in der Anwendung häufig mit einer Schutzfunktion verbunden. Die Schutzfunktion reicht dabei von der Begrenzung des Öffnungswegs, der Vermeidung des Anpralls an angrenzende Bauteile bis hin zur Absturzsicherung. Das Bauteil allein erfüllt hierbei nicht die Anforderungen an die Schutzfunktion, sondern ist nur ein Baustein zur Erlangung der Schutzziele. Deshalb stellt sich die Frage, welche Anforderungen an die kompletten Bauelemente und deren Befestigung in unterschiedlichen Anwendungen gestellt werden müssen. Eine Einsatzempfehlung für Öffnungsbegrenzer ohne Berücksichtigung der Schutzziele wird den Anforderungen des Marktes nicht gerecht. Diese Richtlinie definiert Anforderungsstufen für Fenster mit Öffnungsbegrenzung und legt fest, welche Prüfungen und Nachweise unter Berücksichtigung der zu erwartenden Beanspruchungen erforderlich sind.
Aktualisiert: 2023-01-18
> findR *

Dezentrale ins oder am Fenster integrierte Lüftungssysteme, sogenannte Fensterlüfter, evtl. in Kombination mit anderen Lüftungseinrichtungen wie z. B. Abzugshauben und Abluftanlagen, können eine nutzerunabhängige Lüftung gewährleisten. Durch den richtigen Einsatz solcher Lüftungssysteme kann eine der häufigsten Ursachen von Schimmelpilzbildung – ungenügende und falsche Lüftung – weitestgehend verhindert und damit ein Großteil an Schadensfällen vermieden werden. Fensterlüfter können auch die Verbrennungsluftversorgung von raumluftabhängigen Feuerstätten sicherstellen.
Zur Prüfung und Bewertung von Lüftungssystemen gibt es bereits eine Vielzahl deutscher und internationaler Normen, Richtlinien und Merkblättern. Der Verbraucher, Architekt und Planer ist jedoch oft mit dieser Dokumentenvielfalt überfordert und kann so die komplexe Thematik von Lüftungsplanung und Lüftungsverhalten nur schwer bewältigen. Zusätzlich sind neben den reinen lüftungstechnischen Aspekten (primäre Funktion) auch noch andere wichtige sekundäre Funktionen wie z. B. Schallschutz, Wärmeschutz, Brandschutz, Gebrauchstauglichkeit etc. bei der Planung und Nutzung von Lüftungseinrichtungen zu berücksichtigen.
Ziel dieser Richtlinie ist es, durch eine Zusammenstellung der relevanten Normen und Richtlinien sowie durch die Festlegung vereinfachter Verfahren, den Herstellern von Fensterlüftern und Fenstern eine Methode für die ganzheitliche Bewertung dieser Produkte zur Verfügung zu stellen. Der Hersteller kann auf Basis dieser Richtlinie die Leistungseigenschaften seines Produktes ermitteln und übersichtlich darstellen. Zusätzlich ermöglicht diese einheitliche Darstellung der Leistungseigenschaften von Fensterlüftern dem Verbraucher, Architekten und Planer eine übersichtliche Vergleichbarkeit der Produkteigenschaften.
Aktualisiert: 2023-01-19
> findR *

Richtiges Lüften reduziert die Gefahr von Feuchteschäden in Gebäuden und beugt damit gesundheitlichen und bauphysikalischen Problemen vor. Die kontrollierte und bewusste Lüftung gewinnt immer mehr an Bedeutung, da aufgrund höherer energetischer Anforderungen die Gebäudehüllen immer dichter ausgeführt werden. Die dadurch nicht mehr vorhandene unkontrollierte Lüftung durch Leckagen muss unter Berücksichtigung möglichst geringer Energieverluste durch andere Maßnahmen sichergestellt werden. Die neuen Lüftungsanforderungen an das Gebäude und an die Nutzer werden jedoch oft nicht ausreichend erkannt oder umgesetzt, und der erforderliche Luftwechsel kann so nicht gewährleistet werden.
Zur Planung von lüftungstechnischen Maßnahmen für Wohngebäude gilt in Deutschland DIN 1946-6:2019-12. Dezentrale ins Fenster integrierte Lüftungsgeräte oder -komponenten, sogenannte Fensterlüfter, evtl. in Kombination mit anderen Lüftungskomponenten im Gebäude wie z. B. Abluftventilatoren, können eine Lüftung nach DIN 1946-6:2019-12 gewährleisten. Durch den richtigen Einsatz solcher Lüftungsgeräte oder -komponenten kann eine der häufigsten Ursachen des Schimmelpilzwachstums – ungenügende und falsche Lüftung – weitestgehend verhindert und damit ein Großteil an Schadensfällen vermieden werden.
Ziel dieser Richtlinie ist es, Hilfestellungen und Empfehlungen für den Einsatz von Fensterlüftern zur Umsetzung einer lüftungstechnischen Maßnahme im Wohnungsbau nach DIN 1946-6:2019-12 zu geben. Neben der Erfüllung von reinen lüftungstechnischen Aspekten werden auch Empfehlungen für sekundäre Anforderungen des Fensterlüfters wie z. B. der Luftdichtheit oder des Schallschutzes gegeben.
Die für die Planung notwendigen Leistungseigenschaften von Fensterlüftern werden nach der ift-Richtlinie LU-01/2 „Fensterlüfter; Teil 1 Leistungseigenschaften“ ermittelt.
Aktualisiert: 2023-01-19
> findR *

Bei der Planung von modernen Büro- und Wohngebäuden ist vor allem im Bereich der mehrgeschossigen Bauweise i.d.R. ein Flachdach oder ein flachgeneigtes Dach mit ausgebautem Dachgeschoss vorgesehen. Um den Ansprüchen aus Wärmeschutz, Statik, Brandschutz und Schallschutz gerecht zu werden, müssen diese Dachkonstruktionen einer ganzen Reihe von Kriterien entsprechen. Auch im Bereich des Schallschutzes variieren die Ansprüche je nach Ausführung und Nutzung des Dachelementes als reines Dachelement oder als begehbare Dachterrasse.
Mangelnde Planungsdaten erschweren es gerade klein- und mittelständigen Unternehmen, zu denen sehr viele Holzbaubetriebe gehören, den Einstieg in den mehrgeschossigen Holzbau, der nicht nur aus ökologischer Sicht vorteilhaft ist. Neben den bekannten Punkten der günstigen CO2-Bilanz und des guten Wärmeschutzes gängiger Konstruktionen
in Holzbauweise, wird die Bauweise vom Bauherrn i.d.R. auch optisch und in Bezug auf die Wohnbehaglichkeit positiv eingestuft. Diese positiven Aspekte der Holzbauweise sollten nicht durch erhöhte Trittschallübertragungen durch Dachterrassen und Loggien oder starke Regengeräusche von Blechdacheindeckungen relativiert werden.
Planungsdaten, insbesondere für Konstruktionen in Holzbauweise, die den bauakustischen Ansprüchen entsprechen, sind nur sehr bedingt verfügbar. So wurden auch in der neuen DIN 4109 nur drei Aufbauten für leichte Flachdächer berücksichtigt. Geeignete Aufbauten für Dachterrassen und Loggien, sowie Konstruktionen mit Massivholzelementen
fehlen ganz. Neben den statischen und bauphysikalischen Anforderungen, werden im Bereich von Dachterrassen (wie auch für Loggien) häufig zusätzliche Vorgaben, wie Lattenroste oder Betonplatten als Gehbelag gemacht, die nur eine geringe Entkopplung ermöglichen. Auch die Zielsetzung einer möglichst niedrigen Stufe zwischen Wohnbereich und Dachterrasse im Zuge einer barrierefreien Ausführung stellt eine zusätzliche Herausforderung dar.
Die Zielsetzung des Projektes besteht daher in der Bereitstellung von Planungsunterlagen für verschiedene Konstruktionsvarianten von Flachdächern und leicht geneigten Dächern, die insbesondere den Anforderungen an den Schallschutz genügen sowie den weiteren Leistungseigenschaften wie Wärme- und Feuchteschutz entsprechen.
Der Projektansatz berücksichtigt die Optimierung von Dachelementen unter den Aspekten des Schallschutzes und der Wirtschaftlichkeit. Hierbei werden die Vorgaben der Statik, des Brandschutzes sowie des Wärme- und Feuchteschutzes (insbesondere bei Flachdächern mit Zwischensparrendämmung) berücksichtigt.
Aktualisiert: 2023-01-19
> findR *
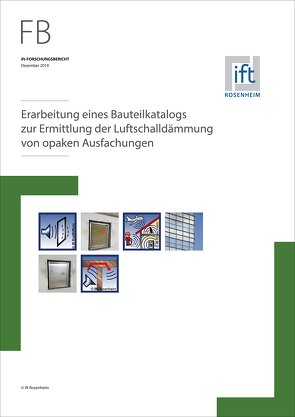
In der bauakustischen Planung von Gebäuden werden Angaben zur Luftschalldämmung von Außenbauteilen benötigt. Für opake Ausfachungen (Paneele) lassen sich solche Angaben - im Gegensatz zu transparenten Ausfachungen (Verglasungen) - derzeit nur anhand von Messungen im Labor nachweisen. Eine Möglichkeit zur Planung und Nachweisführung über ein Tabellenverfahren existiert nicht. Ziel des Vorhabens war daher die Erstellung eines solchen Bauteilkatalogs zur Planung der Luftschallschalldämmung von opaken Ausfachungen.
Der Bedarf an einem Bauteilkatalog zur Planung der Luftschalldämmung von opaken Ausfachungen hat sich im Rahmen des abgeschlossenen Forschungsvorhabens "Erarbeitung eines Bauteilkatalogs zur Ermittlung der Luftschalldämmung sowie Längsschalldämmung von Vorhangfassaden"(SWD-10.08.18.7-14.26) gezeigt [21]. Für opake Ausfachungen sind aktuell keine tabellierten bauakustischen Leistungseigenschaften in Abhängigkeit des konstruktiven Aufbaus verfügbar. Durch die Erarbeitung eines Bauteilkatalogs für opake Ausfachungen könnten für standardisierte Paneele Angaben zur Luftschalldämmung ohne Messungen nachgewiesen werden. Die so verfügbaren Informationen zu den akustischen Eigenschaften könnten dann genutzt werden, um die Luftschalldämmung des kompletten Bauelementes (Fenster- bzw. Vorhangfassade) zu bestimmen. Die noch vorhandene Lücke (fehlende Eingangsdaten der Luftschalldämmung von Paneelen) bei der Bestimmung der Luftschalldämmung von Vorhangfassaden wäre somit geschlossen. Dadurch reduziert sich der Aufwand zum Nachweis erheblich. Dies beeinflusst sowohl die Kosten als auch den zeitlichen Ablauf in der Planung. Zusätzlich erhöht sich durch eine fundierte Datenbasis die Planungssicherheit.
Basis für die Erstellung des Bauteilkatalogs sind Messdaten aus dem Archiv des ift Rosenheim sowie Daten, die bei den Industriepartnern sowie weiteren Prüfinstituten gesammelt wurden. Es ist jedoch nicht zu erwarten, dass allein durch eine statistische Analyse der vorhandenen Daten eine für die praktische Anwendung ausreichend umfassende Bauteilsammlung erstellt werden kann. Dies ist dadurch begründet, dass „relativ“ wenige Messdaten für das Bauteil opake Ausfachung vorhanden sind, da im Regelfall Paneele für konkrete Bauvorhaben gefertigt werden und die bauakustischen Eigenschaften für das komplette Bauelement; d. h. die Vorhangfassade oder das Fenster, messtechnisch ermittelt werden. Die Luftschalldämmung des Paneels alleine wird hierbei im Allgemeinen nicht ermittelt.
Aktualisiert: 2023-01-19
> findR *
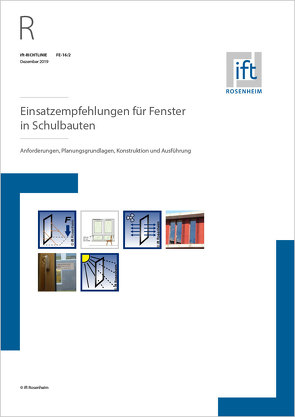
Einen nicht unerheblichen Teil seines Lebens verbringt der Mensch in Schulräumen. Egal ob es sich um Kindergärten, Grundschulen, weiterführende Schulen, Hochschulen oder Erwachsenenbildungseinrichtungen handelt, gilt der eingangs erwähnte Ausspruch von Wilhelm Busch. Ein gesundes Raumklima, Behaglichkeit und das Gefühl von Sicherheit sind entscheidende Faktoren für das Erbringen der gewünschten geistigen Leistungen. Fenster bestimmen dabei zu einem großen Teil die raumklimatischen Verhältnisse, wie Temperatur, Luftfeuchte, Licht, Ausblick nach außen etc.
Spezielle Randbedingungen in Schulen führen aber auch zu besonderen Belastungssituationen für die Bauelemente, die in der letzten Zeit zu einem deutlichen Anstieg von Reklamationen und Schäden rund um Fenster in Schulen im Sachverständigenzentrum des ift Rosenheim geführt haben. Besonders Besorgnis erregend sind dabei Personenschäden mit Kindern und Jugendlichen.
In dieser Veröffentlichung sollen wesentliche Zusammenhänge zwischen Gestaltung, Ausstattung und Ausführung von Fenstern in Schulen und den besonderen Nutzungsumständen sowie der erforderlichen Wartung und Pflege aufgezeigt werden. Besonderes Augenmerk wird dabei auf typische Anwendungen in Schulen für Kinder und Jugendliche gelegt, viele Themen und Aussagen lassen sich auch auf andere Einrichtungen zur Erwachsenenbildung o. ä. übertragen. Behandelt werden Fenster und Fensterbänder im Geltungsbereich der Produktnorm DIN EN 14351-1. Nicht behandelt werden Türen in Schulgebäuden sowie Turnhallen.
Diese ift-Richtlinie basiert auf den Erfahrungen der Prüf- und Sachverständigentätigkeiten des ift Rosenheim.
Aktualisiert: 2023-01-19
> findR *

In Deutschland sind nach Angaben der „Kreislaufwirtschaft Bau“ [1] im Jahr 2014 14,6 Mio. t Baustellenabfällen angefallen. Diese bestanden zu 95 % aus Eisen, Stahl, mineralischen Bestandteilen und Altholz sowie 5 % Glas, Kunststoff, Nichteisen-Metall und Dämmmaterial. Von diesen 14,6 Mio. t wurden 0,2 Mio. t (1,4 %) recycelt und 14,2 Mio. t (96,9 %) einer sonstigen Verwertung zugeführt. 0,2 Mio. t (1,7 %) wurden auf Deponien beseitigt. Detailliertere Angaben für Flachglas gibt es in dem jährlichen Bericht nicht [1]. Insbesondere geht aus dem Bericht nicht hervor, ob Flachglas zu einem hohen Grade recycelt wird oder ob der Großteil zusammen mit dem Bauschutt auf Deponien beseitigt oder einer sonstigen (minderwertigeren) Verwendung (z. B. im Straßenbau) zugeführt wird.
In einem Positionspapier [2] beziffert die Interessenvertretung europäischer Floatglashersteller „Glass for Europe (GfE)“ den Anteil des Floatglases an den Baustellenabfällen mit weniger als 1 %. Auch diese scheinbar kleine Menge ist nicht vernachlässigbar, da Glas prädestiniert ist für eine geschlossene Kreislaufwirtschaft (sog. closed-loop recycling). Der Einsatz von Glasscherben schont nicht nur die natürlichen Rohstoffressourcen, sondern reduziert auch die benötigte Schmelzenergie und damit auch die auftretenden CO2- Emissionen. Pro 10 Prozent Scherbeneinsatz wird mit einer Energieeinsparung von etwa 3 Prozent und einer Senkung der CO2-Emissionen um etwa 3,6 Prozent gerechnet [3]. In dem oben genannten Positionspapier von GfE [2] wird aber davon ausgegangen, dass Bauglas so gut wie nie zu neuen Glasprodukten recycelt wird, sondern dass es deponiert oder zusammen mit anderen mineralischen Abfällen einer minderwertigen Nutzung zugeführt wird. Nach Angaben des Bundesverbandes Glasindustrie e. V. (BV Glas) [4] beschränkt sich der Einsatz von Altglasscherben in der Flachglasherstellung meist auf die eigenen Produktionsscherben (sogenannte Eigenscherben) und auf speziell recyceltes hochwertiges Altglasmaterial. Die Einsatzquoten von Scherbenmaterial betrügen etwa 20 Prozent.
Auch die europäische Studie zu Ecodesignanforderungen für Fenster [5], die im Auftrag der europäischen Kommission von VHK aus den Niederlanden sowie dem ift Rosenheim durchgeführt wurde, zeigte, dass hinsichtlich des Recyclings von Flachglas aus dem Bauwesen kein belastbares Datenmaterial vorliegt, weder auf Ebene der Mitgliedsstaaten, noch auf europäischer Ebene. Es gibt keine Daten, auf deren Basis Handlungsempfehlungen bezüglich des Recyclings von Flachglas ausgesprochen werden könnten.
Ziel des Forschungsvorhabens war es daher, eine Analyse des Ist-Zustandes hinsichtlich des Recyclings von Flachglas in Deutschland zu erstellen. Basierend auf den Ergebnissen sollten Handlungsvorschläge für ein closed-loop Recycling von Flachglas erarbeitet werden.
Aktualisiert: 2023-01-19
> findR *
In dieser Veröffentlichung sollen wesentliche Zusammenhänge zwischen Gestaltung, Ausstattung und Ausführung von Fenstern in Pflegeeinrichtungen und den besonderen Nutzungsumständen aufgezeigt werden.
Besonderes Augenmerk wird dabei auf typische Anwendungen in Wohn- und Pflegeheimen für Betagte gelegt; viele Themen und Aussagen lassen sich auch auf den privaten Bereich übertragen. Dies ist speziell bei Wohnformen wie betreutes Wohnen (Service-Wohnen, Begleitetes Wohnen, „Alten-WGs“, ...) wichtig, da der Übergang zu Heimen oft fließend ist.
Behandelt werden beispielsweise Fenster und Fensterbänder im Geltungsbereich der Produktnorm DIN EN 14351-1. An praktischen Beispielen sollen die Umsetzung der mannigfaltigen Anforderungen an diese Elemente gezeigt und Ansätze zur Lösung von Zielkonflikten gegeben werden. Es werden Tipps zur Umsetzung im Bestand gegeben. Der Einsatz von Türen (Außen- und Innentüren) in Pflegeeinrichtungen, wird hier nicht behandelt.
Aktualisiert: 2023-01-19
> findR *
Die Zargen von Innentüren werden bis zu einer vom Hersteller festgelegten Gewichtsobergrenze des Türblatts mit Polyurethan-Ortschaum am Baukörper befestigt – meist werden keine zusätzlichen mechanischen Befestigungsmittel eingesetzt. Diese speziellen Produkte werden daher in dieser Richtlinie Zargenschäume genannt. Die Zargenschäume stellen somit eine tragende Klebung zwischen Zarge und Baukörper her. Die Richtlinie beschreibt das Prüfverfahren, mit dem die Gebrauchstauglichkeit der Polyurethan-Ortschäume als Zargenschaum nachgewiesen wird.
Aktualisiert: 2023-01-19
> findR *
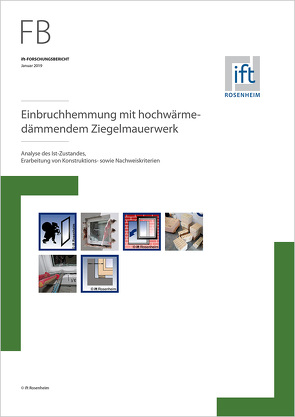
Die Prüfung und Klassifizierung der einbruchhemmenden Eigenschaften von Fenstern und Türen regelt die Normenreihe DIN EN 1627 bis 1630. Im nationalen Vorwort der DIN EN 1627 wird, abhängig von der Widerstandsklasse des Bauelementes, das geeignete Mauerwerk über Vorgaben zu Wanddicke, Druckfestigkeits- und Rohdichteklasse der Steine sowie zur Mörtelgruppe Tabelle 1 definiert.
Infolge der stetig steigenden Anforderungen der Energieeinsparverordnung an die Reduzierung der Transmissionswärmeverluste der Gebäudehülle und der damit einhergehenden wärmeleittechnischen Optimierung moderner Ziegelbaustoffe, wird modernes Ziegelmauerwerk in niedrigen Rohdichte- und Druckfestigkeitsklassen hergestellt. Diese sind jedoch nicht in der Tabelle in DIN EN 1627 erfasst. Daher sind hochwärmedämmende Ziegel mit geringen Druckfestigkeiten derzeit als Befestigungsgrund für einbruchhemmende Bauelemente normativ nicht nachgewiesen.
Ziel des Forschungsvorhabens war es somit allgemeingültige Aussagen zur Eignung von hochwärmedämmendem Ziegelmauerwerk hinsichtlich der Montage von einbruchhemmenden Bauelementen nach DIN EN 1627 treffen zu können. Der Schwerpunkt lag hierbei auf den Widerstandsklassen RC2 und RC3.
Aktualisiert: 2023-01-19
> findR *
Die ift-Fachinformation BA-02/1 „Empfehlungen zur Umsetzung der Barrierefreiheit im Wohnungsbau mit Fenstern und Türen“ enthält konkrete Empfehlungen für die Ausführung von Bauelementen im Hinblick auf die tatsächlichen Nutzergruppen. Zum Beispiel zur Ausführung der Griffe, zu den Abmessungen, den Öffnungsarten oder der optischen Gestaltung für Sehbehinderte. Ein Schwerpunkt liegt auf der Passierbarkeit und der Ausführung von Türschwellen. Gerade für Menschen, die einen Rollator nutzen, können schon geringe Schwellenhöhen eine Stolpergefahr bedeuten oder gar unüberwindbar sein.
Die Fachinformation bietet konkrete Empfehlungen und wertvolle Praxistipps für Bauherren, Planer, Hersteller und Händler von Bauelementen, um die Planung, Ausschreibung und Ausführung barrierefreier Fenster und Türen, privater Wohngebäude, Seniorenheime und Pflegeeinrichtungen zu erleichtern.
Aktualisiert: 2023-01-19
> findR *

Mit der Aufgabe eine Wohnung barrierefrei zu gestalten, ist die Thematik von Schwellen unumgänglich. Diese müssen beim Passieren von Türen oder Fenstertüren überwunden werden. Nach DIN 18040-2:2011-07 [1] sind Schwellen sowie untere Türanschläge nicht zulässig, sollten diese aber technisch erforderlich sein, dürfen sie maximal 2 cm hoch sein. Eine Beurteilung der Schwellenausbildung erfolgt also in Deutschland nur nach der Höhe. In Österreich wird neben der Geometrie auch eine gute Überrollbarkeit in ÖNorm B 1600 gefordert. Im Kontext der Barrierefreiheit kommt eine schwellenlose Ausführung besonders den Nutzern von Rollatoren und Rollstühlen entgegen. Für blinde Menschen hingegen, kann eine Schwelle der Orientierung dienen, wenn eine gut ertastbare Mindesthöhe gegeben ist. Neben der Überrollbarkeit ist auch die Bewertung der Stolpergefahr aufgrund einer Schwelle wichtig. Letztere ist nicht Gegenstand dieser Richtlinie.
Diese Richtlinie ermöglicht eine Beurteilung unterschiedlicher Schwellenausbildung auf deren Überrollbarkeit. Die Erarbeitung der Prüf- sowie Klassifizierungsgrundlagen für diese Richtlinie erfolgte im Rahmen des Forschungsvorhabens „Bewertung der Barrierefreiheit von Bauelementen am Anwendungsbeispiel Fenster und Türen“ (Kennzeichen SWD-10.08.18.7-15.08).
Aktualisiert: 2023-01-19
> findR *

Viele Menschen sind aufgrund verschiedenster körperlicher und geistiger Einschränkungenauf eine barrierefreie Umwelt angewiesen. Durch den demografischen Wandel besteht zudem steigender Bedarf an barrierefreien Lösungen, um selbstständiges und komfortables Leben bis ins hohe Alter zu ermöglichen.Das bisherige Grundziel der Barrierefreiheit sieht besonders im öffentlichen Bereich eine Nutzung durch möglichst alle Menschenmit und ohne Einschränkungen vor. Die neu veröffentlichten und in den meisten Bundesländern eingeführten baurechtlichen Normen DIN18040 1+2 zum barrierefreien Bauen, richten sich zwar bereits an jeweilige individuelle Schutzziele, beinhalten jedoch keine konkreten Angaben oder individuelle Einsatzempfehlungen.Dies führt jedoch häufig zu baulichen Lösungen die bemüht sind, stur allen denkbaren normativen und regulativen Anforderungen zu genügen, ohne dem eigentlichen Bedarf der späteren Nutzergruppen gerecht zu werden. Gerade im privaten Bereich und bei speziellen Einrichtungen ist aber vielmehr eine situative Ausstattung der Bauelemente erforderlich, um das Optimum für die jeweilige Nutzergruppe zu erreichen und vor allem auch bezahlbar zu machen. Daneben dürfen auch die herkömmlichen,für den Bereich der Fenster und Türen extrem breit gefächerten Leistungseigenschaften, nicht zurückstehen. Zielsetzung dieses Forschungsvorhabens ist es, barrierefreie Anforderungsprofile für die unterschiedlichsten Nutzergruppen und Anwendungsfälle von Fenstern und Türen zu definieren. Dazu sind auch Konzepte zu entwickeln, mit denen eine praxisnahe Bewertung der Barrierefreiheit von Bauelementen, wie Fernstern und Türen, ermöglicht wird. Hierzu sind Vorgaben und Abläufe zur Untersuchung, Bewertung und Klassifizierung von spezifischen Konstruktionen im Neuzustand zu entwickeln und zu erproben. Die Erkenntnisse des Vorhabens sollen zu Einsatzempfehlungen für barrierefreie Fenster und Türen führen.
Aktualisiert: 2023-01-26
> findR *
Teil 1: Ermittlung des repräsentativen Ψ-Wertes für Fensterrahmenprofile
Entsprechend der Produktnorm für Fenster EN 14351-1 Kapitel 4.12 erfolgt die Ermittlung des Wärmedurchgangskoeffizienten UW von Fenstern u. a. durch Berechnung nach EN ISO 10077-1. Zur Berechnung wird neben den Wärmedurchgangskoeffizienten des Rahmens Uf sowie der Verglasung Ug, der lineare Wärmedurchgangskoeffizient Ψ benötigt. Dieser Ψ-Wert beschreibt den Wärmeverlust, der durch den Einbau der Verglasung in den Rahmen entsteht. Die Höhe dieses Ψ-Wertes hängt wesentlich davon ab, welcher Abstandhalter im Isolierglas verwendet wird. Hierbei wird zwischen „konventionellen“ und wärmetechnisch verbesserten Abstandhaltern unterschieden. Die Definition eines wärmetechnisch verbesserten Abstandhalters ist in EN ISO 10077-1 enthalten und ist nochmals im Anwendungsbereich dieser Richtlinie zusammengefasst.
Aktualisiert: 2018-11-07
> findR *

Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurden umfangreiche Untersuchungen zu Befestigung von Fenster in hochwärmedämmendem Ziegelmauerwerk durchgeführt. Neben einer Analyse der an den Befestigungspunkten auftretenden Lasten wurden an unter-schiedlichen Ziegelsteinen die Tragfähigkeiten durch Kleinteilversuche ermittelt. Aufbau-end hierauf wurden an kompletten Bauteilen, bestehend aus Wand sowie eingebautem Fenster, Untersuchungen zur Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit durchgeführt. Hierbei wurden auch alternative Befestigungskonzepte zur Gruppenbefestigung sowie zur Befestigung am unteren Anschluss untersucht.
Die durchgeführte Analyse der an den Befestigungspunkten angreifenden Lasten hat er-geben, dass in vielen Fällen nicht die Windlast die entscheidende Größe für die Bemessung der Befestigungselemente ist. Vielmehr ist es die Last, die durch einen auf 90° geöffneten Flügel, insbesondere mit einer vertikalen Nutzlast, auf die Befestigungspunkte in Nähe des Eck- als auch Scherenlagers wirken. Die dort auftretenden Kräfte sind für typische Fensterformate so groß, dass die Lasten nicht mehr von einem einzigen Befestigungspunkt aufgenommen werden können. Daher wurden im Rahmen des Forschungs-vorhabens „alternative Befestigungslösungen“ untersucht. Durch eine Gruppenbefestigung in der Nähe des Scherenlagers bzw. des Ecklagers werden die angreifenden Lasten auf mehrere Befestigungspunkte aufgeteilt. Bei einer Gruppenbefestigung bei der die Be-festigungspunkte symmetrisch um die lasteinleitende Stelle liegen, kann für die Bemessung eine gleichmäßige Lastverteilung angenommen werden. Dies gilt z.B. für eine „Über-Eck Befestigung“ im Bereich des Scherenlagers. Die Last am Ecklager kann bei einem Fenster mit Riegel auf zwei Befestigungspunkte aufgeteilt werden, die direkt oberhalb so-wie unterhalb des Riegels liegen.
Ebenso kann eine Lastaufteilung erfolgen, wenn die Befestigungsmittel nicht symmetrisch um den Lasteinleitungspunkt verteilt sind. Wird z.B. am oberen Scherenlager im einem Abstand von ca. 100 mm zum „Standardbefestigungspunkt ein zweiter Befestigungspunkt gesetzt, so reduziert sich die Last auf den Standardbefestigungspunkt auf ca. 70%. Dies gilt auch sinngemäß für die Befestigung im Bereich des Ecklagers.
Für ein typisches einflügeliges Fenster der Abmessung von ca. 1,2 x 1,4 m liegen die Las-ten pro Befestigungselement, ohne die Berücksichtigung von vertikalen Nutzlasten in der Größenordnung von 0,5 kN. Hierbei wurde eine umlaufende Befestigung angenommen.
Bei Berücksichtigung einer vertikalen Nutzlast von 600 N (Klasse 3 nach EN 13115) erhöht sich die Last auf ca. 1,0 kN.
In Anlehnung an den Eurocode muss die Bemessung des Befestigungspunktes sowohl den Grenzzustand der Tragfähigkeit als auch den Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit berücksichtigen. Für den Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit ist hierbei aktuell nach MO-02/1 eine maximale Verformung der Befestigungspunkte unter Last von 3 mm definiert. Diese Anforderung rührt aus der Sicherstellung der Dauerhaftigkeit des An-schlusses insbesondere der inneren sowie äußeren Abdichtung zwischen Fenster und Mauerwerk.
Ist die empfohlene Tragfähigkeit für das Versagen eines Befestigungsmittels im Befestigungsgrund größer als die Kraft für die zulässige Verformung von 3 mm, so erfolgt die Bemessung anhand der Verformung (Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit). Die Kraft für eine Verformung von 3 mm hängt hierbei von der freien Länge des Befestigungsmittels, d.h. in erster Näherung von der Breite der Einbaufuge ab. Es ist daher wichtig bei der Bemessung auch die Breite der Einbaufuge zu berücksichtigen.
Messungen der Tragfähigkeit an Einzelsteinen haben gezeigt, dass die Verformung, bei einer Fugenbreite ab ca. 15 mm oftmals die maßgebliche Größe für die Bemessung des Befestigungsmittel darstellt und nicht wie ursprünglich vermutet, die reine Tragfähigkeit des Steines. Dies gilt insbesondere für spezielle Leibungsziegel, die ein hinsichtlich der mechanischen Eigenschaften optimiertes Lochbild aufweisen.
Durchgeführte Untersuchungen an Kleinproben haben gezeigt, dass der „Aufbau des Probekörper“ sowie Details bei der Durchführung der Zugversuche signifikante Auswirkungen auf die ermittelte charakteristische Tragfähigkeit sowie die Versagensart haben kann. Eine Aussage über die Größe des Einflusses kann aufgrund der geringen Stichprobe nicht allgemeingültig abgeleitet werden. Prinzipiell wird jedoch empfohlen, die Tragfähigkeit von hochwärmedämmendem Ziegelmauerwerk in der Leibung an Steinverbänden zu er-mitteln.
Durchgeführte Bauteilversuche zeigten, dass das theoretische (vereinfachte) Bemessungsmodell im Rahmen der baupraktischen Anwendung eine ausreichende Überein-stimmung mit den in den Bauteilversuchen ermittelten Verformungen aufweist. Weiterhin konnte gezeigt werden, dass eine nach dem Bemessungskonzept ausgeführte Befestigung in den untersuchten, hinsichtlich der mechanischen Eigenschaften optimierten Leibungsziegeln eine ausreichende Dauerhaftigkeit aufweist. Der bereits vorgestellte Ansatz einer Gruppenbefestigung zur Lastverteilung (über Eck oder Doppelbefestigung) wurde durch die zusätzlichen Bauteilversuche bestätigt.
EDV gestützte Hilfswerkzeuge werden zukünftig den Ausführenden bei der Planung der Montage und Befestigung von Fenstern unterstützen. Hierzu hat das ift Rosenheim ein erstes Werkzeug entwickelt, in das auch die Erkenntnisse des Forschungsvorhabens ein-geflossen sind. Unter www.ift-montageplaner.de steht den Bauausführenden dieses Hilfswerkzeug kostenlos zur Verfügung.
Aktualisiert: 2023-01-26
> findR *
MEHR ANZEIGEN
Oben: Publikationen von ift Rosenheim
Informationen über buch-findr.de: Sie sind auf der Suche nach frischen Ideen, innovativen Arbeitsmaterialien,
Informationen zu Musik und Medien oder spannenden Krimis? Vielleicht finden Sie bei ift Rosenheim was Sei suchen.
Neben praxiserprobten Unterrichtsmaterialien und Arbeitsblättern finden Sie in unserem Verlags-Verzeichnis zahlreiche Ratgeber
und Romane von vielen Verlagen. Bücher machen Spaß, fördern die Fantasie, sind lehrreich oder vermitteln Wissen. ift Rosenheim hat vielleicht das passende Buch für Sie.
Weitere Verlage neben ift Rosenheim
Im Weiteren finden Sie Publikationen auf band-findr-de auch von folgenden Verlagen und Editionen:
Qualität bei Verlagen wie zum Beispiel bei ift Rosenheim
Wie die oben genannten Verlage legt auch ift Rosenheim besonderes Augenmerk auf die
inhaltliche Qualität der Veröffentlichungen.
Für die Nutzer von buch-findr.de:
Sie sind Leseratte oder Erstleser? Benötigen ein Sprachbuch oder möchten die Gedanken bei einem Roman schweifen lassen?
Sie sind musikinteressiert oder suchen ein Kinderbuch? Viele Verlage mit ihren breit aufgestellten Sortimenten bieten für alle Lese- und Hör-Gelegenheiten das richtige Werk. Sie finden neben