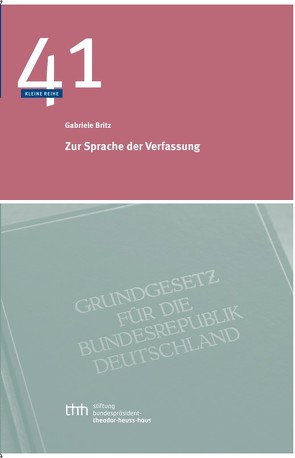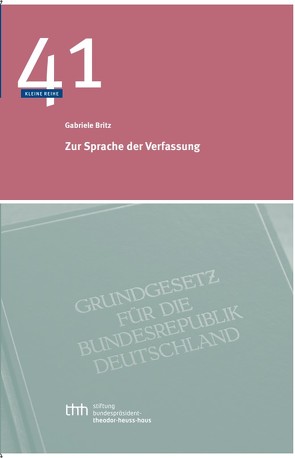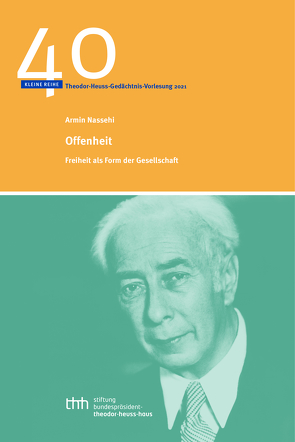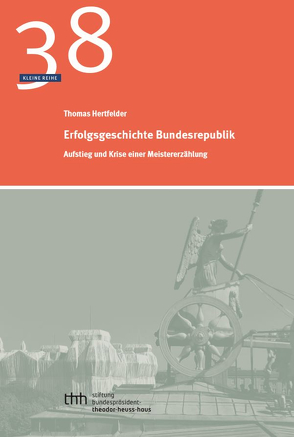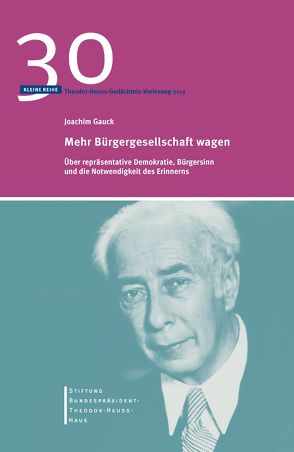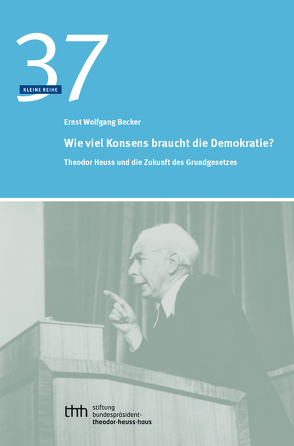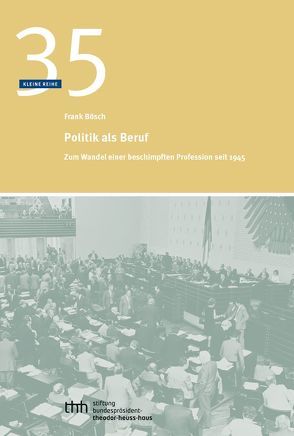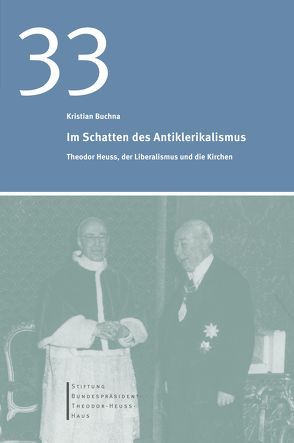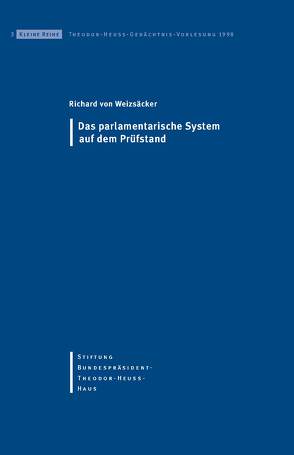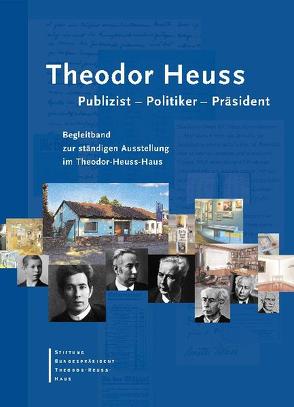Das Grundgesetz artikuliert gesellschaftliche Gerechtigkeitsvorstellungen, ist zugleich aber ein juristischer Text, auf dem Rechtsprechung und staatliches Handeln beruhen. Es schreibt also eine als gerecht empfundene Ordnung fest, der zuliebe die Staatsbürger und Staatsbürgerinnen die ihnen ebenfalls von der Verfassung auferlegten Bedingungen akzeptieren. Doch die verschiedenen Funktionen, die ein Verfassungstext erfüllen muss, schließen sich zum Teil auch aus.
Aktualisiert: 2023-05-25
> findR *
Das Grundgesetz artikuliert gesellschaftliche Gerechtigkeitsvorstellungen, ist zugleich aber ein juristischer Text, auf dem Rechtsprechung und staatliches Handeln beruhen. Es schreibt also eine als gerecht empfundene Ordnung fest, der zuliebe die Staatsbürger und Staatsbürgerinnen die ihnen ebenfalls von der Verfassung auferlegten Bedingungen akzeptieren. Doch die verschiedenen Funktionen, die ein Verfassungstext erfüllen muss, schließen sich zum Teil auch aus.
Aktualisiert: 2023-01-26
> findR *
Der Begriff der Freiheit bestimmt in hohem Maß das Selbstverständnis westlicher Gesellschaften. Dabei ist "Freiheit" als Begriff und als Praxis voraussetzungsreich und komplex. Wie ist Freiheit in modernen Gesellschaften zu bestimmen?
In der Theodor-Heuss-Gedächtnisvorlesung 2021 plädiert der Soziologe Armin Nassehi dafür, den Begriff der Freiheit mit dem der Vernunft zusammenzudenken. Er schlägt vor, Freiheit in "Freiheitsgraden" auszubuchstabieren und sie nicht nur als individuelle Freiheit zu verstehen, sonden sie vielmehr auf die jeweilige Ordnung, in der sie stattfindet, zu beziehen. Moderne Gesellschaften zeichnen sich, so der Autor, auf Grund ihrer inneren Differenzierung durch ihre grundsätzliche Offenheit aus. Damit eröffnen sie spezifisch moderne Freiheitsräume.
Aktualisiert: 2023-01-26
> findR *

Deutsche und Russen verbindet ein historisch begründetes, besonderes Verhältnis. Irina Scherbakowa wirft einen ebenso ungewohnten wie inspirierenden Blick auf diese spannungsreiche Beziehungsgeschichte, indem sie an die vielfachen kulturellen und wissenschaftlichen Bezüge erinnert, die sich seit dem 18. Jahrhundert zwischen Russland und Deutschland entwickelt haben. Die Ausbildung nationaler Stereotype, die insbesondere in der russischen Literatur verarbeitet wurden, ist ebenso Teil dieser Geschichte wie die Gewalt- und Kriegserfahrungen im 20. Jahrhundert. Ein besonderes Augenmerk legt die Autorin auf die Möglichkeit und Notwendigkeit, sich der eigenen Vergangenheit zu stellen und Lernprozesse anzustoßen. Ihr Ausblick reicht dabei bis in die Gegenwart, in der das „andere“, kritische Russland mit seinen unabhängigen NGO-Aktivisten, Wissenschaftlern, Publizisten und Künstlern aus Deutschland deutlich mehr Unterstützung erhält als aus anderen Ländern. Auch daran wird deutlich: Das russisch-deutsche Verhältnis geht weit über die diplomatischen Beziehungen zweier Staaten hinaus.
Aktualisiert: 2021-02-18
> findR *
Über Jahrzehnte hin galt die Bundesrepublik nicht nur als Provisorium und Teilstaat, sie war auch ein geschichtsloses Land. Dies änderte sich erst im Lauf der 1980er Jahre, als nach einer Periode rapiden Wandels die Geschichte der Bundesrepublik endlich erforscht, geschrieben und in einer breiten Öffentlichkeit diskutiert wurde. Seit Ende der 1990er Jahre wird die Geschichte der Bundesrepublik breitenwirksam als eine geradezu beispiellose Erfolgsgeschichte erzählt. Wie kam es zu dieser Erfolgsgeschichte? Aus welchen Momenten setzt sie sich zusammen? Wo liegen ihre Grenzen? Und warum vermag sie in jüngster Zeit nicht mehr so recht zu überzeugen?
Aktualisiert: 2020-07-11
> findR *
Der Autor definiert die Funktionsbedingungen einer repräsentativen Demokratie und legt diese dann insbesondere für die Bundesrepublik Deutschland auf den Prüfstand. Medialisierung, technische Revolutionen und ökonomische Liberalisierung gefährden demnach zunehmend die Grundbedingungen für eine funktionierende nationale Demokratie; noch sei aber kein gangbarer Weg zu parlamentarischer Kontrolle internationaler Gremien gefunden worden. Doering-Manteuffel konstatiert einen freiwilligen Verzicht gewählter Repräsentanten auf Verantwortung, die statt dessen lieber ökonomischen Agenturen oder dem Bundesverfassungsgericht überlassen werde, und warnt insbesondere vor der Eigendynamik der Wirtschaft. In einer Demokratie müsse Verantwortung und Entscheidungskompetenz dagegen unbedingt bei einer gewählten und damit legitim abgesicherten Regierung liegen.
Aktualisiert: 2020-12-17
> findR *
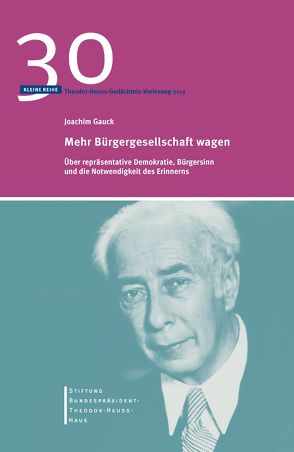
Die Bundesrepublik Deutschland ist eine repräsentative Demokratie – zumindest auf der Ebene des Bundes. Die Gesetzgebung liegt ausschließlich in den Händen von Bundestag und Bundesrat – so haben es die Väter und Mütter des Grundgesetzes im Parlamentarischen Rat 1948/49 beschlossen und in der Verfassung niedergelegt. Elemente direkter Demokratie, wie sie heute vielfach für den Bund gefordert werden, sieht das Grundgesetz nicht vor. Vor ihnen hat insbesondere Theodor Heuss als Abgeordneter im Parlamentarischen Rat nachdrücklich gewarnt. Gilt diese Warnung noch heute? Diese Warnung greift Bundespräsident Joachim Gauck in der Theodor-Heuss-Gedächtnis-Vorlesung auf, die er aus Anlass des 50. Todestages von Heuss am 12. Dezember 2013 auf Einladung der Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus an der Universität Stuttgart gehalten hat, und er verbindet sie mit einem eindringlichen Plädoyer für die repräsentative Demokratie in Deutschland. Der Ort der Differenzierung und der Ort des Kompromisses ist das Parlament, nicht das Plebiszit. Die parlamentarische Demokratie in Deutschland bedarf freilich, so Joachim Gauck, der kreativen Impulse der direkten Demokratie, wie sie auf kommunaler und Länderebene gepflegt wird, und sie bedarf der vielfachen Formen des bürgerschaftlichen Engagements. Insbesondere setzt das Gelingen der Demokratie in Deutschland die Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger voraus, sich an die Verbrechen zweier Diktaturen ebenso zu erinnern wie an die raditionen von Freiheit und Demokratie. Die Theodor-Heuss-Gedächtnis-Vorlesung wird alljährlich im Dezember von der Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus und der Universität Stuttgart veranstaltet. Die Vorlesung knüpft an die Tradition der öffentlichkeitswirksamen Rede an, für die Theodor Heuss als Hochschullehrer, Politiker und Bundespräsident stand.
Aktualisiert: 2020-12-17
> findR *
Friedrich Naumann (1860 – 1919) gilt als einer der Begründer des sozialen Liberalismus in Deutschland. Sein politischer Ziehsohn und Mitarbeiter Theodor Heuss (1884 – 1963) hat Naumann zeitlebens verehrt und ihm in einer großen Biographie ein Denkmal gesetzt. Noch als Bundespräsident hat Heuss in zahlreichen Reden und Artikeln auf Naumann Bezug genommen. Die vorliegende Studie zeichnet die Konturen des Naumann-Bildes nach, das Theodor Heuss zwischen Deutschem Kaiserreich und früher Bundesrepublik vertreten hat. Sie untersucht die Gemeinsamkeiten und Unterschiede im politischen Denken und Handeln der beiden Politiker und legt die Spur eines sozialen Liberalismus frei, die sich in Deutschland bis in die Gegenwart verfolgen lässt.
Aktualisiert: 2023-01-20
> findR *
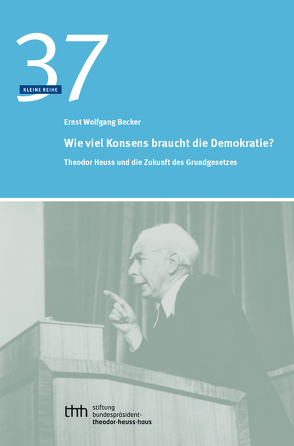
Theodor Heuss gilt bis heute als der große Vermittler in den Kontroversen, die der Parlamentarischen Rat 1948/49 bei der Erarbeitung des Grundgesetzes geführt hat. Doch seine Rolle geht weit über die eines Brückenbauers hinaus. Heuss vertrat von Beginn an klare verfassungsrechtliche Positionen, die er streitbar und mit Nachdruck verfolgte. So konnte er einige wesentliche Prinzipien des Grundgesetzes gestalten, die langfristig zur Integration der zerklüfteten Nachkriegsgesellschaft und Liberalisierung der Bundesrepublik beitrugen. Allerdings stellt sich die Frage nach der Zukunft unserer Verfassung mit neuer Dringlichkeit, seit mit der jüngsten Krise der Demokratie das Grundgesetz verstärkt unter Druck geraten ist. Deshalb diskutiert die Studie nicht nur die Arbeit von Heuss im Parlamentarischen Rat, sondern auch, inwiefern eine Verfassung Konflikte organisieren und zugleich Konsens stiften kann. Wieviel Konflikt kann die pluralistische Demokratie aushalten? Woraus beziehen wir den Konsens, der Konflikte einhegt? Und welche Antworten kann uns Theodor Heuss für die gegenwärtigen Herausforderungen der liberalen Demokratie und ihrer Verfassung geben?
Aktualisiert: 2020-12-24
> findR *
Zur Publikation
Politiker haben ein denkbar schlechtes Ansehen. Nicht erst seit Aufkommen des Populismus wird ihnen vorgeworfen, sie seien nur auf Machterhalt und Geld aus, seien inkompetent und ohne Bezug zur Bevölkerung. Doch halten derlei Pauschalurteile einer zeithistorischen Analyse stand? Wie entwickelte sich in der Bundesrepublik Deutschland die Politik zu einem Beruf mit einem festen Gehalt? Was waren Voraussetzungen dafür, in der Politik erfolgreich zu sein? Wie veränderten sich Image und Sozialprofil von Politikern?
Frank Bösch, ein ausgewiesener Experte der Politik- und Parteiengeschichte, geht diesen Fragen sozialgeschichtlich nach. Dabei kommt er zu einem klaren Befund: Die deutschen Politiker sind deutlich besser als ihr Ruf.
Aktualisiert: 2018-11-01
> findR *

Der liberale Rechtsstaat mit seiner freiheitlichen demokratischen Grundordnung gerät in die Defensive. Angesichts terroristischer Bedrohungen wächst die Bereitschaft, im Namen der „inneren Sicherheit“ Grund- und Bürgerrechte einzuschränken. Das Kalkül des Terrorismus, die liberalen Gesellschaften durch die Erzeugung von Angst von innen heraus zu schwächen, scheint aufzugehen. Geschürt werden die Bedrohungsängste nicht nur durch Terrorakte, sondern auch von nationalistischen, rechtspopulistischen Bewegungen, deren erklärtes Ziel die Abschaffung der liberalen Demokratie zugunsten einer „gelenkten“ oder „illiberalen“ Demokratie ist.
Vor dem Hintergrund dieser Herausforderungen formuliert Sabine Leutheusser-Schnarrenberger ein liberales Plädoyer für die Freiheits- und Persönlichkeitsrechte des Einzelnen sowie für eine grundgesetzkonforme Begrenzung staatlicher Überwachung. Zugleich appelliert sie nachdrücklich an die Verantwortung Europas für den Schutz der freiheitlichen Demokratie.
Aktualisiert: 2018-11-01
> findR *
Liberalismus und christliche Kirchen verbindet ein historisch belastetes Verhältnis zueinander. Seit dem 19. Jahrhundert lehnten sich Liberale in ganz Europa gegen klerikale Bevormundung und überkommene kirchliche Privilegien in Staat und Gesellschaft auf. Umgekehrt erblickten Kleriker im Liberalismus eine zu verwerfende unchristliche und materialistische Weltanschauung. Wie positionierte sich Theodor Heuss in diesem Spannungsfeld? In der Forschung gilt er bislang als ein weder christlich noch kirchlich verwurzelter Liberaler.
Die vorliegende Studie stellt diese Sichtweise infrage. Heuss wird als bewusster Protestant porträtiert, der sich zeitlebens mit den Themen Kirche, Konfession und Religion befasste und bemüht war, aus dem langen Schatten des Antiklerikalismus herauszutreten. An seiner Vita lässt sich somit beispielhaft das spannungsreiche Verhältnis zwischen Liberalismus und Kirchen vom Kaiserreich bis in die frühe Bundesrepublik aufzeigen.
Aktualisiert: 2020-03-26
> findR *

Das Verhältnis zwischen Juden und Nichtjuden in Deutschland ist nach
dem nationalsozialistischen Menschheitsverbrechen von Verkrampfungen
geprägt, die regelmäßig in öffentlichen Debatten eskalieren – nicht erst
seit dem Konflikt zwischen Ignaz Bubis und Martin Walser 1998 oder der
antisemitischen Rede des Bundestagsabgeordneten Martin Hohmann
2003. Ist dies bundesrepublikanische Normalität? Oder bedarf es vielmehr
einer deutsch-jüdischen Normalität, die ein reibungsloses Miteinander
erstrebt? Welche Art von Normalität ist überhaupt wünschenswert im
deutsch-jüdischen Verhältnis? Mit diesen schwierigen Fragen beschäftigt
sich Salomon Korn in seinem Beitrag. Ausgehend von der Geschichte seiner
Familie und seiner eigenen Biographie beschreibt er die komplizierte
Situation von Juden in Deutschland nach 1945, die sich sowohl mit einem
„schulddruckabwehrenden Antisemitismus“ wie auch mit einem ängstlichen,
aber wohlmeinendem Verschweigen von Unterschieden zwischen
Juden und Deutschen konfrontiert sehen.
Indem Salomon Korn die Auseinandersetzung mit dem Holocaust weiterhin
als transgenerationelle Aufgabe begreift, entwirft er ein Zukunftsbild von
einem unaufgeregten, eben „normalen“ deutsch-jüdischen Zusammenleben.
Und schließlich, so sein Traum, werde das Reden über deutsch-jüdische
Normalität sich selber überflüssig machen.
Aktualisiert: 2016-01-22
> findR *
Richard von Weizsäcker setzte als zweiter Referent mit dem vorliegenden Beitrag
die Theodor-Heuss-Gedächtsnis-Vorlesung fort. Knapp fünfzig Jahre nach
der Verabschiedung des Grundgesetzes geht der Alt-Bundespräsident der
Fragestellung nach, inwieweit seit 1949 neue Herausforderungen und Einflüsse
auf die verfassungspolitische Realität eingewirkt haben. In Auseinandersetzung
mit der These, die Bundesrepublik befinde sich auf dem Rückzug
vom Bundesstaat zum Staatenbund, richtet er sein Augenmerk auf das parlamentarische
System, dem Kernstück der demokratischen Verfassung. Nach
einer kritischen Analyse der gegenwärtigen Rolle der Parteien im politischen
Prozeß appelliert der Referent an Parteien und Exekutiven, sich engagiert an
den geistig-politischen Führungsaufgaben der Zeit zu beteiligen und einen
“offenen parlamentarischen Diskurs” zu führen.
Aktualisiert: 2016-02-18
> findR *
Die Generation der heute Vierzig- bis Fünfzigjährigen zieht gegenwärtig in
die Führungsetagen der Politik und Wirtschaft, der Medien und der Kultur
ein. Doch während die vorangegangenen Generationen, insbesondere die
der Achtundsechziger, noch für vermeintlich klare Gewissheiten eingetreten
waren, wird der „Generation 40 plus“ nachgesagt, sie huldige vorwiegend
einem an der Karriere und dem eigenen Wohlergehen orientierten
Pragmatismus. Diesem Verdikt stellt Giovanni di Lorenzo drei Werte entgegen,
die er für seine Generation als handlungsleitend sieht: Nachhaltigkeit,
Fairness und Toleranz. Der Autor begründet den Geltungsanspruch
dieser komplexen Werte aus den Erfahrungen seiner Generation und den
Problemlagen des beginnenden 21. Jahrhunderts.
Aktualisiert: 2016-01-22
> findR *
Im Gegensatz zu Persönlichkeiten der Zeitgeschichte wie Konrad Adenauer
oder Ludwig Erhard, die im öffentlichen Bewußtsein noch durchaus gegenwärtig
sind, konstatiert Hermann Rudolph fünfzig Jahre nach Verabschiedung
des Grundgesetzes und der Gründung der Bundesrepublik für das erste deutsche
Staatsoberhaupt Theodor Heuss „eine blasse Erinnerung, und die ist
dazu noch falsch“. Grund genug die dritte Theodor-Heuss-Gedächtnis-Vorlesung
erstmals dem Namensgeber selbst zu widmen, seine Leistungen und
Verdienste darzulegen und zugleich dem verbreiteten Vorbehalt entgegenzutreten,
Heuss sei ein unpolitischer Präsident gewesen. Hermann Rudolph diskutiert
Heuss’ Beitrag zur politischen Kultur und zur Grundlegung einer neuen
politischen Ordnung beispielhaft an drei politischen Grundfragen seiner
Amtszeit – der Frage nach der Ausgestaltung der Demokratie, dem Problem
des Förderalismus und dem Verhältnis der Deutschen zu ihrer Vergangenheit.
Aktualisiert: 2016-02-12
> findR *

Bundespräsident Theodor Heuss verbrachte als offizieller Gast von Königin
Elizabeth II. vom 20. bis zum 23. Oktober 1958 vier Tage in London und
Oxford. Dieser Staatsbesuch stellte für Heuss eine besondere Herausforderung
dar: Das Verhältnis zwischen der Bundesrepublik und Großbritannien
galt bis ins Jahr 1958 hinein als gespannt; zudem war in der britischen Bevölkerung
ein tiefes Misstrauen gegenüber dem früheren Kriegsgegner weitverbreitet.
Es lag also auf der Hand, dass die bundesdeutsche Öffentlichkeit
Heuss‘ Staatsbesuch mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgte. Aber obwohl
das Bundespräsidialamt zusammen mit den englischen Stellen den Besuch
sorgfältig vorbereitet hatte, verfestigte sich in Deutschland allmählich der
Eindruck, dass Heuss von der englischen Bevölkerung zurückhaltend und
kühl empfangen worden sei.
Frieder Günther zeichnet die Vorbereitung und den konkreten Ablauf des
Staatsbesuches sowie die anschließende Mediendebatte nach. Wie konnte es
dazu kommen, dass sich Teile der bundesdeutschen Öffentlichkeit aufgrund
des Staatsbesuches über Wochen kritisch mit ihrem Selbstverständnis auseinander
setzten? Und wie ist es zu erklären, dass sich der Bundespräsident
im Nachhinein veranlasst sah, klarzustellen, dass die Auslandsreise in seinen
Augen für die Bundesrepublik sehr wohl einen Erfolg darstelle?
Dem hier veröffentlichten Text liegt ein Referat zugrunde, das Frieder Günther
am 16. Oktober 2003 in der Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus
im Rahmen der Reihe „Himmelsberg-Vorträge“ gehalten hat.
Aktualisiert: 2018-07-12
> findR *

Am Ende des Jahres 1946 erschütterte ein Skandal für einige Monate die politische
Landschaft im deutschen Südwesten. Führende bürgerliche Politiker
wie Reinhold Maier, Wilhelm Simpfendörfer und auch Theodor Heuss wurden
von ihrer Vergangenheit eingeholt und standen im Brennpunkt der öffentlichen
Kritik. Ihnen wurde vorgeworfen, im März 1933 dem sogenannten
Ermächtigungsgesetz zugunsten der Regierung Hitler zugestimmt und sich in
der Nachkriegszeit der politischen Verantwortung für dieses Verhalten entzogen
zu haben. Um diesen Vorwürfen nachzugehen und nach den Motiven für
die Zustimmung zu fragen, richtete der württemberg-badische Landtag 1947
einen Untersuchungsausschuß ein. Der Autor stellt die Umstände für das
Zustandekommen dieses Ausschusses dar, arbeitet Argumentationsmuster
aus den Zeugenaussagen heraus, skizziert die politische Debatte um diesen
Vorfall und deutet ihn im Zusammenhang mit der Entnazifizierung. Darüber
hinaus fragt er nach den tieferen Ursachen für die Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz,
die er im Falle des Liberalismus in dessen Demokratieverständnis
vor 1933 ansiedelt. Indem der Untersuchungsausschuß dies nicht thematisierte,
sondern die Entscheidung der bürgerlichen Parteien von 1933 herunterspielte,
sprach er letztlich eine Art Ermächtigung zum politischen Irrtum aus,
die symptomatisch, so die Deutung von Ernst Wolfgang Becker, für den Charakter
der Erinnerungspolitik in der frühen Bundesrepublik war.
Dem hier veröffentlichten Text liegt ein Vortrag zu Grunde, den Ernst Wolfgang
Becker am 13. Juli 2000 in der Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus
im Rahmen der Reihe „Himmelsberg-Vorträge“ gehalten hat.
Aktualisiert: 2016-02-12
> findR *
Begleitband zur ständigen Ausstellung im Theodor-Heuss-Haus.
Aktualisiert: 2023-03-28
> findR *

Gab es einen liberalen Widerstand gegen den Nationalsozialismus? Und welchen
Anteil hatte er an dem Attentat gegen Hitler am 20. Juli 1944? Bislang
von der Geschichtswissenschaft weitgehend vernachlässigt oder als Randerscheinung
eingeschätzt, zeichnet der vorliegende Beitrag das Netzwerk des
liberalen Widerstandes um den Firmengründer Robert Bosch nach. Verwurzelt
im sozialliberalen Denken rettete Bosch als Verteidiger der Weimarer Republik
demokratische Traditionen in die Zeit des "Dritten Reiches" hinüber.
Angesichts der allgemeinen Rechtlosigkeit, der nationalsozialistischen
Kriegspolitik sowie der Repressionen gegenüber den deutschen Juden fand
der "Boschkreis" in enger Zusammenarbeit mit Carl Goerdeler den Weg zur
aktiven Opposition. Diese umfaßte Hilfe für Juden, Auslandskontakte sowie
Entwürfe von Nachkriegsordnungen und mündete schließlich nach dem Tod
von Bosch in die Teilnahme an der Verschwörung des 20. Juli 1944. Das Attentat
scheiterte, doch der Widerstand des Kreises um Robert Bosch bleibt, so
die These des Autors, ein eindrucksvolles Beispiel für liberale Widerständigkeit
gegenüber der totalitären Herausforderung. In der scheinbar unzeitgemäßen
Haltung eines liberalen und sozialen Unternehmers schimmerte
darüber hinaus ein Zukunftspotential auf, aus dem die deutsche Nachkriegspolitik
erfolgreich schöpfen konnte.
Dem hier veröffentlichten Text liegt ein Referat zugrunde, das Joachim Scholtyseck
am 20. Juli 1999 in der Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus
gehalten hat.
Aktualisiert: 2016-02-12
> findR *
MEHR ANZEIGEN
Oben: Publikationen von Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus
Informationen über buch-findr.de: Sie sind auf der Suche nach frischen Ideen, innovativen Arbeitsmaterialien,
Informationen zu Musik und Medien oder spannenden Krimis? Vielleicht finden Sie bei Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus was Sei suchen.
Neben praxiserprobten Unterrichtsmaterialien und Arbeitsblättern finden Sie in unserem Verlags-Verzeichnis zahlreiche Ratgeber
und Romane von vielen Verlagen. Bücher machen Spaß, fördern die Fantasie, sind lehrreich oder vermitteln Wissen. Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus hat vielleicht das passende Buch für Sie.
Weitere Verlage neben Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus
Im Weiteren finden Sie Publikationen auf band-findr-de auch von folgenden Verlagen und Editionen:
Qualität bei Verlagen wie zum Beispiel bei Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus
Wie die oben genannten Verlage legt auch Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus besonderes Augenmerk auf die
inhaltliche Qualität der Veröffentlichungen.
Für die Nutzer von buch-findr.de:
Sie sind Leseratte oder Erstleser? Benötigen ein Sprachbuch oder möchten die Gedanken bei einem Roman schweifen lassen?
Sie sind musikinteressiert oder suchen ein Kinderbuch? Viele Verlage mit ihren breit aufgestellten Sortimenten bieten für alle Lese- und Hör-Gelegenheiten das richtige Werk. Sie finden neben