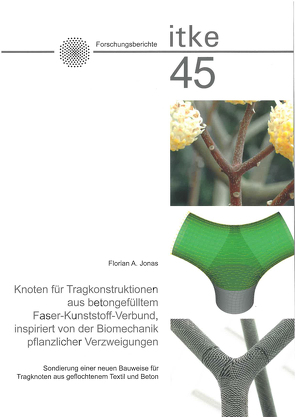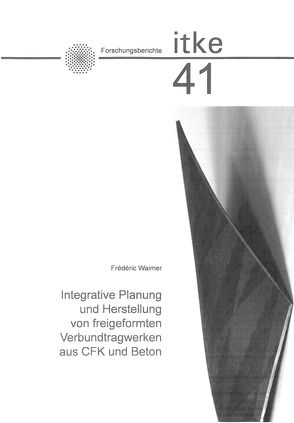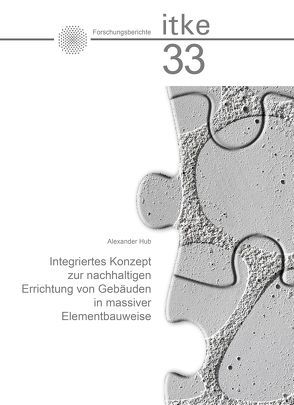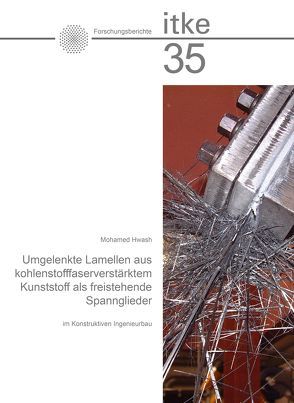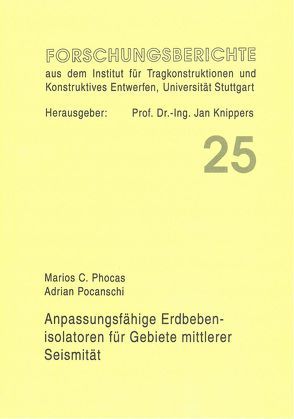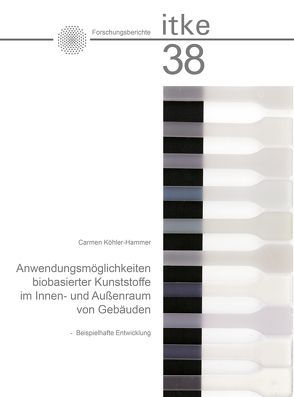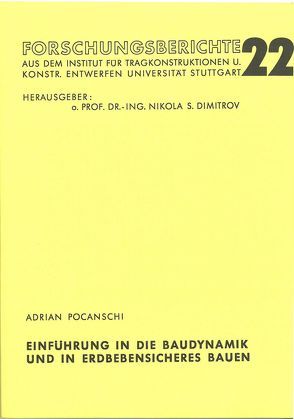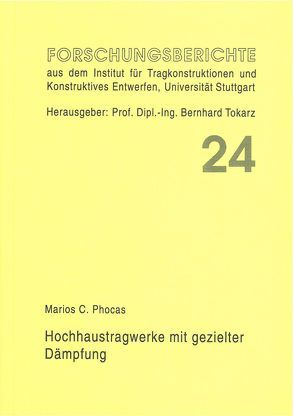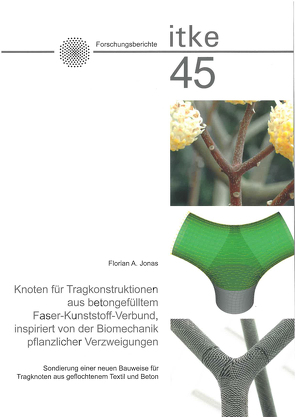
Diese Arbeit beschreibt die Entwicklung eines Knotens für verzweigte Tragkonstruktionen aus betongefüllten Faserverbundwerkstoffen in der Architektur und im Bauwesen. Basierend auf der Analyse der Funktionsprinzipien pflanzlicher Verzweigungen wird ein biegesteifes Bauteil mit hohen Beanspruchbarkeiten und großer geometrischer Gestaltungsfreiheit entwickelt.
Biologisches Vorbild sind ausgewählte pflanzliche Verzweigungen der Araliengewächse, die hinsichtlich ihrer Effizienz des Lastabtrags untersucht werden. Um transversal isotrope Materialien in der strukturmechanischen Simulation berücksichtigen zu können, wird eine Methode zur Ermittlung der Faserorientierungsinformation aus Mikro-Computertomografie-Daten erarbeitet. Das Konzept der Bauteilentwicklung beruht auf den vorgefundenen Prinzipien, wie dem Einsatz faserartiger Strukturen und deren lastangepasster Anordnung.
Der verzweigte Tragknoten besteht aus einem Kern aus Beton und einer Hülle aus Faser-Kunststoff-Verbund (FKV). Um einen kontinuierlichen Verlauf der Carbonfasern über den Verzweigungsbereich und eine lastpfadangepasste Ablage zu ermöglichen, wird das Flechtverfahren zur Verarbeitung der textilen Verstärkung gewählt.
Die FKV-Hülle nimmt Druckkräfte und Zugkräfte resultierend aus Momenteneinwirkung auf. Zusätzlich steigert sie die Drucktragfähigkeit des Betons durch Umschnürungswirkung, indem sie dessen Dehnung verhindert und einen mehraxialen Spannungszustand hervorruft.
Belastungsversuche der Bauteile und deren numerisch-mechanische Analyse zeigen das Tragverhalten der neuen, hybriden Tragknoten und demonstrieren deren Funktionsfähigkeit sowie das Anwendungspotential für Verzweigte Konstruktionen.
Aktualisiert: 2021-09-02
> findR *

In dieser Arbeit wurden die Voraussetzungen von Rest- und Abfallkunststoffen, für mögliche Anwendungen in Halbzeugen und Produkten für Gebäude untersucht. Dabei wurde ein besonderer Fokus auf die vergleichenden ökologischen Bewertungen von beispielhaften funktionellen Nutzungsszenarien gelegt. Ziel der Arbeit war es, zu ermitteln, welche Auswirkungen der Einsatz von Bauteilen aus thermoplastischen Recyclingkunststoffen auf die Ökobilanz eines Bauwerks haben kann. Aus ökologischer Sicht wurden dafür sinnvolle Anwendungen im Bauwesen identifiziert, bei denen durch den Einsatz von Bauteilen aus thermoplastischen Recyclingkunststoffen, die Lebenszyklusanalysen von Gebäuden und die damit in Verbindung stehenden Umweltauswirkungen beeinflusst werden können. Darüber hinaus besteht dadurch die Möglichkeit, dass die wertvollen fossilen Ressourcen nachhaltig erhalten bleiben und die Menge der anfallenden Kunststoffabfälle reduziert werden kann.
In der ersten Phase wurde eine präzise Problembestimmung vorgenommen. Die Hintergründe des Themas wurden eruiert und aus dem derzeitigen Forschungsstand ein Ziel definiert. Nach der bisherigen Problemformulierung folgte die Eingrenzung des wie bereits oben beschriebenen Ziels der Arbeit, mit den zu erwartenden möglichen Auswirkungen. Mit dem Fortschreiten der Arbeit wurden die in der Problembestimmung getroffenen Aussagen auf deren Zusammenhang von Ursachen und Wirkungen kontinuierlich überprüft.
Die Beschäftigung mit dem Thema Kunststoffrecycling ist unausweichlich. Mit der weltweit wachsenden Nachfrage nach der fossilen Ressource Erdöl und deren limitierten Fördermenge wird der Preis nicht nur für erdölbasierte Kraftstoffe, sondern auch für Kunststoffe in Zukunft erheblich steigen. Je früher mit der Erforschung und Optimierung alternativer Rcyclingprozesse und der Möglichkeiten für die Anwendung der Rezyklatprodukte begonnen wird, umso geringer wird sich die Knappheit des Öls bemerkbar machen.
Ein gesteigertes Umweltbewusstsein und wachsende Energiepreise führten im Bauwesen zur Energieeinsparverordnung
(EnEV). Die Vorgaben der Verordnung werden regelmäßig erhöht, um damit neue Gebäude auf einen minimalen Energieverbrauch während der Nutzung zu trimmen. Das maximale Einsparpotential ist mit dem Passivhausstandard, bei diesem während der Nutzungsphase keine Energie mehr verbraucht wird, schon erreicht. Möglich wird dies hauptsächlich durch einen erhöhten Materialeinsatz.
Dessen ungeachtet betrachtet die EnEV nur die Nutzungsphase der Gebäude. Die Produktionsphase und die Entsorgungsphase bleiben außen vor. Der kumulierte Energieaufwand (KEA), gibt „die Gesamtheit des primärenergetisch bewerteten Aufwands an, der im Zusammenhang mit der Herstellung, Nutzung und Beseitigung eines ökonomischen
Guts (Produkt oder Dienstleistung) entsteht bzw. diesem ursächlich zugewiesen werden kann.“ (VDI Richtlinie
VDI 4600 Blatt 1) Zusammenfassung IV
Der KEA oder auch umgangssprachlich bekannt als die „Graue Energie“ der Bauprodukte fließt bis jetzt noch nicht in die gesetzlich geforderte Energiebilanz von Gebäuden ein. Eine Verringerung des Gesamtenergiebedarfs ist zukünftig nur noch in der Erstellungs- und Entsorgungsphase möglich. Darüber hinaus wächst das Interesse an den potentiellen Umweltwirkungen der erstellten Gebäude. Dazu wird z.B. der „CO2 Fußabdruck“ berechnet. Mit diesem Wert allein kann jedoch noch keine Aussage über alle Umweltwirkungen getroffen werden, da es wesentlich mehr Faktoren gibt, die sich nicht proportional zueinander verhalten und innerhalb einer Ökobilanz betrachtet werden müssen.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden in Zukunft die „Graue Energie“, die potentiellen Umweltauswirkungen und der Ressourcenverbrauch in einer gesetzlich verpflichtenden Ökobilanzierung von Gebäuden eingeschlossen werden, um dem Anspruch einer ganzheitlichen Nachhaltigkeit von Gebäuden näher zu kommen. Das DGNB-Zertifikat ist ein gutes Beispiel für eine solche Bilanzierung, es enthält die genannten Bestandteile bereits, ist aber noch nicht für alle Gebäude verpflichtend.
Die durchgeführte Analyse des bestehenden Forschungsstandes enthält eine systematische Kategorisierung der verschiedenen Recyclingkunststoffe anhand ihrer unterschiedlichen Eigenschaften. Zudem wurden bereits bestehende Anwendungsbereiche und deren Anforderungen für Produkte aus Rezyklat identifiziert. Mithilfe von Software und Datenbanken zur Lebenszyklusanalyse können Verwertungs-und Recyclingwege analysiert und mit der herkömmlichen Herstellung von Kunststoffen aus fossilen Ressourcen verglichen werden.
Der Hauptteil der Arbeit enthält vergleichende Bilanzierungen von unterschiedlichen funktionellen Einheiten. Dabei wurden Bauteile aus Rezyklatkunststoffen mit herkömmlichen Bauteilen aus Holz, Metall, Stein, Kunststoff und Faserzement hinsichtlich ihrer ökologischen Umweltwirkungen verglichen. Anschließend wurden diese in die ökologische Lebenszyklusberechnung zweier Referenzgebäude übertragen, um festzustellen, welche Auswirkungen thermoplastische Rezyklatkunststoffe auf die ökologische Nachhaltigkeit von Gebäuden haben können.
Aktualisiert: 2020-05-26
> findR *
Die geometrische Komplexität von freigeformten Flächentragwerken in der gegenwärtigen Architektur lässt sich kaum noch wirtschaftlich umsetzen. Die Realisierung ist mit hohen Fertigungs- und Planungskosten verbunden und daher nur wenigen Bauvorhaben vorbehalten. Die herkömmlichen Bautechniken, Bauweisen, Materialien und Planungsprozesse sind Ursache für die hohen Kosten. Faserverstärkte Kunststoffe, automatisierte Fertigungsverfahren und digitale Planungsmöglichkeiten scheinen ein hohes Potential zu besitzen, dieser Problematik entgegenzuwirken.
In der vorliegenden Arbeit wird eine neue Flächenverbundbauweise, bestehend aus einer verlorenen karbonfaserverstärkten Kunststoffschalung (CFK) und Beton, vorgestellt, die es ermöglicht, freigeformte Flächentragwerke effizienter umzusetzen. Der Fokus liegt dabei auf der Untersuchung des Tragverhaltens, der Herstellung der freigeformten verlorenen Schalung und der Planung der Bauweise.
Aktualisiert: 2020-02-19
> findR *
Die Arbeit stellt ein integriertes Konzept aus einem hoch dämmenden Leichtbetonmaterial und einer vergussfreien Verbindungstechnik vor, die unter der Voraussetzung der trockenen Fügung der Bauteile den Ansprüchen eines nachhaltigen und wieder verwendbaren Bausystems für Wohngebäude in massiver Elementbauweise gerecht wird.
Aktualisiert: 2020-02-19
> findR *
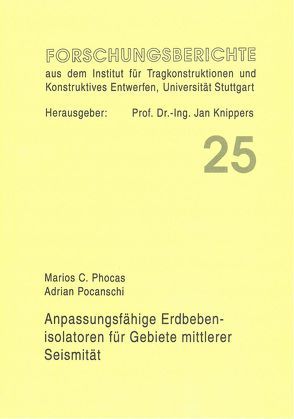
Der vorliegende Bericht befasst sich mit der Technik der Erdbebenisolierung von Bauwerken durch Einsatz von Sonderlagern. Am Anfang wird der Stand der technik auf diesem Gebiet aufgezeigt und die Grundprinzipien der technik dargelegt.
Zwei Reihen von neuartigen anpassungsfähigen Erdbebenisolatoren für mittelgroße Bauwerke und Gebiete mittlerer Seismizität werden vorgestellt und ihr dynamisches Verhalten wird experimentell und analytisch untersucht. Die Isolatoren bestehen aus zwei gekoppelten Lagerelementen: ein primäres Lager, bestehend aus einer Epoxydharz-Kugel, eingebettet in zwei konkaven Elastomerkissen. Der Aufbau der Isolatoren und die mechanischen Eigenschaften der einzelnen Elemente verleihen dem Lager eine Kennlinie mit progressiver Verformbarkeitsbegrenzung.
Nach Erläuterung der konstruktiven Gestaltung werden Ergebnisse aus der pseudo-dynamischen Untersuchung der Grundprototypen zur Beurteilung ihres vertikalen und horizontalen Tragverhaltens dargestellt. Anschließend werden die dynamischen Laboruntersuchungen analysiert. Die aufgenommenen Kraft-Verformungslinien und Hystereseschleifen werden durchgehend aufgezeigt und daraus die linear äquivalenten Parameter der Isolatoren ermittelt. Darauf bauend wird das dynamische Verhalten der Isolatoren unter aufgezeichneten Erdbebenzeitverläufen vom US-amerikanischen Raum und vom griechischen Mittelmeerraum untersucht. Die Effektivität der Isolatoren wird anhand der Herabsetzung der Bodenbeschleunigung beurteilt.
Aktualisiert: 2018-11-15
> findR *
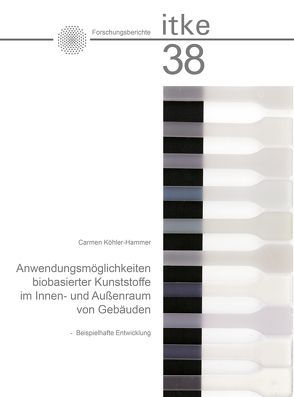
Die vorliegende Arbeit stellt Anwendungsmöglichkeiten biobasierter Kunststoffe in Gebäuden dar. Dies erfolgt an beisoielhaften Modifikationen von Polylactid, einem Milchsäurekunststoff, zur Anpassung für eine Innen- und eine Außenanwendung.
Kunststoffe werden in der Architektur aufgrund ihrer mannigfachen Gestaltungsmöglichkeiten hinsichtlich Lichtdurchlässigkeit, Farb- und Formgebung oder ihrer geringen Wärmeleitfähigkeit als Baustoff gewählt und finden in dieser Branche zunehmend Absatz.
Die Frage, wie sich Biokunststoffe als Baumaterialien einsetzen lassen, stellt eien zeitgemäße Weiterentwicklung dar. Die Rohstoffsituation lässt es sinnvoll erscheinen, Biomasse vor einer direkten energetischen Verwertung zunächst werkstofflich zu nutzen. Nach Gebrauchsende können biobasierte Werkstoffe, abzüglich ihrer Additive, die nicht auf nachwachsenden Rohstoffen basieren, klimaneutral verbrannt werden.
Für die Entwicklung möglichst transparenter Sandwichplatten zur Raumtrennung in öffentlichen Innenräumen, galt es im Rahmen eines von der DBU geförderten Forschungsprojektes einen biobasierten Kuntstoff hinschtlich seines Brandverhaltens und der Wärmebeständigkeit zu optimieren. Die akustisch wirksamen Platten sollen nach der Idee des Projektpartners Nimbus Group auf zwei Halbschalen basieren, deren mikroperforierte Deckschicht spritzgegossen wird.
Der Coumpoundierung von Polylactid (PLA) mit verschiedenen Flammschutzmitteln zeigte, dass nur Triphenylphosphat (TPP) die optischen Eigenschaftn nicht beeinträchtigt. Durch Zugabe von sieben Gewichtsprozent TPP war es auf Materialebene möglich, ein selbst verlöschendes Compound zu entwickeln und die Brandklasse UL-94-V0 zu erreichen.
Einzig durch Erhöhung der Werkzeugtemperaur auf 100° C und Verlängerung der Kühlzeit von etwa 25 auf 240 Sekunden bei der Formgebung, konnte mit durschnittlich 80° C eine ausreichende Wärmeformbeständigkeit (HDT-B) erzielt werden. Diese Maßnahme zur Erhöhung des Kristallisationsgrades von PLA verteuert durch geringere Stückzahlen pro Maschinenstunden die Fertigungskosten. Der Granulatpreis des Compounds hingegen ist konkurrenzfähig.
Der Anteil nachwachsender Rohstoffe im modifizierten Polylactid liegt bei über 90%.
Aktualisiert: 2020-02-19
> findR *
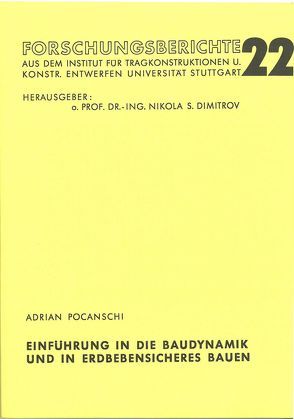
In Deutschland, einem Land, das im Vergleich zu anderen europäischen Ländern wie Italien, Griechenland, Balkan, Türkei u.a. in geringem Maß von Erdbeben gefährdet ist, beschränkt sich die technische Ausbildung der Architekturstudenten so gut wie ausschließlich auf die statische Anschauungsweise von Lastabtragungsphänomemen in Tragwerken. Diese setzt grundsätzlich ein langsames Aufbringen der Lasten voraus, so dass keine Bewegungen entstehen.
Es gibt aber Umstände, die die Bauingenieure mit Aufgaben konfrontieren, welche von schnell verlaufenden Wirkungen wie z.B. Erdbeben bedingt werden, an deren Lösung man nicht mehr aufgrund von statischen Ansetzen herantreten kann. Der Bauingenieur, der sich hauptsächlich mit den Problemen der Statik befasst hat, ist solchen Fällen meist überfragt. Man muss deshalb behaupten, dass jeder Bauingenieur wenigstens mit den Grundgesetzen der Baudynamik vertraut sein muss, wenn er den Problemen, die beim Bauen in Erdbebengebieten entstehen, gerecht werden will.
Die vorliegende Arbeit wendet sich in erster Linie an die Architektur- und Bauingenieurstudierenden, mit dem Ziel, ihnen in knapper Form die grundlegenden Kenntnisse der Baudynamik und des erdbebensicheren Bauens zu vermitteln.
Aktualisiert: 2020-02-19
> findR *
Aktualisiert: 2021-02-19
> findR *
Aktualisiert: 2020-02-19
> findR *

Faserverstärkte Kunststoffe (FVK) bieten gegenüber konventionellen Materialien mehrere Vorteile, wie zum Beispiel hohe spezifische Festigkeiten, einen guten Korrosionswiderstand und eine geringe Wärmeleitfähigkeit. Mit der steigenden Verwendung von Glasfaserverstärkten Kunststoffen (GFK) für Tragstrukturen, wie sie in diversen Projekten eingesetzt wurden, ist es von großer Bedeutung, den Einfluss hoher Temperaturen im Lastfall Brand auf das mechanische Verhalten abschätzen zu können. Dieser fehlende Nachweis schränkt bisher das Applikationspotential als Werkstoff für Tragwerke erheblich ein. Grundsätzlich lassen sich Faserverstärkte Kunststoffe in ihren Eigenschaften durch die Wahl der Faser und Matrix über den Herstellungsprozess und die Nachbehandlung innerhalb weiter Grenzen variieren. Für die grundlegenden Untersuchungen in dieser Arbeit wurde jedoch nicht angestrebt, einen bestimmten Verbund für möglichst viele Belastungsfälle umfassend zu charakterisieren, sondern es wurden für drei verschiedene Materialombinationen (E-Glasfaser / ungesättigtem Polyester-, Vinylester- und Phenolharz) die verbundspezifischen Eigenschaften bei erhöhter Temperatur und gleichzeitiger mechanischer Biegebeanspruchung erfasst.
Aktualisiert: 2020-02-19
> findR *
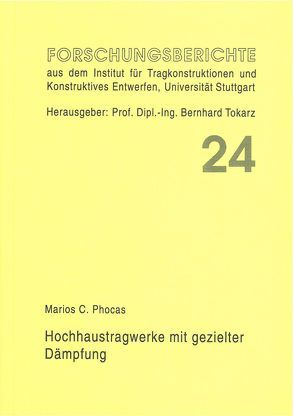
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der passiven Verformungskontrolle von Hochhaustragwerken unter starker Erdbebeneinwirkung durch gezielte Anordnung von Dämpfungsanlagen. Am Anfang wird der Stand der heutigen Technik auf diesem Gebiet aufgezeigt und die Grundprinzipien dargelegt.
Ein neuartiges Tragwerkskonzept, das auf einer dualen Wirkung seiner Tragglieder beruht, wird vorgestellt. Dieses System besteht aus einem geschlossenen Zugdiagonalenverband mit mit angeschlossenem Hysteresedämpfer. Mit dieser Tragwerkseinheit können dann Fachwerksysteme und ausgestellte Rahmensysteme aufgebaut werden, sodass deren Tragverhalten auf die Einwirkung starker Erdbeben abgestimmt wird. Vorschläge zur konstruktiven Gestaltung und und Anordnung des Mechanismus in drei Grundsystemen (Fachwerk, 2-Gelenkrahmen mit biegesteifen Rahmenknoten, eingespannter Rahmen) werden gemacht. Die Kontrolle der Verformungen im dualen Tragsystem wird vorgestellt und weiter analysiert. Das dynamische Verhalten der auf diese Weise erzielten Tragwerke wird unter reellen Erdbebenzeitverläufen (El-Centro, Kalifornien, Ägion, Kalamata Griechenland) untersucht.Im Rahmen dieser Analyse werden die Systeme, als Ein- und Zweimassenschwinger, mit einer über die Höhe gleichmäßig und dann ungleichmäßig verteilten Dämpfung, rechnerisch modelliert. Geeignete Steifigkeitsverhältnisse der Tragwerke, der Aussteifung und des Hysteresedämpfers werden in Bezug auf die gezielte Dämpfung ausgewählt, sodass das dynamische Verhalten der komplexen Systeme über die gewählten Steifigkeitsparameter optimiert werden kann. Schließlich werden konstruktive Aspekte der Integration der Systeme in Hinblick auf unerwünschte Interaktionseffekte mit nicht tragenden Bauteilen (Vorhangwand, Innenwände) analysiert.
Aktualisiert: 2020-02-19
> findR *

Faserverbundwerkstoffe eignen sich aufgrund ihres geschichteten Aufbaus besonders gut für die Integration zusätzlicher Funktionalitäten. Dabei können einerseits die Werkstoffeigenschaften gezielt optimiert werden, andererseits ist es möglich, mehrere Komponenten in einem Element zu vereinigen. Der umgebende Faserverbundwerkstoff schützt die strukturintegrierte Funktionalität, was zu robusten Systemen führt. Für architektonische Anwendungen sind die Integration von wärmespeichernden Materialien, der Einbau von Sensoren sowie die aktive mechanische Steuerbarkeit von Bauteilen von maßgeblicher Relevanz.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird die Einbettung faseroptischer Sensoren in Verbundwerkstoffe eingehender untersucht. Dabei werden optische Fasern mit integrierten Reflexionsgittern (Bragg-Gitter) verwendet - die bei der Lichtleitung reflektierte Wellenlänge lässt einen Rückschluss auf Dehnung und Temperatur in der Sensorfaser zu. Durch die Strukturintegration werden die Dehnung der optischen Faser und damit der resultierende Messwert von der Beschichtung der Sensorfaser sowie dem lokalen Laminatgefüge und von Fehlstellen beeinflusst. Eine mikromechanische Analyse zeigt, dass der dreidimensionale Dehnungszustand in der Sensorfaser nicht dem Dehnungszustand im umgebenden Faserverbundstoff entspricht. Temperaturdifferenzen und Dehnungen längs der Orientierung der Sensorfaser werden zwar affin in diese übertragen und können daher zuverlässig gemessen werden. Dehnung senkrecht zur optischen Faser werden von dieser jedoch weniger stark wahrgenommen und deren Einfluss auf das Messergebnis variiert außerdem erheblich, in Abhängigkeit des Laminataufbaus und der Faserbeschichtung. Praktische Versuche bestätigen umfänglich die rechnerischen Vorhersagen und zeigen grundsätzlich eine gute Leistungsfähigkeit strukturintegrierter faseroptischer Sensoren.
Die Untersuchungen bilden die Grundlage für die Entwicklung großformatiger Faserverbundbauteile mit automatisiert integrierten Sensorfasern. Die planmäßige Ermittlung von Querdehnungen ist bei strukturintegrierten Fasersensoren nicht zuverlässig möglich, weshalb deren Entkopplung erstrebenswert ist. Es hat sich als zielführend erwiesen, eine möglichst weiche Schutzschicht für die Sensorfaser einzusetzen, um die Effekte aus Querdehnung zu minimieren.
Da die Messergebnisse von der Orientierung der optischen Faser und den mechanischen Kennwerten des Laminats abhängen, ist eine präzise Vorhersage der Korrelation zwischen Einwirkung und Messsignal schwierig. Daher wird ein künstliches neuronales Netz zur Auswertung der Daten entwickelt, welches die beschriebenen Streuungen ausgleichen kann. Eine exemplarische Untersuchung beweist die Leistungsfähigkeit neuronaler Netze für die Auswertung strukturintegrierter Sensornetzwerke. Damit wird es auch möglich, neben der quantitativen Dehnungsermittlung auch qualitative Einwirkungsszenarien zu beschreiben und zu detektieren.
Aktualisiert: 2020-02-19
> findR *
MEHR ANZEIGEN
Oben: Publikationen von Universität Stuttgart Inst. f. Tragkonstr.
Informationen über buch-findr.de: Sie sind auf der Suche nach frischen Ideen, innovativen Arbeitsmaterialien,
Informationen zu Musik und Medien oder spannenden Krimis? Vielleicht finden Sie bei Universität Stuttgart Inst. f. Tragkonstr. was Sei suchen.
Neben praxiserprobten Unterrichtsmaterialien und Arbeitsblättern finden Sie in unserem Verlags-Verzeichnis zahlreiche Ratgeber
und Romane von vielen Verlagen. Bücher machen Spaß, fördern die Fantasie, sind lehrreich oder vermitteln Wissen. Universität Stuttgart Inst. f. Tragkonstr. hat vielleicht das passende Buch für Sie.
Weitere Verlage neben Universität Stuttgart Inst. f. Tragkonstr.
Im Weiteren finden Sie Publikationen auf band-findr-de auch von folgenden Verlagen und Editionen:
Qualität bei Verlagen wie zum Beispiel bei Universität Stuttgart Inst. f. Tragkonstr.
Wie die oben genannten Verlage legt auch Universität Stuttgart Inst. f. Tragkonstr. besonderes Augenmerk auf die
inhaltliche Qualität der Veröffentlichungen.
Für die Nutzer von buch-findr.de:
Sie sind Leseratte oder Erstleser? Benötigen ein Sprachbuch oder möchten die Gedanken bei einem Roman schweifen lassen?
Sie sind musikinteressiert oder suchen ein Kinderbuch? Viele Verlage mit ihren breit aufgestellten Sortimenten bieten für alle Lese- und Hör-Gelegenheiten das richtige Werk. Sie finden neben