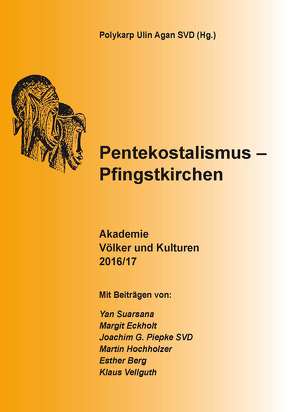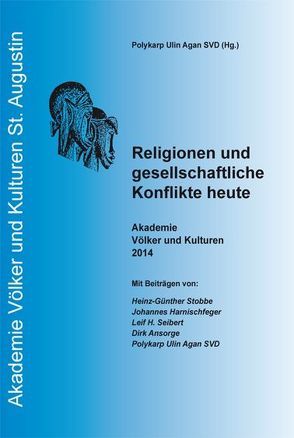Eine der ganz großen Bedrohungen für die Welt von heute ist die
epidemische Verbreitung von Lügen und Fake News. Diese Bedrohung ist
ernst zu nehmen, zumal sich falsche Nachrichten durch Teilen und Retweeten
deutlich schneller im Internet verbreiten als wahre Nachrichten.
Erschwerend kommt hinzu, dass die größten Fake-Protagonisten Rechtspopulisten
und Rechtsextreme sind. Sie versuchen mit verfälschten Informationen
die richtigen Menschen (Targeting) zu erreichen, in die richtigen
Kanäle (Context) vorzustoßen, die richtige Zeit (Timing) zu finden
und einen zielgerichteten Inhalt (Content) darzustellen.
Die Beiträge in diesem Sammelband setzen sich mit dem Thema
„Wahrheit und Lüge“ auseinander, einem Thema, dem die Akademie Völker
und Kulturen in Sankt Augustin eine hohe Bedeutung beimisst. Im
einleitenden Artikel zum Rahmenthema spricht Polykarp Ulin Agan SVD
von der Zerbrechlichkeit der Wahrheit. Wahrheit ist nicht ohne Grund ein
hohes Gut gerade in dieser Zeit voller Fake News. Dennoch ist es beinahe
unmöglich, sie in ihrer ganzen Komplexität zu leben geschweige denn zu
vermitteln. Stets stößt sie an ihre Grenze bei den Menschen – Menschen,
die ihre eigenen Interessen und Vorteile durchsetzen wollen. In diesem
Zusammenhang ist es wichtig, die Reichweite und Grenze der Wahrheitspflicht
zu zeigen. Eberhard Schockenhoff versucht in seinem Beitrag, die
Grenze der allgemeinen Wahrheitspflicht auszuloten und ein theologisches
Verständnis für die individuellen Besonderheiten des sittlichen
Handelns zu gewinnen.
In einem breiteren Kontext, vor allem in dem der Begegnung zwischen
den Religionen, bekommt die Wahrheit ein „anderes Gesicht“. Soll
jede Religion für sich einen Anspruch auf die absolute Wahrheit erheben
oder soll sie, etwa um der Friedensliebe willen, akzeptieren, dass es unterschiedliche
Standards von Wahrheit gibt, obwohl diese Standards untereinander
inkompatibel sind und nicht gegeneinander aufgerechnet
werden können? Reinhold Bernhardt weist einen Weg, um diese Spannung
aushalten zu können. Er plädiert dafür, sich der Notwendigkeit einer
Differenzierung zwischen Wahrheitsanspruch und Wahrheitsgewissheit in
der Diskussion um die Frage nach der Wahrheit in den Religionen gerade
im Zeitalter des Pluralismus zu stellen.
Die Diskussion um die Wahrheit wird im engeren Blickwinkel auf
kasuistische Fälle besonders virulent, verdeutlicht am Beispiel des Umgangs
mit den Setzungen des (Straf-)Rechtes. Frank Saliger geht in diesem
Zusammenhang der Frage nach, ob im Recht Lügen erlaubt ist oder
nicht. Diese Frage ist existenziell bedeutsam zum Beispiel im Hinblick
auf die Tatsache, dass ein Strafverteidiger nicht verpflichtet ist, in der
Ausübung seines Mandates die vom Strafverfolger ermittelte Wahrheit
zum Maßstab seines Handelns zu machen. Auch wenn er sicher ist, dass
sein Mandant der Täter ist, darf er einen Freispruch für ihn beantragen.
Sowohl im breiteren Kontext als auch in kasuistischen Fällen gilt es,
Wahrheit als „Wahrheit“ zu verteidigen. Fidelis Regi Waton SVD präsentiert
in seinem Beitrag evidente Vorstellungen der Wahrheit aus der Sicht
der Philosophie und beleuchtet sie durch unterschiedliche Theorien.
Wahrheit als „Wahrheit“ zu verteidigen ist umso wichtiger in einer
Zeit von Fake News, die für Manipulationen und Verschwörungstheorien
anfällig ist. Wer sagt in Zeiten von Fake News die Wahrheit und wie kann
man wahre Aussagen identifizieren? In diesem Band beleuchten namhafte
Experten diese Problematik aus unterschiedlichen Perspektiven: aus der
der Wissenschaft, der demokratischen Öffentlichkeit, der Medien und der
richterlichen Urteilsfindung sowie aus derjenigen der moralischen Lehren
in den Religionen.
Polykarp Ulin Agan SVD
Direktor Akademie Völker und Kulturen
Aktualisiert: 2023-02-07
> findR *
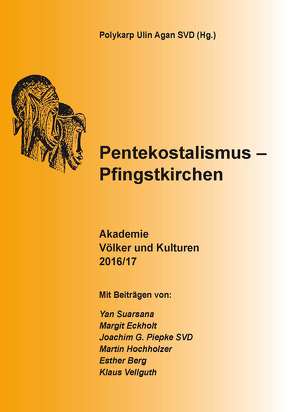
EINLEITUNG
In Form von verschiedenen Erweckungsbewegungen oder Inspirationsgemeinden
ist im 18. Jahrhundert eine Strömung im Christentum
wahrzunehmen, die das Wirken des Heiligen Geistes in die Mitte ihres
Glaubenshandelns stellte und sich deshalb Pfingstbewegung nannte. Für
diese Bewegung, aus der die Charismatische Bewegung, die Wort-des-
Glaubens-Bewegung und die Neocharismatische Bewegung entstanden
sind, war die „traditionelle Kirche“ zu sehr auf die Philosophie des Seins
fixiert, sodass sie die Dynamik des Werdens im Glaubensleben vernachlässigte.
Eine solche Kirche ist für sie weit entfernt von den neutestamentlichen
Gemeinden, weil sie dem Wirken des Heiligen Geistes – insbesondere
den Geistesgaben wie Heilung, Prophetie und Zungenrede –
gegenüber gleichgültig ist.
Als eine dynamische Bewegung des Werdens prägt die Pfingstbewegung
weltweit Teile des Christentums, vor allem in der so genannten Dritten
Welt. Durch Globalisierung, in heutiger Zeit vor allem verstärkt durch
weltweite Migrationsbewegungen, findet diese Bewegung stets fruchtbaren
Boden, auf den sie ihre Saat streuen und woraus sie die Früchte ihrer
Mühen und ihres Engagements ernten kann. In Südafrika z. B. gehören
80 % der schwarzen Christen zu den neuen Kirchen der Pfingstbewegung.
Im Kontext Lateinamerikas, vor allem Brasiliens, beschreibt José
Eustáquio Alves, Demografieforscher an der Hochschule für Statistik
(Escola Nacional de Ciências Estatísticas) in Rio de Janeiro, die dortige
rasante Entwicklung der Pfingstbewegung mit den Worten: „Brasilien ist
einzigartig: Es ist das einzige große Land, das in so kurzer Zeit eine so
tiefgreifende Veränderung seiner religiösen Landschaft erlebt hat.“ Gemeint
ist eine religiöse Revolution, die sich in der extremen Ausbreitung
der evangelikalen protestantischen Kirchen zeigt. 1970 bekannten sich
noch 92 % der Bevölkerung zum Katholizismus; 2010 waren es nur noch
64,6 %. Seiner Prognose nach sieht es so aus, dass im Jahr 2030 die Mitgliederzahl
des Katholizismus und die der protestantischen Gemeinden
(traditionellen und evangelikalen) gleichauf liegen wird. In Deutschland
gibt es, wenn auch die Mitgliederzahl dieser Bewegung hier vergleichsweise
gering ist, doch eine zunehmende Tendenz, sowohl bei der größten
Pfingstgemeinschaft, dem Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden (BFP),
8
der nach eigenen Angaben rund 30 000 Mitglieder hat, als auch bei den
anderen Pfingstgruppen, die zwischen 1 000 und 4 000 Mitglieder zählen.
Die Akademie Völker und Kulturen St. Augustin ist sich dieses weltweiten
Phänomens bewusst und widmete ihre Vortragsreihe im Vortragssemester
2016/17 der Herausforderung des Pentekostalismus zwischen
„Fragilität und Empowerment“ (Moritz Fischer) – einer Herausforderung,
die die von uns praktizierte Art und Weise der Verkündigung, Gemeindebildung
und -leitung sowie die Rolle des Heiligen Geistes, die Bedeutung
der Spiritualität und den Stellenwert von Emotionen im Glaubensleben in
Frage stellen kann.
Mit PENTEKOSTALISMUS – PFINGSTKIRCHEN als Thema der
Akademie Völker und Kulturen möchten wir einen Beitrag leisten zur
Wahrnehmung der Grenzverläufe zwischen säkular und sakral, zwischen
Religion, Politik und Kultur sowie all ihren Manifestationen in einer immer
stärker globalisierten Welt. Dass hier keine eindimensionalen Erklärungen
sowie pauschale, normative Bewertungen zu erwarten sind, liegt
auf der Hand.
Ohne in ebensolche Bewertungen zu verfallen, vermittelt Dr. Yan
Suarsana (Heidelberg) einen Überblick, wie die Wirkung der Pfingstbewegung
auf die gesellschaftlichen und religiösen Verhältnisse im heutigen
jeweiligen Kontext wahrgenommen wird. Diese Wahrnehmung ist
umso bedeutender im Wissen um die Tatsache, dass weltweit die traditionellen
Kirchen einen gravierenden Mitgliederverlust verzeichnen, während
die Pfingstbewegung enorme Wachstumsraten aufweisen kann.
In Lateinamerika zum Beispiel ist die Pfingstbewegung auf dem
Vormarsch, was zur Folge hat, dass die katholische Kirche auf dem „katholischen
Kontinent“ immer mehr Mitglieder verliert. Prof. Dr. Margit
Eckholt (Osnabrück) zeigt in ihrem Beitrag auf, wie dieser Mitgliederverlust
im Kontext Lateinamerikas im Grunde ein normaler Trend der
Entwicklung auf globaler Ebene ist. Wahrgenommen wird dies durch die
Tatsache, dass sich jedes Jahr Millionen von Menschen einer der zahllosen
Pfingstkirchen anschließen. Experten schätzen die Anhängerschaft
dieser Bewegung sogar bereits auf eine halbe Milliarde Menschen. Ein
Kennzeichen dieser Bewegung ist ihre Unabhängigkeit von festen Strukturen
und Dogmen. Fragen, die sich dabei stellen, sind: Wie können die
Besonderheiten der Dynamik dieser Bewegung wahrgenommen werden?
9
Hat diese Bewegung Einfluss auf den sozialen Wandel und religiösen
Habitus überhaupt?
Im Rahmen des noch engeren Kontexts Lateinamerikas ist Brasilien
hier ein „einzigartiges Phänomen“. Beim letzten Zensus von 2010 ist
auffällig, dass die Katholiken 2010 zum ersten Mal in absoluten Zahlen
hinter dem Wachstum der Bevölkerung zurückblieben. Die Pentekostalen
in ihrer Gesamtheit erreichten mehr als 22 %. Prof. em. Dr. Joachim G.
Piepke (St. Augustin) sieht hinter dieser dynamischen Entwicklung einige
Elemente, die für diese Bewegung in Brasilien charakteristisch sind: 1)
Archaische Religionsformen der antiken Mysterienreligionen kommen in
dieser Bewegung wieder zum Durchbruch, die eigentlich durch das
Evangelium der Bergpredigt Jesu überwunden schienen; 2) Charismatiker
und Pentekostale aller Schattierungen haben diesen einen Punkt gemeinsam,
sie zielen auf die persönliche Bekehrung des Gläubigen ab, die
durch so genannte übernatürliche Zeichen der Geistbesessenheit und daraus
folgende übernatürliche Wundertaten von Gott her bestätigt wird; 3)
die direkte Kommunikation mit Gott, Göttern oder Geistern verleiht dem
Gläubigen Identität, Selbstbewusstsein und Hoffnung auf irdisches Wohlergehen.
Auffällig ist hier, dass die Pfingstbewegung variantenreiche Gemeinden
und Gemeinschaften hervorbringt. Es gibt Gemeinden und Gemeinschaften,
die darauf eingestellt sind, politische Entscheidungen und gesellschaftliches
Leben mitzubestimmen. Wieder andere fühlen sich berufen,
sich in sozialen Projekten zu engagieren, um den Benachteiligten zu
helfen und sie zu unterstützen. In allem bekunden diese Bewegungen den
gleichen Grundtenor: die Gleichheit aller vor den Gaben des Heiligen
Geistes. Dr. Martin Hochholzer (Leipzig) betrachtet diese Dynamik aus
theologischer Perspektive und wirft sinngemäß die Frage auf: Sind die
charismatischen Erfahrungen in den christlichen Kirchen ein Zeichen der
Wiederentdeckung des Heiligen Geistes nach dem Motto: „Alle sozialen
und intellektuellen Veränderungen sind von der Existenz einer spirituellen
Kraft abhängig, ohne die sie nicht hätten geschehen können“ (Christopher
Dawson)?
Wird das theologische Phänomen der „Wiederentdeckung des Heiligen
Geistes“ als Anfrage an die seinsorientierten Großkirchen gesehen, so
kann festgestellt werden, dass die traditionellen Großkirchen es sich nicht
10
mehr leisten können, gegenüber der Pfingstbewegung Verachtung und
Ignoranz zu zeigen. Auch wenn innerhalb der Pfingstbewegungen die
Dialogangebote seitens der Großkirchen unterschiedlich wahrgenommen
werden, sollten sie doch nicht aufhören – vor allem auf theologischer
Ebene – sich weiterhin denkerisch damit auseinanderzusetzen, um sich
der Wahrheit anzunähern. Einen ehrlichen Dialog sollen sie pflegen im
Wissen darum, dass es nicht einfach ist, einen Dialogmodus zu finden,
der allen Betroffenen gerecht wird, da bei den Pfingstbewegungen die
Heterogenität und die Wandelbarkeit ihre Existenz so sehr prägend sind.
Trotz mancher negativer Schlagzeilen in der stürmischen Entwicklung
der Pfingstbewegungen kommt Esther Berg (Frankfurt) zur Überzeugung,
dass das Phänomen dieser stürmischen Bewegungen die traditionellen
Großkirchen zum Nachdenken bringen kann, wie sie auf die Sinnfragen
und religiösen Bedürfnisse moderner Menschen in einer globalisierten
Welt Antwort finden können. Zeigt nicht dieses Phänomen eine große
Sehnsucht vieler nach Religion, Spiritualität und Heil?
Klar ist, dass eine Verständigung unter den Kirchen auf das gemeinsame
Ziel in dieser Zeit immer undeutlicher geworden zu sein scheint.
Das Problem liegt vielleicht darin, dass die konfessionelle Identität jeder
„Kirche“ nicht so deutlich zum Tragen kommt, sodass das „Wozu der
Einheit“ bei jedem Dialog auf dem Weg zur Einheit stets neu gefunden
werden muss. Hinzu kommt in der letzten Zeit eine weitere zentrale Herausforderung
für die „Kirchen“ überhaupt, die eng mit dem starken Anwachsen
von pentekostalischen Bewegungen verbunden ist. Kann man
hier nicht von einer „Pentekostalisierung der Ökumene“ (Kurt Kardinal
Koch) reden? Prof. Dr. Klaus Vellguth (Aachen) greift diese Frage in
seinem Beitrag auf und fordert die Großkirchen auf, eine neue Rückbesinnung
auf ihre eigene konfessionelle Identität in die Wege zu leiten.
Spielen sie bereits ihre Rolle als „Sakrament des Heiles“ in der Welt oder
steht bei ihren Handlungen mehr die Machtfrage im Vordergrund?
Mein Dank gilt allen, die zur Planung und Durchführung der Vortragsreihe
sowie zur Veröffentlichung der Vorträge beigetragen haben.
Polykarp Ulin Agan SVD
Direktor Akademie Völker und Kulturen
Aktualisiert: 2023-02-07
> findR *
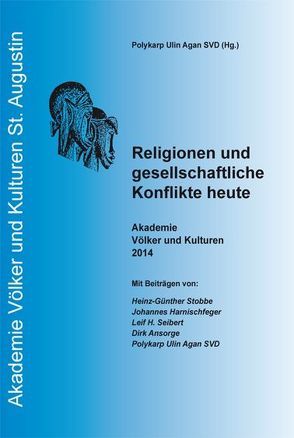
Gegenwärtig macht die Mobilität von Menschen so viele kulturelle Kontakte möglich, dass die Frage nach Zugehörigkeiten und Identitäten von Individuen und Gruppen neu aufgeworfen werden muss. Das Hin-einwachsen in eine interkulturelle Umwelt ist damit unvermeidbar, kann aber auch aufgrund ständiger Berührung Konflikte hervorrufen. Die Hu-manwissenschaften sind deshalb aufgefordert, sich neu zu orientieren und sich auf die Grundlage kompetenter Gegenwartsanalyse zu stellen. Diese Neuorientierung bedarf jedoch einer ständigen Prüfung und kritischen Durchsicht, um einer vorurteilsfreien Darstellung ihrer Normbildung näherzukommen.
Prozesse gesellschaftlicher, sozialer und religiöser Normbildung in einer Situation, die immer mehr von Konflikten und Auseinandersetzungen als Folge von Globalisierung in allen Aspekten des Lebens geprägt ist, gehen Hand in Hand mit der Bildung neuer Identitäten, die sich so ausformen, dass lokale und globale, traditionale und moderne Elemente situationsgerecht miteinander verwoben werden. Diese neuen Identitäten lassen sich nicht mehr adäquat als in sich geschlossene Monaden auffassen, sondern vielmehr als „multiphrenic identity“ (Kenneth J. Gergen), eine Modellierung von Identitäten als Netzwerk aus kognitiven und affektiven Dispositionen des Wahrnehmens, Urteilens und Handelns.
Die Akademie Völker und Kulturen St. Augustin ist sich dieser aus der „multiphrenic identity“ erwachsenen Konflikte bewusst und sieht für die Entwicklung von Religion und Theologie mit normativem Anspruch, etwa in Gestalt einer Friedensethik, das Ineinandergreifen gesellschaftlicher Bedingungen als eine wichtige Voraussetzung. Das vorliegende Buch unserer Reihe beschäftigt sich deshalb mit der Frage nach Religion, gesellschaftlichen Konflikten und Theologie im Allgemeinen sowie nach den konkreten religiös-gesellschaftlichen Konflikten in unterschiedlichsten Ländern im Besonderen.
Im Rahmen einer zielgerichteten Durchführung dieses Rahmenthemas widmet sich der erste Beitrag von Prof. Dr. Heinz-Günther Stobbe zum einen der problematischen ambivalenten Rolle von Religion und Theologie bei politischen und gesellschaftlichen Konflikten, zum anderen aber auch der Rolle von theologisch begründeten Glaubensüberzeugungen bei der Konfliktbearbeitung. Die Theologen und Theologinnen der großen Religionen spielen bei diesen Konflikten und deren Bearbeitung eine große Rolle. Sie „sind gehalten, miteinander mit Leidenschaft dar-über nachzudenken, welche fundamentalen Prinzipien und Basisnormen wir als Menschen akzeptieren müssen, um Vielfalt in Einheit und Einheit in Vielfalt, um in Frieden und Gerechtigkeit wahrhaft miteinander leben zu können“.
Ein weiterer Beitrag von Dr. Dr. Johannes Harnischfeger lenkt unseren Blick auf den Schwarzen Kontinent, besonders auf das „Krankheitssymptom“ Boko Haram in Nigeria, das auch als weltweites Phänomen in Betracht gezogen werden soll. Seit einigen Jahren mehren sich terroristische Anschläge in Nigeria. Verantwortlich für die Anschläge ist häufig die radikal-islamische Sekte Boko Haram, die seit Ende 2010 den Namen „Verband der Sunniten für den Aufruf zum Islam und für den Dschihad“ trägt. Ihr Kampf für eine strikte Form der Scharia richtet sich einerseits gegen die korrupten staatlichen Akteure, andererseits aber auch gegen die christlichen Kirchen, was dazu führt, dass die Mitglieder der Gruppe in den Medien häufig als „Christenjäger“ bezeichnet werden. Aufgrund der komplexen Gemengelage in Nigeria ist es schwierig vorauszusehen, ob der ersehnte Frieden in naher Zukunft Wirklichkeit werden wird. „Mit einem Abkommen, das die Feindseligkeiten zwischen Nigerias Regierung und den Rebellen beendet, ist jedoch nicht zu rechnen, selbst wenn Boko Haram durch den Abnutzungskrieg mit der Armee weiter geschwächt werden sollte. Möglich aber ist, dass die Organisation in kriminelle Banden zerfällt, für die die religiöse Mission nur noch ein Vorwand ist, um zu plündern und Geld zu erpressen.“
Mehr Grund für Hoffnung auf Frieden gibt Leif Seibert, Mitarbeiter am „Center for the Interdisciplinary Research on Religion and Society“ (CIRRuS) in Bielefeld, in seinem Beitrag über die Glaubwürdigkeit als religiöses Vermögen im bosnisch-herzegowinischen Friedensprozess. Der Friedensvertrag von Dayton, der unter der Leitung des damaligen US-Präsidenten Bill Clinton im November 1995 nach zähen Verhandlungen ausgehandelt und am 14. Dezember desselben Jahres in Paris unterzeichnet wurde, setzte dem vierjährigen Bürgerkrieg im heutigen Bosnien-Herzegowina ein Ende. In den vergangenen 18 Jahren ist zwar das Gewaltniveau in dieser Region erheblich zurückgegangen, aber der Frieden bleibt weiterhin brüchig. Dennoch gibt es Grund zur Hoffnung, wenn wir unseren Blick auf die Tatsachen richten, dass in der neuen Entwicklung immer mehr für die „konsensfähige Autorität“ plädiert wird und immer mehr „Misstrauen gegen ideologische Konstrukte (Populismus)“ entsteht. Dieses „spricht für eine anti-fundamentalistische Haltung“.
Der brüchige Frieden zeigt sich am deutlichsten in den gewaltsamen Konflikten im Nahen Osten, der „zu den unruhigsten und konfliktreichsten Regionen der Welt“ zählt, wie Prof. Dr. Dirk Ansorge in seinem Beitrag zeigt. Der Nahostkonflikt, der zu sechs Kriegen zwischen dem am 14. Mai 1948 gegründeten Staat Israel und einigen seiner Nachbarstaaten geführt hatte, holt nicht nur die direkt beteiligten Akteure, sondern auch vor allem die Länder und Organisationen des Nahost-Quartetts, nämlich die USA, Russland, die EU und die UNO, ins Boot. In Deutschland gehört die Einschätzung der Rolle des Staates Israels im Nahostkonflikt zu den wohl mit am emotionalsten und heftigsten diskutierten politischen Fragen. Spielen in Konflikte verwickelte Religionen – Judentum, Christentum und Islam – eine wirksame friedensfördernde Rolle oder vermindern sie eher die Kompromissfähigkeit der in diesen Konflikt verwickelten Parteien? Mit seinem Beitrag möchte Prof. Ansorge uns einerseits auf das Verhältnis von Religionen, Identität und Konflikt, andererseits aber auch auf die Instrumentalisierung von Religionen in gewaltsamen Konflikten aufmerksam machen.
Der letzte Beitrag von Dr. Polykarp Ulin Agan SVD kreist auch um das Verhältnis von Religionen, Identität und Konflikt, und zwar im Kontext seiner Heimat Indonesien unter dem Aspekt des Konfliktes zwischen den Säkularisten und Islamisten. Seit der Unabhängigkeit Indonesiens im Jahre 1945 steht die Frage nach dem Verhältnis von Politik, Religion und Zivilreligion ständig zur Debatte. Es geht meistens um die Unterscheidung zwischen den Vorstellungen von einem „Islamischen Staat“ und einem „Staat auf der Grundlage der edlen Ideale des Islams“. Es ist eine Tatsache, dass in Indonesien religiöse Angelegenheiten oft zu staatlichen gemacht werden, sodass Interessenkonflikte nicht vermieden werden können.
Zu fragen ist bei der ganzen Problematik hinsichtlich des Themas „Religionen und gesellschaftliche Konflikte heute“ allerdings: Sind Religionen Kriegstreiber oder Friedensstifter? Sind sie gesellschaftliche Integrations- oder Konfliktfaktoren? Es gilt, nach dem Wesen von Religion(en) zu fragen, um den Blick auf die Problematik von Religion(en) und Kultur(en) sowie Religion(en) und Identitätsstiftung zu eröffnen. Es ist nicht unmöglich, dass sich dabei praktische Entwicklungen von Strate-gien der Konflikttransformation offenbaren, die die weltliche Zivilgesellschaft sowie die religiösen Gemeinschaften zu einer Welt zusammenführen können – einer Welt, die mehr Frieden verspricht als Unfrieden stiftet. Da leider die Konflikte in unserer Zeit keineswegs weniger geworden sind, sondern sich vielmehr noch verstärkt und erweitert haben, leisten die Vorträge in dieser Reihe im Rahmen der Kultur des Friedens und der Bewusstseinsbildung einen wesentlichen Beitrag, gerade weil die Gedanken und Hintergrundinformationen, die in den verschiedenen Vorträgen geboten werden, weithin wichtig sind.
Aktualisiert: 2023-02-07
> findR *
MEHR ANZEIGEN
Bücher von Agan SVD, Polykarp Ulin
Sie suchen ein Buch oder Publikation vonAgan SVD, Polykarp Ulin ? Bei Buch findr finden Sie alle Bücher Agan SVD, Polykarp Ulin.
Entdecken Sie neue Bücher oder Klassiker für Sie selbst oder zum Verschenken. Buch findr hat zahlreiche Bücher
von Agan SVD, Polykarp Ulin im Sortiment. Nehmen Sie sich Zeit zum Stöbern und finden Sie das passende Buch oder die
Publiketion für Ihr Lesevergnügen oder Ihr Interessensgebiet. Stöbern Sie durch unser Angebot und finden Sie aus
unserer großen Auswahl das Buch, das Ihnen zusagt. Bei Buch findr finden Sie Romane, Ratgeber, wissenschaftliche und
populärwissenschaftliche Bücher uvm. Bestellen Sie Ihr Buch zu Ihrem Thema einfach online und lassen Sie es sich
bequem nach Hause schicken. Wir wünschen Ihnen schöne und entspannte Lesemomente mit Ihrem Buch
von Agan SVD, Polykarp Ulin .
Agan SVD, Polykarp Ulin - Große Auswahl an Publikationen bei Buch findr
Bei uns finden Sie Bücher aller beliebter Autoren, Neuerscheinungen, Bestseller genauso wie alte Schätze. Bücher
von Agan SVD, Polykarp Ulin die Ihre Fantasie anregen und Bücher, die Sie weiterbilden und Ihnen wissenschaftliche Fakten
vermitteln. Ganz nach Ihrem Geschmack ist das passende Buch für Sie dabei. Finden Sie eine große Auswahl Bücher
verschiedenster Genres, Verlage, Schlagworte Genre bei Buchfindr:
Unser Repertoire umfasst Bücher von
Sie haben viele Möglichkeiten bei Buch findr die passenden Bücher für Ihr Lesevergnügen zu entdecken. Nutzen Sie
unsere Suchfunktionen, um zu stöbern und für Sie interessante Bücher in den unterschiedlichen Genres und Kategorien
zu finden. Neben Büchern von Agan SVD, Polykarp Ulin und Büchern aus verschiedenen Kategorien finden Sie schnell und
einfach auch eine Auflistung thematisch passender Publikationen. Probieren Sie es aus, legen Sie jetzt los! Ihrem
Lesevergnügen steht nichts im Wege. Nutzen Sie die Vorteile Ihre Bücher online zu kaufen und bekommen Sie die
bestellten Bücher schnell und bequem zugestellt. Nehmen Sie sich die Zeit, online die Bücher Ihrer Wahl anzulesen,
Buchempfehlungen und Rezensionen zu studieren, Informationen zu Autoren zu lesen. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
das Team von Buchfindr.