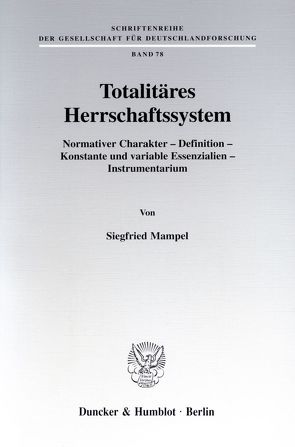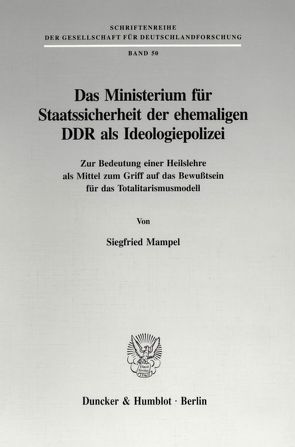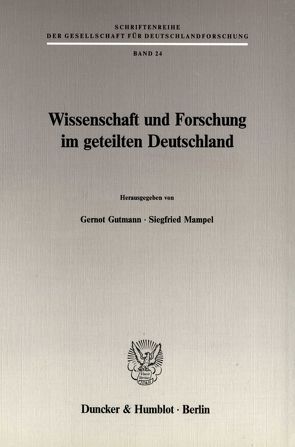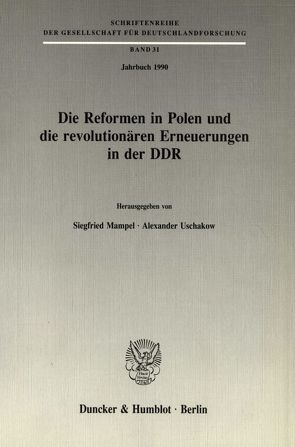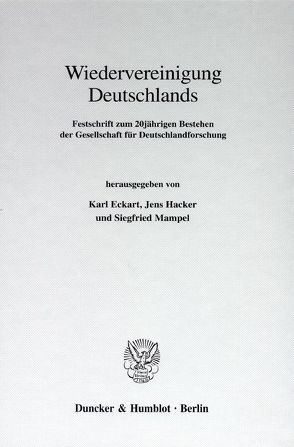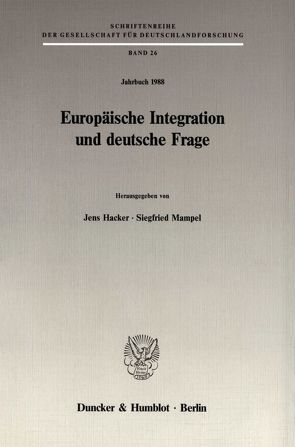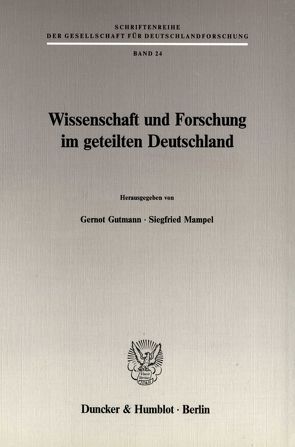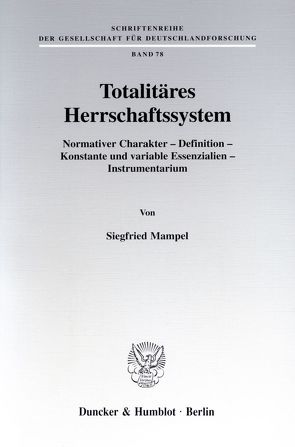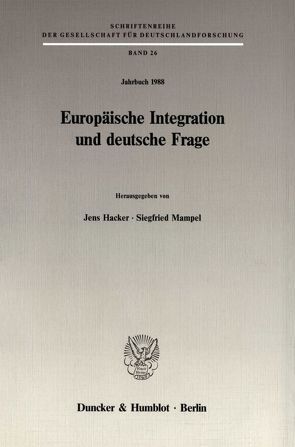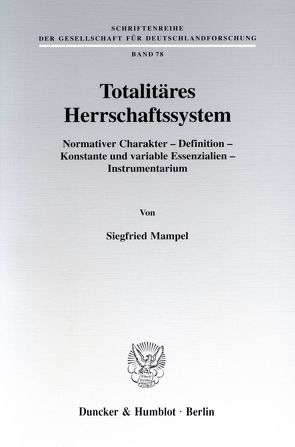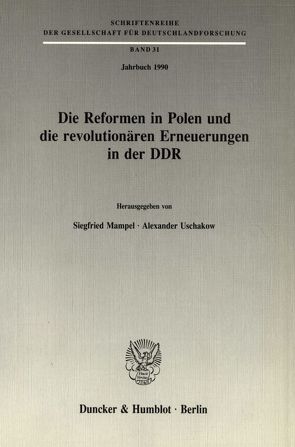Vorwort
Mit dem Thema ihrer 5. wissenschaftlichen Arbeitstagung "Kultur im geteilten Deutschland" setzte die Gesellschaft für Deutschlandforschung am 10. und 11. März 1983 ihr Streben fort, jeweils ein für Deutschland als Ganzes relevantes Feld multidisziplinär zu behandeln. Das vorliegende Jahrbuch enthält die auf dieser Tagung gehaltenen, überarbeiteten Referate.
"Kultur ist in jedem Sinne die Vervollkommnung eines Bestehenden durch darauf gerichtete menschliche Tätigkeit. Das Bestehende ist einerseits das Menschenwesen selbst, andererseits die außermenschliche Natur. Die Vervollkommnung besteht darin, daß der Mensch in immer höherem Maße zur Selbsterkenntnis und Selbstbeherrschung, Naturerkenntnis und Naturbeherrschung gelangt, bis er, auf der höchsten Stufe, die Natur in höchster Einsicht, mit Freiheit, seinen höchsten Zwecken dienstbar machen kann. Das Kulturideal ist mit den Worten Schillers ausgedrückt, daß der Mensch mit der höchsten Fülle von Dasein die höchste Selbstverständlichkeit und Freiheit verbinde und anstatt sich an die Welt zu verlieren, diese in sich ziehe und der Einheit seiner Vernunft unterwerfe". So wird der Begriff "Kultur" in dem fast 70 Jahre alten "Philosophischen Wörterbuch" (Leipzig 1916) erläutert.
Ganz anders erklärt das in der DDR erschienene "Kleine politische Wörterbuch" (Berlin (Ost) 1973) diesen Begriff. Dort lesen wir, Kultur sei "Bestandteil und Ergebnis der gesamten menschlichen Tätigkeit, in der die Menschen ihre praktischen und geistigen Fähigkeiten vor allem durch die Arbeit vergegenständlichen und damit den Prozeß der Entwicklung der Gesellschaft und des Menschen selbst praktisch realisieren. In der Kulturentwicklung drückt sich aus, inwieweit sie zum Herren ihrer eigenen Vergesellschaftung geworden sind. Kultur ist der erreichte Grad der menschlichen Herrschaft über objektive Prozesse in Natur und Gesellschaft und deren Nutzung zu menschlichen Zwecken. Das ist ein ständiger historischer Prozeß der Vervollkommnung des menschlichen Daseins, an dem die Individuen entsprechend ihrer sozialen Stellung auf unterschiedliche Art und Weise teilnehmen. Die Kultur entsteht sowohl in der ökonomischen Basis als auch im ideologischen Überbau. Diese bestimmen zugleich den sozialen Inhalt und die gesellschaftliche Funktion der Kultur. Schöpfer der Kultur sind sowohl die in der materiellen Produktion Tätigen als auch die geistig Schaffenden". Sodann etwas später: "In der antagonistischen Klassengesellschaft trägt die Kultur Klassencharakter, sie wird von den herrschenden ökonomischen, politischen und ideologischen Verhältnissen bestimmt und ist selbst Ausdruck dieser Verhältnisse. Ihren konkreten Lebensverhältnissen entsprechend entwickeln die unterdrückten Klassen Elemente einer demokratischen Kultur. Die herrschende Kultur ist aber stets die Kultur der herrschenden Klassen". Und weiter: "Mit dem Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus ergibt sich die Notwendigkeit der revolutionären Umwälzung des ideologischen Überbaus und damit auch der Kultur durch die sozialistische Kulturrevolution". Schließlich: "Bei der planmäßigen Entwicklung der sozialistischen Kultur geht es um die Gesamtheit der Lebensbedingungen, der materiellen und geistigen Werte, Ideen und Kenntnisse, durch deren Aneignung die Menschen in Gemeinschaft mit anderen zu fähigen, gebildeten und überzeugten Erbauern des Sozialismus, zu wahrhaft sozialistischen Persöhnlichkeiten reifen (Hager)".
Obwohl zwischen beiden Definitionen Jahrzehnte liegen, haben sie gemeinsam, daß Kultur als Ergebnis menschlicher Tätigkeit angesehen wird, die auf Vervollkommnung von Bestehendem, auf eine Entwicklung gerichtet ist. Doch damit endet die Gemeinsamkeit, und es zeigen sich fundamentale Gegensätze, die nicht durch die Zeitdifferenz allein erklärt werden können, sondern extreme Positionen auf dem Felde der Kultur markieren. Die eine sieht den Menschen ausschließlich als Individuum, das sich selbst und die Natur erkennt und beherrscht, das die Natur in Freiheit seinen höchsten Zwecken dienstbar macht. Jeder Bezug auf eine Gemeinschaft oder die Gesellschaft fehlt. Der sich selbst bestimmende Mensch ist das Leitbild des Liberalismus um die Jahrhundertwende. Die andere sieht den Menschen als vergesellschaftetes Wesen, klassengebunden, und damit, sobald die "Arbeiterklasse" zur herrschenden Kraft geworden ist, mit der unausweichlichen Folge, daß er von der Avantgarde des Proletariats, der marxistisch-leninistischen Partei, genauer von deren Führung, zu lenken und in seiner Tätigkeit zu bestimmen ist, wenn er nicht das, was die Parteiführung für richtig hält, zur eigenen Überzeugung macht. Insoweit ist der Mensch einer Außenlenkung, einer Fremdbestimmung bedürftig.
Das sich selbstbestimmende, isolierte Einzelwesen ist nur in einer Gesellschaft möglich, die so offen ist, daß ihr Dasein für den Kulturbegriff nicht relevant erscheint. Der vergesellschaftete und, wenn nicht überzeugte Anhänger der Parteilinie, fremdzubestimmende Mensch ist nur in einer geschlossenen Gesellschaft denkbar.
Hier scheinen sich unüberbrückbare Abgründe aufzutun. Indessen ist zu bedenken, daß beiden Definitionen Leitbilder vom Menschen zugrundeliegen, die trotz ihrer Gegensätzlichkeit, das eine wie das andere, der Verfizierung anhand der Wirklichkeit bedürfen. So hat die bewegende Frage zu lauten: Läßt sich das kulturelle Leben im geteilten Deutschland wirklich diesen Definitionen zuordnen oder erweisen diese sich nur als Ansprüche, die von extrem unterschiedlichen Positionen an die Kultur gestellt werden?
Der vorliegende Band zeigt, daß kulturelles Leben jeder Schablone widerspricht. Für eine offene Gesellschaft ergibt sich das aus ihrem Charakter. Indessen zeigen sich auch in einer geschlossenen Gesellschaft immer wieder Bestrebungen einzelner, sich einer Fremdbestimmung zu widersetzen. Diese Tendenzen können sogar so stark sein, daß die Mächtigen dem Geist Tribut zollen, indem sie entweder ihre Linie ändern oder doch Dissidenten dulden, wohlgemerkt auf dem Gebiet der Kultur, nicht der Politik, wenn es auch manchmal schwer fällt, beide voneinander zu trennen.
Jürgen Rühle zeigt das anschaulich in seinem Beitrag über die marxistisch-leninistische Kulturpolitik. Hier kommt ein Mann zu Wort, der nach eigenem Erleben in der SBZ/DDR nunmehr von außen die kulturelle Szene dort mit wachem Auge zwar kritisch, aber doch objektiv beobachtet. Anders ist der Beitrag von Erwin K. Scheuch aufzufassen. Hier äußert sich ein subjektiver Beobachter, der wie es nur in einer offenen Gesellschaft möglich ist, die kulturellen Tendenzen in der Bundesrepublik Deutschland von seiner sehr liberalen Warte aus kritisch beleuchtet und dabei auch Widerspruch bewußt in Kauf nimmt oder sogar provoziert, zumal von denen, die sich mehr Gesellschaftsbezogenheit wünschen. Ein Bezug zur DDR wird nicht unmittelbar hergestellt. Aber die für uns hierzulande selbstverständliche Möglichkeit einer solchen kritischen Betrachtung kontrastiert so von den Verhältnissen im "realen Sozialismus", wie sie von Jürgen Rühle dargelegt werden, daß sich für den wachen Leser der Vergleich von selbst einstellt. Klaus-Eberhard Murawski zeichnet ein aufschlußreiches Bild vom Stand der innerdeutschen Kulturbeziehungen und von den Bemühungen der Bundesregierung um ein Kulturabkommen zwischen den beiden Staaten in Deutschland. Es bleibt zu hoffen, daß so der Zusammenhalt der deutschen Nation auf dem wichtigen Gebiet der Kultur gefördert werden kann.
Weil in der Bundesrepublik Deutschland die Freiheit von Kunst und Wissenschaft, der Kultur, verfassungsrechtlich verbürgt und durch die öffentliche Meinung in ihrer Vielfalt sowie durch die Gerichte garantiert ist, brauchte es Einzelnachweise dafür nicht. Anderes gilt für die DDR. Die Beiträge von Peter Dittmar (Bildende Kunst), Hermann Heckmann (Architektur), Andreas Roßmann (Theater) sowie Jörg Bernhardt Bilke (Literatur) zeigen für ausgewählte Bereiche, wie das Verhältnis von Macht und Geist in der "sozialistischen" DDR sich gestaltete und wie es derzeit darum steht. Sie bestätigen, daß es auch in einem totalitären System Kulturschaffende gibt, die versuchen, sich der Fremdbestimmung zu entziehen. Manchen gelingt es, zuweilen mit List, sich dem Druck der Mächtigen zu entziehen, manchen kostet es die Existenz in ihrer Heimat. Indessen bleibt auch dem geduldeten "Abweichler" die Last der Ungewißheit über die Dauer der Toleranz.
Hans Borgelt zeichnet in seiner formvollendeten Diktion das Stück Berliner Theatergeschichte nach, währenddessen im Ostteil der Stadt das freie Theater ein Opfer kommunistischer Kulturpolitik wurde. Auch das gehört zur Entwicklung der Kultur im geteilten Deutschland.