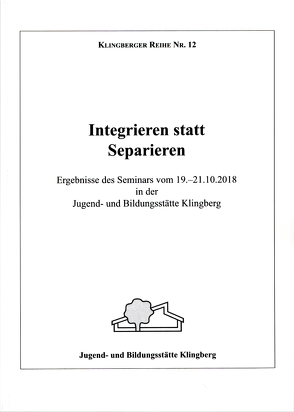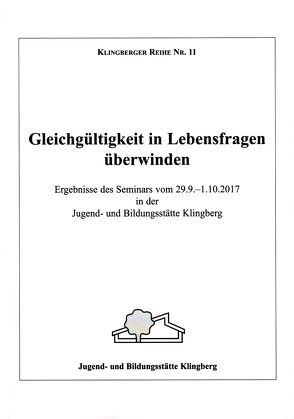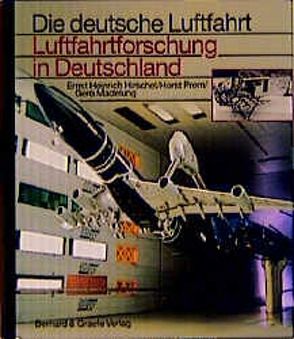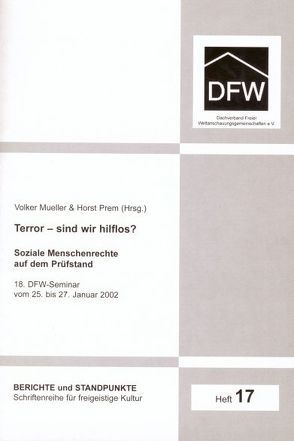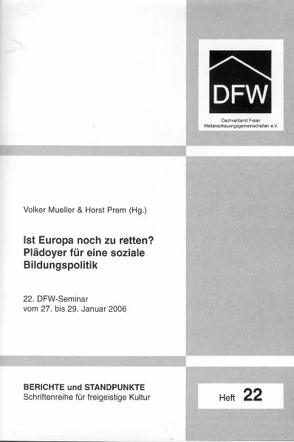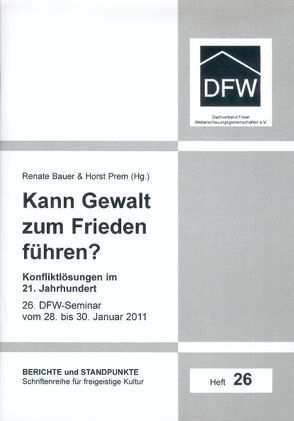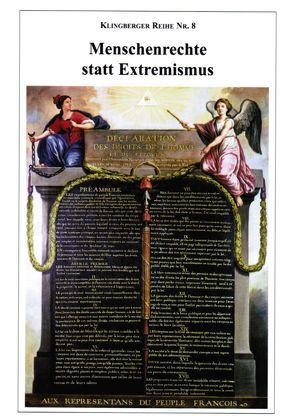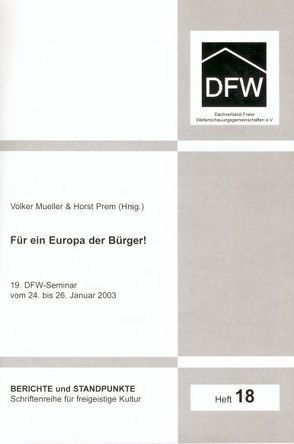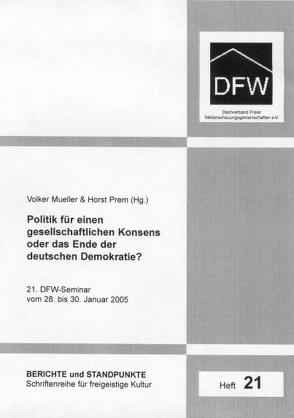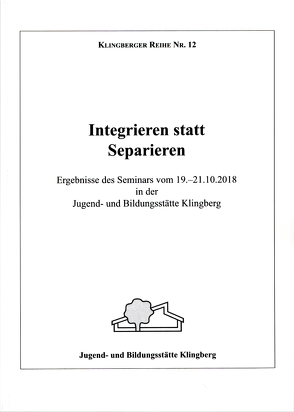
Extremismusprävention beginnt im Werteunterricht an den Schulen. Wesentliche Elemente dazu haben wir in der Klingberger Reihe Nr. 9 unter diesem Stichwort zusammengetragen. Mit der Konzeption, viele Konfessionsunterrichte entsprechend einer pluraler werdenden Gesellschaft in der Schule zu etablieren, fahren wir gegen die Wand. Tolerenz ist im geschlossenen Klassenverband überhaupt erst lernbar. In getrennten Konfessionsunterrichten nach Artikel 7(3) GG, die ja Bekenntnisunterrichte sind, wird die Integrationsfähigkeit einer pluralen Gesellschaft aufs Spiel gesetzt.
Ist unser GG reformbedürftig? Wo muss der Integrationsunterricht im GG verankert werden? Oder ist das bereits eine europäische Aufgabe wie in der Klingberger Reihe Nr. 6 beschrieben?
Nach dem Urteil des BVerfG von 1987 ist der Religionsunterricht: „... keine überkonfessionelle vergleichende Betrachtung religiöser Lehren, keine Morallehre, Sittenlehre, historische Religionskunde, Religions- oder Bibelgeschichte. Sein Gegenstand ist vielmehr der Bekenntnisinhalt, nämlich die Glaubenssätze der jeweiligen Religionsgemeinschaft. Diese als bestehende Wahrheit zu vermitteln, ist seine Aufgabe.“
Ist so der Zusammenhalt einer pluralen Gesellschaft zu schaffen? Wenn wir dieses Ziel erreichen wollen, ist es höchste Zeit, einen Integrationsunterricht in staatlicher Verantwortung einzuführen und das GG entsprechend anzupassen! Auch andere Länder wie Quebec in Kanada sind diesen Weg nach 20 Jahren Diskussion gegangen.
Aktualisiert: 2020-01-21
> findR *
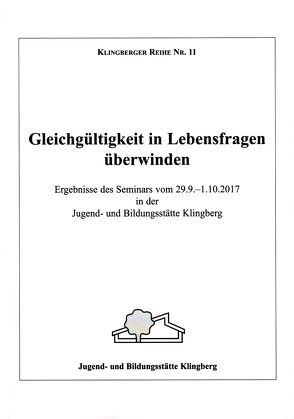
Mit Erreichen der Wiedervereinigung Deutschlands und Europas 1989 wurde bis heute kein neues politisches Ziel für Europa gesetzt. Die Europäische Union (EU) befasst sich mit sich selbst und liefert keinen substanziellen Beitrag, die aktuellen politischen Krisen, ob in der Ukraine, in Syrien oder in den arabischen Ländern rund ums Mittelmeer zu bewältigen.
Die Verbreitung von Nachrichten durch die Informationstechnologie ist stark beschleunigt und überfordert die Bürger soweit, dass die vielfältigen Zusammenhänge der verfügbaren Fakten nicht mehr bewertet werden (postfaktisches Zeitalter), sondern Resignation einsetzt. Die gefühlte Bedrohung verunsichert und verängstigt die Bürger. Gabor Steingart, Herausgeber des Handelsblattes, beschreibt dies in seinem Buch „Weltbeben – Leben im Zeitalter der Überforderung“. Sein letztes Kapitel trägt die Überschrift: „Demokratie: Der kommende Aufstand der Bürger“. Er beschreibt darin, dass die Säkularisierung der repräsentativen Demokratie eingesetzt hat und die Ausübung von Macht sich grundsätzlich ändern wird. Der Informationsvorsprung der Parlamentarier gegenüber dem Bürger schmilzt und daher muss die Ausübung von Macht in Zukunft viel mehr auf „Transparenz, Teilhabe, Kommunikation und Mitbestimmung“ basieren. Das Ergebnis der bisherigen Politik bürdet zukünftigen Generationen neben den Schulden auch ökologische Kredite auf, beispielsweise den Atommüll zu bewachen und mit den hohen Kohlendioxid-Emissionen in der Atmosphäre umzugehen. Statt die zukunftsfähigen erneuerbaren Energien zu fördern, werden diese gedeckelt. Hier sind heute die Weichenstellungen vorzunehmen.
Es bedeutet im Kern, die „Gleichgültigkeit gegenüber Mensch und Umwelt zu überwinden“. Sind „Transparenz, Teilhabe, Kommunikation und Mitbestimmung“ der Schlüssel für eine Ethik in der Wirtschaft, die mit politischen Rahmenbedingungen geschaffen werden sollte?
Wir haben die Welt von unseren Kindern und Enkelkindern geliehen; was tun wir heute, um sie lebenswert zu erhalten? Muss endlich die Gleichbehandlung von Bürger und Industrie laut Grundgesetz sichergestellt werden? Die Politik gestaltet heute Gesetze, die dem Bürger schlechtere Investitionsbedingungen als der Industrie einräumen (Strombörse Leipzig) und den Bürger bei der Ökostromabgabe, wegen ungerechtfertigter Ausnahmen für die Industrie, stärker belastet. Die Investitionen der Bürger haben aber die Energiewende ermöglicht.
In zwei Themenblöcken „Gleichgültigkeit gegenüber dem Menschen“ und „Gleichgültigkeit gegenüber der Umwelt“ wollen wir die komplexe Aufgabe im Seminar angehen. Es muss die Frage beantwortet werden, ob die EU weiter ohne politischen Integrationskern dahindümpeln kann?
Aktualisiert: 2021-04-15
> findR *
Aktualisiert: 2015-08-16
> findR *
Der Dachverband Freier Weltanschauungsgemeinschaften e.V. (DFW) verfolgt das Ziel, die Verwirklichung und Entwicklung der Menschenrechte und Grundrechte im öffentlichen Leben der Bundesrepublik Deutschland zu erreichen. Er setzt sich besonders ein für die Freiheit der Weltanschauung, des Glaubens, Gewissens und der Religion. Er strebt die Erhaltung der natürlichen Umwelt und die praktische Umsetzung der Ideale der Aufklärung in Politik, Wirtschaft und Kultur an. Der DFW ist unabhängig und parteipolitisch neutral. (Auszug aus der DFW-Satzung vom 2.11.1991, zuletzt geändert am 13.10.2000)
Aktualisiert: 2019-01-09
> findR *

Der Irak, ja der ganze Nahe-Osten, kommt nicht zur Ruhe! Die nah-östliche Philosophie Aug’ um Auge, Zahn um Zahn ist offensichtlich unfähig zum Frieden. Die USA betreiben die Demontage der UNO und setzen auf Globalisierung sowie den sogenannten freien Welthandel. Welche Position bezieht Europa in dem weltweiten Ringen um eine gerechtere Weltordnung?
Kofi Annan hat in dem von Stephan Mögle-Stadel herausgegebenen Buch „UNvollendeter Weg“ seine Vorstellungen von einer friedlicheren Welt entwickelt. Er schließt dabei nahtlos an sein Vorbild Dag Hammarskjöld an und stimmt mit der europäischen Rechtsphilosophie von Kant und vielen anderen europäischen Philosophen überein. Ist das alte Europa mit seinem EU-Verfassungs-Entwurf dabei, eine neue Perspektive zu entwickeln für die friedliche Koexistenz von Kulturnationen in einem souveränen Staatenbund? Wird dieses Modell zur Stabilisierung der UNO und zur Entwicklung einer Weltrechtsordnung beitragen, die die Machtpolitik einzelner Staaten ablöst? Welche Rolle kann in diesem Kontext der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag spielen?
Diese Themen wurden in dem Seminar behandelt und haben sicher zur Klärung verschiedener Fragen beigetragen. Wichtig bleibt – und das gilt auch im Herbst des Jahres 2004 –, dass Europa eine eigenen Position findet und gemeinsam mit der UNO zur friedlichen Lösung der Probleme im Nahen Osten beiträgt. Die USA sind auf dem besten Wege, ihre bisherige Führungsrolle zu verspielen.
Aktualisiert: 2020-01-22
> findR *
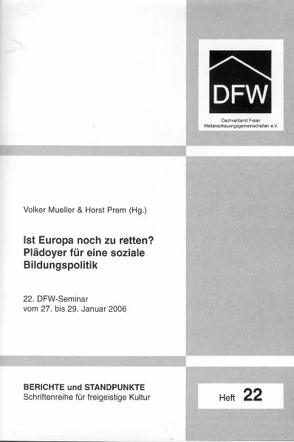
„Ist Europa noch zu retten? – Plädoyer für eine soziale Bildungspolitik“ – unter diesem Motto stand das Seminar vom 27.–29.1.2006 in der Franken-Akademie in Schney. Das Thema wird immer aktueller. Denn mit der Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft zum 1.1.2007 durch Deutschland sollen neue Ini-tiativen gestartet werden, um den festgefahrenen EU-Verfassungsentwurf zu reanimieren.
Eingeleitet wurde das Seminar durch Thesen von Dr. Volker Mueller (Falkensee) und Horst Prem (Ottobrunn), die auf Grundfragen der Werteerziehung in der Gegenwart, auf das nicht mehr vorhandene Monopol der Religionen und die Notwendigkeit der Allianz für Toleranz und Nicht-Diskriminierung in Europa, ja auf der Erde eingingen. Die konkrete Situation der Wertevermittlung in Schule und Gesellschaft beleuchteten Renate Bauer (Ludwigshafen) und Peter Kriesel (Brandenburg/Havel). Der Respekt vor Traditionen und kultureller Vielfalt führe auch zu neuen Herausforderungen für die Schule, die integrierend und werteorientierend tätig sein soll. Berlins Bestrebungen, ähnlich wie in Brandenburg mit „LER“ einen Ethikunterricht für alle einzuführen, wurde hierbei als besonders zukunftsträchtig herausgearbeitet.
Dr. Georges Liénard von der Europäischen Humanistischen Föderation (Brüssel) ging auf Probleme der Vermittlung von humanistischen Grundwerten und Menschenrechten für alle in der Europäischen Union ein und stellte die aktive Mitwirkung der freigeistigen-humanistischen Verbände als wesentlich heraus. Heiko Porsche (Hamburg) rundete die Thematik mit seinen Ausführungen über den bevorstehenden Abschluss der Staatsverträge des Landes Hamburg mit den beiden christlichen Kirchen ab, in denen er die unzeitgemäße Privilegierung nur einer Religion und ihrer kirchlichen Institutionen kritisierte.
Insgesamt haben die Seminarteilnehmer folgende Ergebnisse festgehalten:
– Es macht Sinn, ähnlich wie in Brandenburg (LER) und nun auch in Berlin (Ethik und Kulturen), für alle Schüler/innen einen integrativen Werteunterricht einzuführen, der Nicht-Diskriminierung und Toleranz mehr in den Vordergrund der Werteerziehung stellt.
– Das Projekt der EU, eine Europäische Staatsbürgerlichkeit (European Citizenship) zu entwickeln, wird ausdrücklich unterstützt. Europa ist eine Wertegemeinschaft und nicht nur eine Wirtschaftsgemeinschaft! Dabei suchen und unterstützen wir Wege für engere Zusammenarbeit und mehr Miteinander in Europa. Hierfür initiieren und fördern wir den europaweiten Austausch zur Weiterentwicklung der Werteerziehung z.B. durch Lehrerkonferenzen sowie Jugendaustausch.
Wenn die EU auf eine Wirtschaftsgemeinschaft mit globalen Partikularinte-ressen reduziert wird und die bildungspolitischen Fragen hinsichtlich eines gemeinsamen Werteverständnisses in einem multireligiösen Europa nicht aufgegriffen werden, dann wird es kein vereintes Europa eines gemeinsamen Werteverständnisses geben. In der Präambel des EU-Verfassungsentwurfes blitzt zwar die geistige Spannweite Europas kurz auf, in der praktischen Politik in Deutschland werden aber die Grundprinzipien wie Toleranz und Nichtdiskri-minierung, Trennung von Kirche und Staat durch Regierungsmitglieder eklatant verletzt. Man denke nur an den unseligen Auftritt von Ursula von der Leyen bei der „Verkündigung“ des Bündnisses für Erziehung.
Die wirtschaftlichen Partikularinteressen werden zur Erosion des europäischen Gedankens führen – mit all ihren Konsequenzen bis hin zur Gefährdung der Friedensordnung. In dieser Gemengelage einen Verfassungsentwurf vorzulegen, der grundsätzlichen Prinzipien wie z.B. dem der Gewaltenteilung nicht genügt – damit ist Europa nicht zu retten!
Aktualisiert: 2022-04-24
> findR *

Was läuft schief mit der Integration fremder Kulturen in Deutschland und in Europa? „Der Umgang mit moralischer und religiöser Vielfalt ist eine der größten Herausforderungen, mit denen unsere Gesellschaften gegenwärtig konfrontiert sind.“ Dies steht auf dem Klappentext des Büchleins von Jocelyn Maclure und Charles Taylor des im Suhrkamp Verlag erschienenen Büchleins „Laizität und Gewissensfreiheit“. Auch das Land Quebec hat mit diesen Problemen zu kämpfen und kam nach eingehender Analyse zum Ergebnis, 2008 den Konfessionsunterricht an den Schulen durch einen staatlichen Unterricht verbindlich für alle „Ethik und religiöse Kultur“ zu ersetzen. Im Land Berlin wurde nach fünf Frauenehrenmorden endlich ein für alle Konfessionen verbindlicher Ethikunterricht eingerichtet. Der Konfessionsunterricht bleibt davon unberührt.
2011 sagte sich in Norwegen ein Einzelner auf brutalste Weise vom Zusammenleben mit Unterschieden zwischen Menschen und Kulturen los. 2012 tötete in Toulouse ein junger Franzose sieben Menschen und in Deutschland mordete eine Bande, die sich „Nationalsozialistischer Untergrund“ nannte, über zehn Jahre unentdeckt zehn ausländische Unternehmer.
Wie gelingt die Integration unterschiedlicher Kulturen im globalen Dorf in Achtung vor den Unterschieden und im Wissen, eine gemeinsame Welt dabei zu teilen? Ist es nicht vor allem wichtig, zu einem Gespräch zu kommen, in dem wir nicht von Absolutismen ausgehen, von unbedingt gültigen Werten, sondern von dem, was dem vorausgeht, dem Wissen darum, wie wir uns gegenseitig verstehen und verständigen? Seit 1789 die französische Nationalversammlung die Menschenrechte und die Gleichberechtung aller verkündete, sind sie zum Ansporn für viele geworden, nach Freiheit und Demokratie zu streben.
Unsere These ist: Mit Laizität in der Politik, wenn der Staat neutral gegenüber Religionen und Weltanschauungen eingestellt ist und handelt, ist die Voraussetzung für die Menschenrechte am besten zu verwirklichen. Fahndungslisten reichen dafür nicht aus.
Ein Projekt „Weltbürgerlichkeit“ als Unterrichtsprojekt spricht diese Voraussetzungen an und will sie umsetzen in Praxis.
Wir laden Sie herzlich ein, die Seminarergebnisse in Ruhe zu studieren.
Aktualisiert: 2020-01-21
> findR *

2011 sagte sich in Norwegen ein Einzelner auf brutalste Weise vom Zusammenleben mit Unterschieden zwischen Menschen und Kulturen los. Erschreckend, dass Solches in einem liberalen skandinavischen Land möglich war.
Wie gelingt die Integration unterschiedlicher Kulturen im globalen Dorf in Achtung vor den Unterschieden und im Wissen, eine gemeinsame Welt dabei zu teilen? Ist es nicht vor allem wichtig, zu einem Gespräch zu kommen, in dem wir nicht von Absolutismen ausgehen, von unbedingt gültigen Werten, sondern von dem, was dem vorausgeht, dem Wissen darum, wie wir uns gegenseitig verstehen und verständigen? Die Voraussetzungen dafür sind: gegenseitiger Respekt, gleiche Rechte – Menschenrechte – und Toleranz. Ohne sie besteht die Gefahr, sich in Alleinvertretungs- und Alleingültigkeitsansprüche zu verrennen. Seit 1789 die französische Nationalversammlung die Menschenrechte und die Gleichberechtung aller verkündete, sind sie zum Ansporn für viele geworden, nach Freiheit und Demokratie zu streben.
Unsere These ist: Mit Säkularismus (Laizität) in der Politik, wenn der Staat neutral gegenüber Religionen und Weltanschauungen eingestellt ist und handelt, ist diese Voraussetzung für die Menschenrechte am besten zu verwirklichen.
Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie diese Voraussetzungen in der Erziehung viel stärker bewusst gemacht und verankert werden. Ein Projekt „Weltbürgerlichkeit“ als Unterrichtsprojekt spricht diese Voraussetzungen an und will sie umsetzen in Praxis. Daher hat sich dieses Seminar sowohl mit dem Thema Säkularismus in Europa wie auch mit der Frage nach der Praxis der Förderung von Toleranz und Gegenseitigkeit beschäftigt.
Die in diesem Heft zusammengefassten Beiträge und Ergebnisse der Arbeitskreise dienen als Grundlage weiterer Seminare zum Projekt Weltbürgerlichkeit. Sie sind somit noch längst nicht vollständig oder gar reif für eine konkrete Unterrichtspraxis.
Sowohl inhaltlich als auch konzeptionell sollen die bisherigen Ansätze, wie sie erarbeitet wurden, zu einem theoretisch gut fundierten und pädagogisch leicht umsetzbaren Unterrichtsmodul weiterentwickelt werden. Die Erfahrung von Weltbürgerlichkeit, die heute jedem zugänglich ist, ins Bewusstsein zu heben, sie emotional und kognitiv zu reflektieren, sie ethisch zu diskutieren und anzubinden an die Realisation der Menschenrechte, ist Ziel dieses Projektes. Dazu sollen konkrete Umsetzungsmöglichkeiten im Unterricht entwickelt und Lehrern zugänglich gemacht werden. Wie eine Einbindung in den Ethikunterricht, in LER, aber auch in andere Fächer gelingen kann, soll dabei ebenfalls aufgezeigt werden.
Ein Ethos von Weltbürgerlichkeit beruht auf der Achtung der gleichberechtigten Interessen und Auffassungen aller Menschen, auf der Erkenntnis der Vernetzung, die nicht nur elektronisch, sondern schon längst auch wirtschaftlich und kulturell alle Menschen verbindet. Die Achtung der Vielfalt der Anschauungen und Lebensweisen, bei gleichzeitiger Rücksichtnahme aufeinander und Rücknahme unberechtigter Eigenansprüche gehören zu dem Ethos der Weltbürgerlichkeit dazu. Eine solche Bewusstsseinsentwicklung und ihre Umsetzung im täglichen Handeln setzen die Kenntnis anderer Religionen, Weltanschauungen und Kulturen voraus und bedürfen des Dialogs. Von daher gehört das Projekt Weltbürgerlichkeit für uns unabdingbar in einen Unterricht, der mit allen Schülern bekenntnisübergreifend gestaltet wird und setzt Laizität, das heißt, die Neutralität des Staates in Bezug auf Religion und Weltanschauung, voraus. In einem gemeinsamen Unterricht können sich die Schüler in ihren Unterschieden kennenlernen, Vorurteile abbauen und Achtung und Toleranz gegenüber anderen Auffassungen stärken. Das muss auch im Interesse aller sein, denen ein friedliches, demokratisches und freiheitsbestimmtes Miteinander am Herzen liegt.
Wir laden alle Leser ein, die sich von diesen Ideen und den ersten Vorstellungen aus diesem Heft angesprochen fühlen, bei unserem Projekt mitzuwirken.
Aktualisiert: 2020-01-22
> findR *
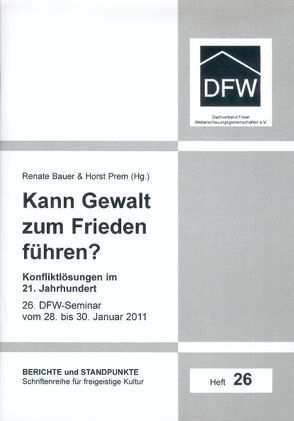
Der Dachverband Freier Weltanschauungsgemeinschaften (DFW) stellte sein 26. Seminar unter ein Thema, das zunehmend Bedeutung gewinnt.
Trotz langer Friedenszeiten in Mitteleuropa eröffnen sich auf der Welt überall neue Konflikte. Der Kampf um die Ressourcen auf einer Erde, die immer weniger Rohstoffe zu bezahlbaren Preisen zur Verfügung hat, nimmt eher zu als ab und trifft uns alle, auch in den scheinbar konfliktfreien Bereichen. Andererseits wird deutlich, dass auch eine militärische Beschaffung von Ressourcen keine Lösung bringt.
Die Industrienationen vergrößern durch ihr Wachstums- und Freihandelsdogma im Wirtschaftsprozess den Abstand zu den sich entwickelnden Ländern ständig. Die auf dem Millenniumsgipfel zugesagten Hilfen für die Entwicklungsländer werden nicht eingehalten. Die Bevölkerungszahl auf der Erde nimmt rapide zu genauso wie die Zahl der hungernden Menschen. Soziale Konflikte sind mit militärischen Mitteln nicht zu entspannen.
Hinzu kommen die Konflikte um die politische Teilhabe in bisher autokratisch regierten Ländern, wie sie die Rebellionen und Demonstrationen vor allem in den arabischen Ländern des Mittelmeerraumes, aber auch der arabischen Halbinsel deutlich machen. Nicht nur, dass die Demonstranten und Rebellen selbst ein Eingreifen von außen – außer in Form humanitärer Hilfe und politischen Drucks durch öffentliche Verurteilung der von den Regierungen verübten Gewalttaten – ablehnen, es muss sich die Frage stellen, ob ein Eingreifen, so gut es gemeint ist, am Ende nicht mehr Schaden anrichtet und gar keine Menschenleben gerettet werden können, weil sich die Gewalt wie in anderen Ländern sichtbar dann doch in Form von Terrorismus fortpflanzt.
Wie sieht eine zukunftsgerichtete Friedenspolitik aus? Treiben uns die Dogmen unserer Wirtschaftspolitik in einen unausweichlichen Konflikt? Welche Rolle hat die Bundeswehr zu übernehmen? Und was können und sollen Humanisten tun, wie können sie zur Stärkung des Friedens und eines konstruktiven Zusammenlebens beitragen?
Dieses Seminar diente gleichzeitig der Vorbereitung für den 18. Weltkongress der Internationalen Humanistischen und Ethischen Union (IHEU) vom 12. bis 14. August 2011 in Oslo, der unter dem Thema „Humanismus und Frieden“ stand.
Wir wünschen uns, dass die Ideen, die uns hier vermittelt wurden bzw. wir selbst in den Arbeitsgruppen entwickelten, auch von unseren Gemeinschaften aufgegriffen und weiter geführt werden. Gerade humanistische freigeistige Organisationen können zu diesem Thema nicht schweigen, sondern müssen in Theorie und Praxis ihre Ideen von Frieden noch mehr gestalten und einbringen.
Aktualisiert: 2023-05-02
> findR *
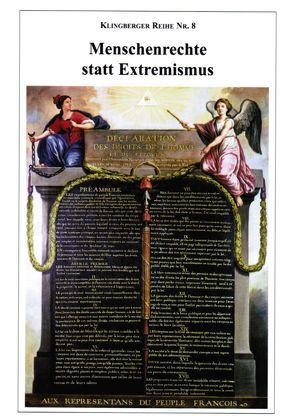
Das Wort „Menschenrechte“ oder „Rights of Men“ oder „fundamental Rights“ wird in der Welt viel verwendet. So begründete unser Bundespräsident Gauck seine Absage der Teilnahme an den Eröffnungsfeierlichkeiten der olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi damit, dass in Russland die Menschenrechte nicht eingehalten werden. Für unser Thema „Menschenrechte statt Extremismus“ ist die UN-Menschenrechtserklärung vom 10.12.1948 zugrunde gelegt worden. Diese UN-Resolution ist nur unter dem Druck einiger französischer Intellektueller, wie z.B. Camus und Sartre, sowie der Amerikaner Garry Davis und Eleonor Roosevelt, auf die Tagesordnung der UNO-Vollversammlung gesetzt worden, die damals in Paris tagte. Ihre Motivation unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg war ihre Überzeugung, dass extremistische Systeme wie das Dritte Reich von 1933–1945 durch eine weltweite Einigung auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verhindert werden können.
Der Vorläufer dieser Menschenrechtserklärung waren die 1789 verfassten Menschenrechte, die Bestandteil der französischen Verfassung sind (siehe Heftcover). An deren Entstehung war Thomas Paine maßgeblich beteiligt, der in seinen Schriften unitarische Auffassungen erkennen lässt. Ihm sind zwei Kapitel gewidmet. In diesem Zusammenhang wird aufgezeigt, dass die Menschenrechte erst 2002 mit der Einrichtung des Internationalen Strafgerichtshofes in Den Haag aus dem Status moralischer Appelle in den Status exekutierbaren Rechts erhoben wurden.
Die Frage, ob die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948, die die Basis der Zusammenarbeit innerhalb der UNO ist, auch eine Basis für eine Verständigung auf weltweite Werte sein und somit zur Eindämmung des Extremismus führen kann, wird in einem weiteren Kapitel behandelt. Darin wird auf die inneren Widersprüche in Systematik und Ordnung der Menschenrechtserklärung eingegangen. In den nachfolgenden beiden Kapiteln wird durch praktische Beispiele aufgezeigt, dass durch die fehlende innere Ordnung der Menschenrechte Schwierigkeiten auftreten können, die mit den Mitteln und im Sinne der bestehenden Menschenrechte nicht gelöst werden können.
Auf jeden Fall muss entschieden festgestellt werden, dass die Menschenrechtserklärung – auch in der jetzigen Form – eine Basis einer allgemeinen Ethik sein kann. Inwiefern die Deutschen Unitarier in ihren Grundgedanken stärker Bezug nehmen sollten auf die Menschenrechtserklärung und Thomas Paine ist eine noch zu klärende Frage.
In den abschließenden Gesprächen wird das Problem des Extremismus in unserer Gesellschaft behandelt. Zu dessen Lösung wird eine Verbreitung einer individualen Verantwortungsethik gesehen, die das Verstehensprinzip befolgt. Langfristig müssen die dafür notwendigen Grundhaltungen durch einen Erziehungsprozess in den Schulen angestrebt werden. In einem integrierenden Fach Ethik, das die Menschenrechte, die Toleranz und die Erziehung zur weltbürgerlichen Gesinnung in einer Weltrisikogesellschaft zum Mittelpunkt hat und verbindlich für alle Schüler/innen ist, wird ein konstruktiver Beitrag zur Lösung gesehen.
Aktualisiert: 2020-01-21
> findR *
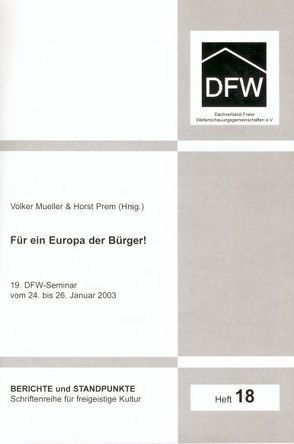
Die in diesem Heft enthaltenen Beiträge wurden auf dem 19. DFW-Seminar zum gleichen Thema vom 24. bis 26. Januar 2003 in der Frankenakademie Schloß Schney gehalten. In dem Seminar wurden Hintergründe der gegenwärtigen Diskussionen um die Europäische Verfassung in den Mittelpunkt gestellt. Die Erschütterungen der Terroranschläge seit ca. drei Jahren waren ein Ausgangspunkt, um nach völkerrechtlich klaren und rechtsstaatlichen Konfliktlösungen zu suchen. Es sind verfassungsrechtliche und menschenrechtspolitische Grundpositionen zu finden bzw. zu bekräftigen, um Toleranz und Gewissens-, Religions- und Weltanschauungsfreiheit für alle zu sichern. Die Erkenntnis und Beherrschung komplexer Zusammenhänge in der Gegenwart führen letztlich zu einer friedlicheren Welt.
Der Beitrag von Wolf von Fahlbeck und Jürgen Grahl befasst sich mit inneren Entwicklungsproblemen in Deutschland, ausgehend von ökologischen, steuerreformerischen und sozial gerechteren Strukturen. Die Beiträge von Horst Prem, Georges Liénard und Dietmar Michalke beinhalten Grundfragen der Wechselbeziehungen von Menschenrechten und EU-Verfassung, Staatlichkeit und Religions- und Weltanschauungsfreiheit, Religion und allgemeiner Krise. Gerade Liénard macht sehr deutlich, dass vereinte Anstrengungen für ein laizistisches und von allen Bürgern getragenes Europa nötig sind. Im Anhang werden die Resolution der Seminarteilnehmer sowie die im Frühjahr 2003 abgegebenen Erklärungen des DFW zum EU-Verfassungsentwurf veröffentlicht.
Aktualisiert: 2020-01-22
> findR *

Ökonomie für den Menschen –
Beitrag für eine humane Sozialethik
Was hat die Ökonomie mit der Sozialethik zu tun? Wenn man vom amerikanischen Casino-Kapitalismus ausgeht, dann gar nichts.
Der beeindruckende Film „Home“ des Franzosen Yann Arthus-Bertran beschrieb den heutigen Umgang mit unseren Ressourcen. Es ist zu spät Pessimist zu sein, war eine der Kernaussagen, die uns alle zum Handeln für eine umweltfreundliche Energiepolitik mit geschlossenen Stoffkreisläufen aufforderte.
Die Dogmen der Ökonomie beleuchtete Grahl von der Uni in Würzburg. Sie gehen immer noch von unbegrenztem Wachstum in einer begrenzten Welt aus. Die natürlichen Ressourcen sind einfach nur eine weitere Kapitalform, die die Gesellschaft besitzt wie schnelle Computer, Humankapital in Form gut ausgebildeter Arbeitskräfte oder technologisches know-how in ihren Wissenschaftlern und Technikern. Mit solchen Zitaten von Nobelpreisträgern der Ökonomie öffnete Grahl allen Teilnehmern die Augen.
Schrimpff wiederum machte deutlich wie indianische Kulturen im Amazonasgebiet die dort vorhanden ausgezehrten Böden durch die Produktion von Schwarz-Erde, Terra Preta in fruchtbare Kulturlandschaften umwandelten. Der entsprechende Arte-Film über Nullbodenbearbeitung verdeutlichte die vorsorgende Wirtschaftsweise dieser mit der Bibel unterm Arm und den mitgebrachten Infektionskrankheiten der Spanier ausgerotteten Hochkulturen. Für alle relativ neu war die Erkenntnis, dass diese Humusbildung wesentliche Mengen CO2 aus der Atmosphäre binden kann. Hier wurden Zukunftsfragen angesprochen, die für unser Überleben auf dem Raumschiff Erde entscheidend sind.
Mueller machte in einer Analyse über Ethik und Ökonomie deutlich, dass Ökonomie einem humanen Leitbild folgen muss. Urheber, Mittelpunkt und Ziel aller Wirtschaft ist der Mensch. Das Gemeinwohl ist gegenüber Sonderinteressen Einzelner vorrangig. Diese These wurde auch von Bär unterstützt.
Solange aber alle Klimakosten mit einer Diskontrate von 20% real auf Barwerte umgerechnet werden und es egal ist, ob der Golfstrom in einigen hundert Jahren aufgrund unserer heutigen Emissionen abreißt, dient Ökonomie nicht dem Menschen. Es ist Aufgabe der Politik dem Casino-Kapitalismus die ökologisch-soziale Marktwirtschaft als Handlungsoption gegenüberzustellen und umzusetzen.
Wer diese Zusammenhänge gehört hatte fragte sich zurecht, was päpstliche Enzykliken wie die „Caritas in Veritate“ zur Lösung unserer Probleme noch beitragen können oder ob sie nicht vielmehr aufgrund ihres falschen Welt- und Menschenbildes ein Teil des Problems sind. Umso wichtiger ist es, dass die humanistischen Verbände Alternativen aufzeigen, die uns an die Grundlagen unseres Lebens zurückführen. Ökonomie ist kein Selbstzweck, sondern sie muss dem Menschen dienen.
Viele Teilnehmer verließen das 25. DFW-Seminar in Schney vom 22.-24. Januar 2010 sehr nachdenklich, da sie über Zusammenhänge informiert wurden, die sie so noch nicht gesehen hatten.
Horst Prem, Vizepräsident des DFW, und Volker Mueller, Präsident des DFW
Aktualisiert: 2020-01-22
> findR *

Europa braucht einen neuen Identifikationskern, wenn auch zukünftig eine friedliche Entwicklung garantiert werden soll. Die zentrifugalen und desintegrierenden Kräfte bis hin zur Friedensgefährdung durch Machtgelüste von Despoten an den EU-Außengrenzen überwiegen. Die konventionellen militärischen Antworten auf diese Herausforderungen haben bisher nicht die gewünschten Erfolge gebracht. Von Nachhaltigkeit, die eine friedliche Entwicklung garantieren kann, ist in der Politik wenig zu spüren. Gleichzeitig führt Perspektivlosigkeit in einer pluralen Gesellschaft Jugendliche dazu, sich extremistischen Gedanken zu nähern und sich als Gotteskrieger zu verdingen. Es gibt sicherlich keine Patentrezepte. Jedoch wird die Entwicklung einer nachhaltigen Energieinfrastruktur ein Weg sein, der einen entscheidenden Beitrag zur Friedenssicherung, zum Abbau von Migrationsdruck und Perspektivlosigkeit der jungen Generation leisten kann.
Welche Ziele im Erziehungswesen verfolgt werden müssen, um von einer Abschottungskultur der Industrieländer zu einer Willkommenskultur zu kommen, wurde in verschiedenen Beiträgen beleuchtet. Als offene Frage blieb im Raum, ob Ausweisentzug langfristig eine sinnvolle Maßnahme zur Extremismusprävention darstellt. Sind nicht viel grundsätzlichere Änderungen in unserem Erziehungswesen nötig, um einerseits umweltverträgliche Wohlstandsmöglichkeit in Ländern der Dritten Welt und gleichzeitig eine Willkommenskultur aufzubauen? Am Beispiel Quebec wurde deutlich, welche Zeiträume ein derartiger Mentalitätswandel in der alten industriellen Denkweise erfordert. Deshalb erscheint eine Koppelung von nachhaltigen Erziehungszielen mit nachhaltigen technologischen Zielen Europas ein erfolgversprechender und zeitsparender Weg zu sein. Somit kann der unumgängliche Klimaschutz zum Hilfsmittel werden, den nötigen Mentalitätswandel zu befördern.
Europa braucht einen neuen Identifikationskern, wenn auch zukünftig eine friedliche Entwicklung garantiert werden soll. Die zentrifugalen und desintegrierenden Kräfte bis hin zur Friedensgefährdung durch Machtgelüste von Despoten an den EU-Außengrenzen überwiegen. Die konventionellen militärischen Antworten auf diese Herausforderungen haben bisher nicht die gewünschten Erfolge gebracht. Von Nachhaltigkeit, die eine friedliche Entwicklung garantieren kann, ist in der Politik wenig zu spüren. Gleichzeitig führt Perspektivlosigkeit in einer pluralen Gesellschaft Jugendliche dazu, sich extremistischen Gedanken zu nähern und sich als Gotteskrieger zu verdingen. Es gibt sicherlich keine Patentrezepte. Jedoch wird die Entwicklung einer nachhaltigen Energieinfrastruktur ein Weg sein, der einen entscheidenden Beitrag zur Friedenssicherung, zum Abbau von Migrationsdruck und Perspektivlosigkeit der jungen Generation leisten kann.
Welche Ziele im Erziehungswesen verfolgt werden müssen, um von einer Abschottungskultur der Industrieländer zu einer Willkommenskultur zu kommen, wurde in verschiedenen Beiträgen beleuchtet. Als offene Frage blieb im Raum, ob Ausweisentzug langfristig eine sinnvolle Maßnahme zur Extremismusprävention darstellt. Sind nicht viel grundsätzlichere Änderungen in unserem Erziehungswesen nötig, um einerseits umweltverträgliche Wohlstandsmöglichkeit in Ländern der Dritten Welt und gleichzeitig eine Willkommenskultur aufzubauen? Am Beispiel Quebec wurde deutlich, welche Zeiträume ein derartiger Mentalitätswandel in der alten industriellen Denkweise erfordert. Deshalb erscheint eine Koppelung von nachhaltigen Erziehungszielen mit nachhaltigen technologischen Zielen Europas ein erfolgversprechender und zeitsparender Weg zu sein. Somit kann der unumgängliche Klimaschutz zum Hilfsmittel werden, den nötigen Mentalitätswandel zu befördern.
Aktualisiert: 2020-01-21
> findR *
Derzeit überbieten sich die beiden großen Volksparteien in der Bundesrepublik Deutschland mit Vorschlägen zum Sozialabbau. Sicherlich sind Korrekturen in unserem Sozialsystem nötig, aber Strukturprobleme sind nicht durch Sozialabbau zu lösen. Das Globalisierungsgerede der sogenannten Finanzfachleute hat noch keinen Arbeitsplatz geschaffen! Neue Produkte und schnellere Innovationszyklen wurden nicht von solchen Fachleuten gestaltet. Einen Beitrag zur Senkung der Lohnnebenkosten haben Autokraten mit Rundumversicherung noch nie geleistet.
Wir sind uns bewusst, dass uns die aufgezeigten Grundprobleme lange Zeit beschäftigen werden. Möge dieses Heft einen Beitrag zu neuen Wirtschafts- und Sozialtheorien liefern, da die alten ohnehin nicht mehr zu Innovationen zu führen scheinen.
Aktualisiert: 2020-01-22
> findR *
MEHR ANZEIGEN
Bücher von Prem, Horst
Sie suchen ein Buch oder Publikation vonPrem, Horst ? Bei Buch findr finden Sie alle Bücher Prem, Horst.
Entdecken Sie neue Bücher oder Klassiker für Sie selbst oder zum Verschenken. Buch findr hat zahlreiche Bücher
von Prem, Horst im Sortiment. Nehmen Sie sich Zeit zum Stöbern und finden Sie das passende Buch oder die
Publiketion für Ihr Lesevergnügen oder Ihr Interessensgebiet. Stöbern Sie durch unser Angebot und finden Sie aus
unserer großen Auswahl das Buch, das Ihnen zusagt. Bei Buch findr finden Sie Romane, Ratgeber, wissenschaftliche und
populärwissenschaftliche Bücher uvm. Bestellen Sie Ihr Buch zu Ihrem Thema einfach online und lassen Sie es sich
bequem nach Hause schicken. Wir wünschen Ihnen schöne und entspannte Lesemomente mit Ihrem Buch
von Prem, Horst .
Prem, Horst - Große Auswahl an Publikationen bei Buch findr
Bei uns finden Sie Bücher aller beliebter Autoren, Neuerscheinungen, Bestseller genauso wie alte Schätze. Bücher
von Prem, Horst die Ihre Fantasie anregen und Bücher, die Sie weiterbilden und Ihnen wissenschaftliche Fakten
vermitteln. Ganz nach Ihrem Geschmack ist das passende Buch für Sie dabei. Finden Sie eine große Auswahl Bücher
verschiedenster Genres, Verlage, Schlagworte Genre bei Buchfindr:
Unser Repertoire umfasst Bücher von
Sie haben viele Möglichkeiten bei Buch findr die passenden Bücher für Ihr Lesevergnügen zu entdecken. Nutzen Sie
unsere Suchfunktionen, um zu stöbern und für Sie interessante Bücher in den unterschiedlichen Genres und Kategorien
zu finden. Neben Büchern von Prem, Horst und Büchern aus verschiedenen Kategorien finden Sie schnell und
einfach auch eine Auflistung thematisch passender Publikationen. Probieren Sie es aus, legen Sie jetzt los! Ihrem
Lesevergnügen steht nichts im Wege. Nutzen Sie die Vorteile Ihre Bücher online zu kaufen und bekommen Sie die
bestellten Bücher schnell und bequem zugestellt. Nehmen Sie sich die Zeit, online die Bücher Ihrer Wahl anzulesen,
Buchempfehlungen und Rezensionen zu studieren, Informationen zu Autoren zu lesen. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
das Team von Buchfindr.