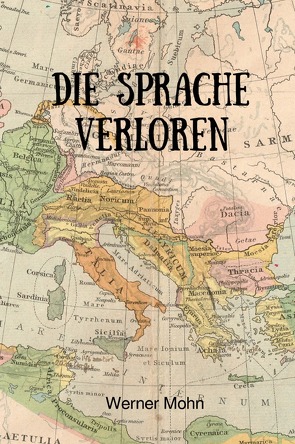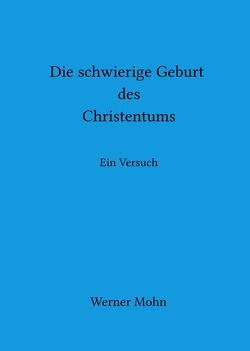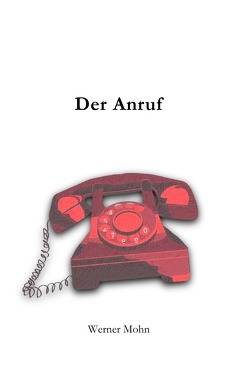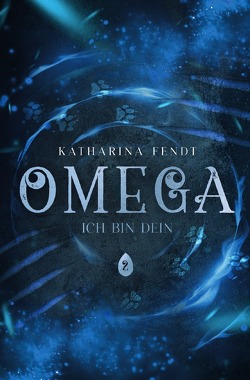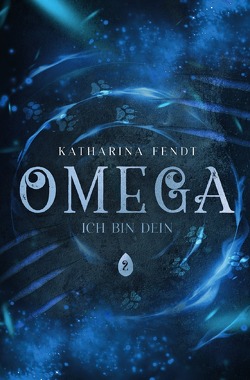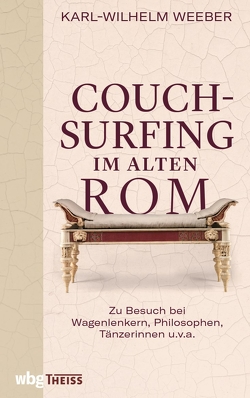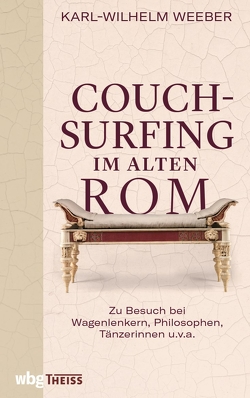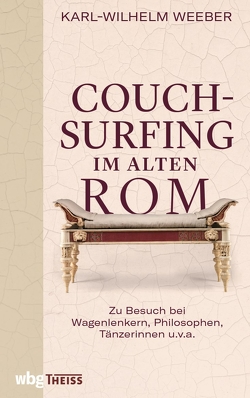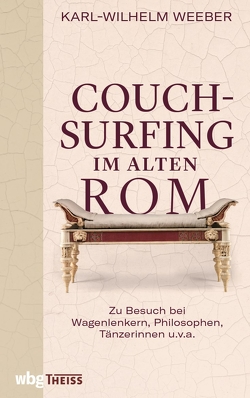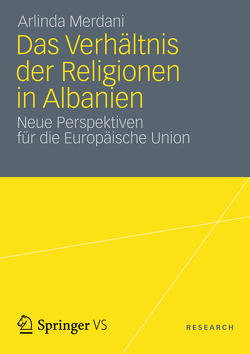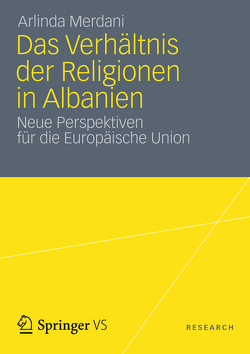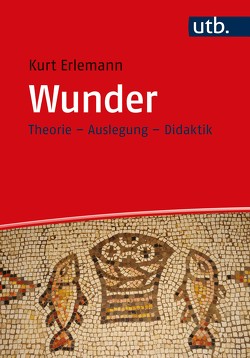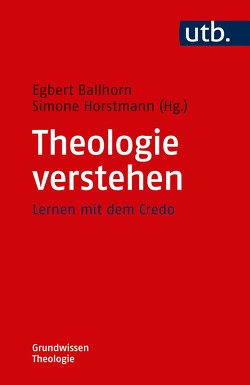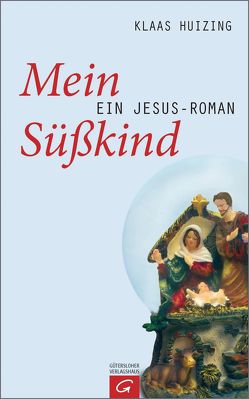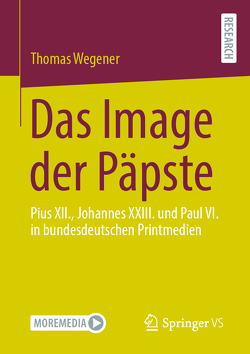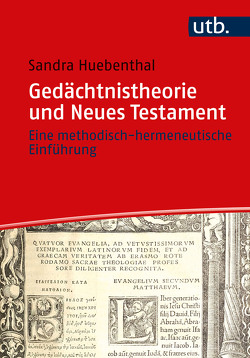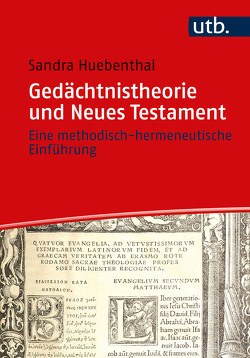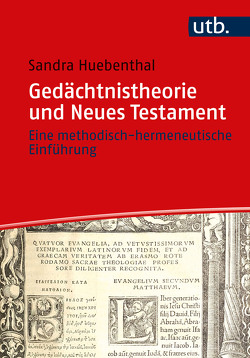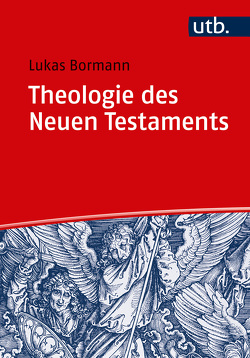Die Sprache verloren
Werner Mohn
Drei Männer aus dem 1. Jahrhundert n. Chr. berichten in dem Roman von ihrer Geschichte. Wir kennen nur ihre Namen. Mit einem, Johannes Markus, ist ein Evangelium verbunden. Von einem anderen, einem Clemens ist ein Clemens-Brief erhalten, der ihn zu dem ersten Apostolischen Vater gemacht hat. Der dritte Mann heißt Johannes. Dass er, der im Johannes-Evangelium allein erwähnte Lieblingsjünger Jesu, auch wesentlich an dem Evangelium seines Namens beteiligt war, ist wie alle drei Erzählungen Fiktion. Vielleicht ist Johannes schon von Anfang an eine Erfindung gewesen. Denn wer von den ersten Gefolgsleuten Jesu hätte nicht gern in dem Ruf gestanden, Jesus besonders nahe gewesen zu sein und darum ein zuverlässiger Garant der Botschaft Jesu? Doch das ist Sache der Theologen. Der Roman zeichnet nur den Weg, wie die Botschaft Jesu, seine Sprache, schon im 1. Jahrhundert fast ganz verloren gegangen ist.
Die von Jesus gelebte Einheit mit Gott als seinem Vater, in die er durch seinen Kreuzestod nun alle Menschen einbeziehen wollte, hätte zum Ende der Religionen geführt, die von der Trennung von Gott und Mensch leben. Johannes, der Lieblingsjünger Jesu, und der Evangelist Markus bemühen sich vergeblich, das Aufkommen der christlichen Religion zu verhindern. Der dritte Erzähler Clemens Romanus, ein menschenfreundlicher Zeitgenosse ohne religiöse Interessen liebt seine Sekretärin. Doch sie hat der Gottesmutter ewige Jungfräulichkeit gelobt. Religion kann menschenfeindlich sein!