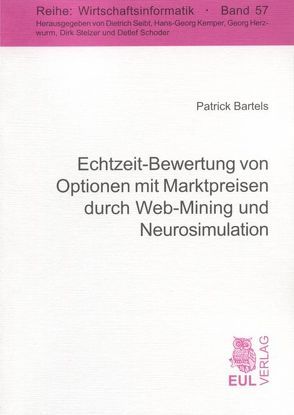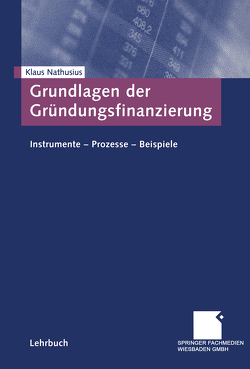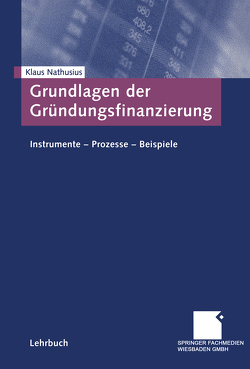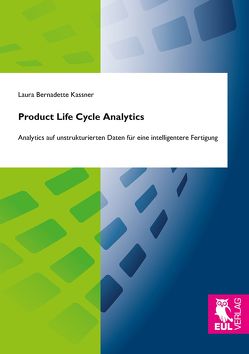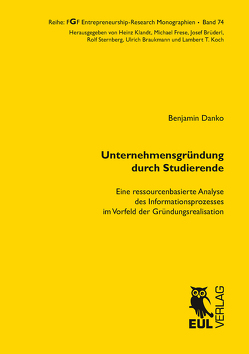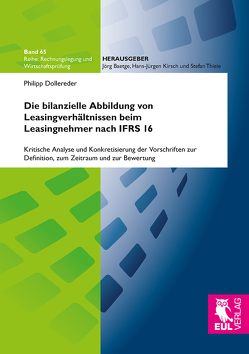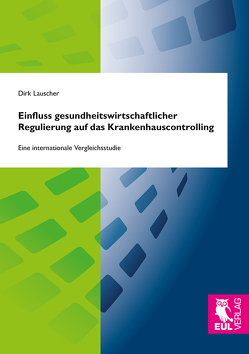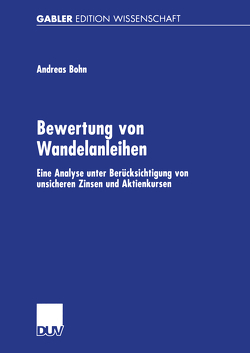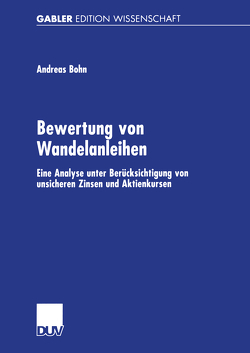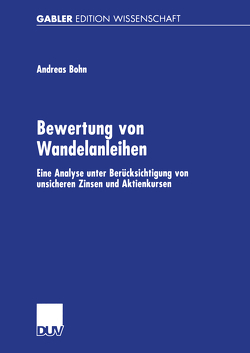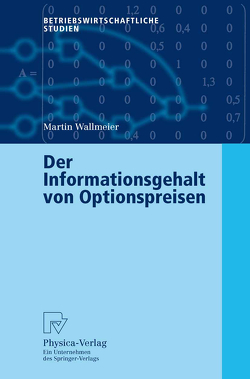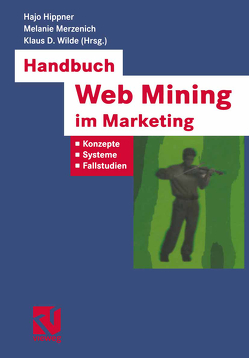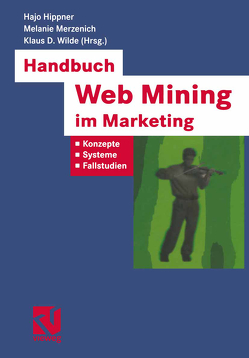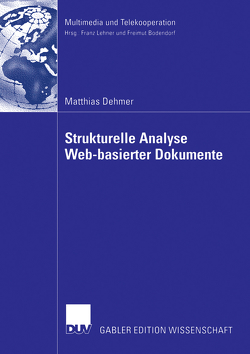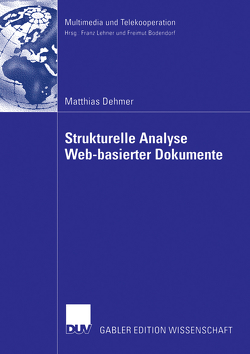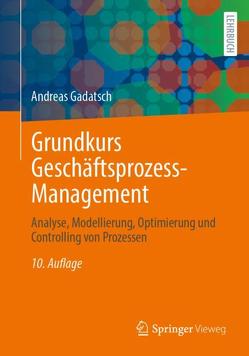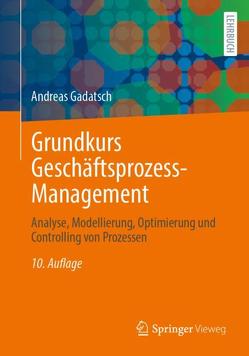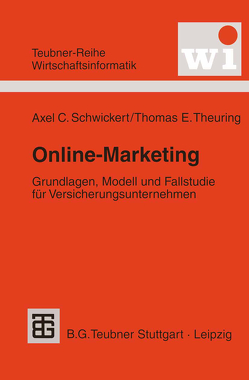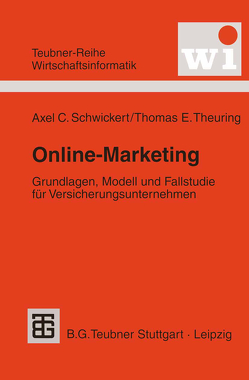Echtzeit-Bewertung von Optionen mit Marktpreisen durch Web-Mining und Neurosimulation
Patrick Bartels
Zentrale Forschungsfrage der vorliegenden Dissertation ist: Sind zeitabhängige künstliche neuronale Netze, die auf großen Datenmengen basieren, welche automatisch aus dem Internet extrahiert werden genauso präzise oder gar besser bei der Optionsbewertung als herkömmliche, theoretische Ansätze, wie bspw. die von Black/Scholes oder Cox/Ross/Rubinstein? Letztere Ansätze basieren auf allgemein anerkannten unrealistischen Annahmen wie die Schätzung der zukünftigen Volatilität des Basiswerts s. Ferner gibt es „versteckte“ Einflussfaktoren, die in herkömmlichen Modellen nicht berücksichtigt werden.
Alternative Bewertungsansätze verwenden daher künstliche neuronale Netze, die Marktpreismodelle aus tatsächlich beobachteten Marktdaten erlernen und auch alternative marktbeschreibende Faktoren berücksichtigen können. Diesen Ansatz greift die vorliegende Arbeit auf.
Um die Forschungsfrage zu beantworten, wird die Software Warrant Pro I entwickelt und beschrieben, die den Web-Content-Mining-Agenten PISA (Partially Intelligent Software Agent) und den Neurosimulator FAUN (Fast Approximation with Universal Neural Networks) kombiniert. Damit ist es möglich, beliebige Daten aus dem Internet zu extrahieren und daraus mittels Neurosimulation in Echtzeit Marktpreismodelle für Optionen zu erzeugen. Dabei können die Daten gefiltert und so emittentenspezifiche Modelle generiert werden. Es werden hier Beispiele mit Call-Optionen auf den Deutschen Aktienindex DAX evaluiert. Im Gegensatz zu bisherigen Arbeiten werden dabei ausschließlich die Zeit t, die Moneyness S/X sowie die Restlaufzeit T verwendet. Ferner werden bewusst kurze Zeitspannen betrachtet, so dass die Volatilität s und der Zinssatz r als konstant angesehen werden können und auf beide Größen verzichtet werden kann, um Problem- und Netzkomplexität zu verringern. Statistische Analysen und die Bewertung von Over-the-Counter-Optionen belegen Realisierbarkeit und Qualität dieses Ansatzes. Damit kann die Forschungslücke teilweise geschlossen und die gestellte Forschungsfrage eindeutig positiv beantwortet werden.