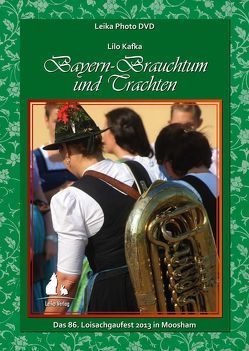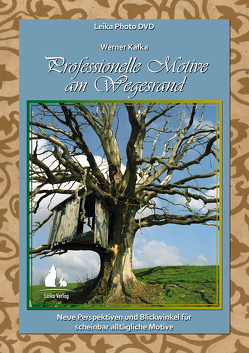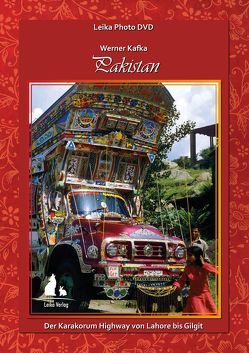Wie der Leidl-Mausi in den Bach gefallen ist
Liebeserklärung an eine Sackgasse
Werner Kafka
Es waren diese unverwechselbaren, verschiedenstämmigen Leute, die jene Sackgasse meiner Kindheit zu einem ganz eigenen, kleinen Universum werden ließen? Die mich, wann immer ich mich an diese Tage meiner Kindheit erinnerte, lehrten, dass es so etwas wie Spießer eigentlich gar nicht gibt. Sie alle waren einfache Menschen mit kleinen und großen Sorgen, hatten Existenzängste, hatten mit Eifersüchteleien, Neid und anderen unschönen Eigenschaften zu kämpfen. Aber sie waren eben auch voller Mut, Lebensfreude, Großherzigkeit und Hilfsbereitschaft. Ich empfand uns alle als eine große, bunte Gemeinschaft. Wir Kinder wurden nicht nur von den Eltern erzogen, sondern von der ganzen Straße. Und das war das Schlechteste nicht, kamen doch die Bewohner der Wendelsteinstraße aus den unterschiedlichsten Ecken Europas.
Natürlich kann ich nicht alle ausreichend gut oder zutreffend beschreiben, denn die meisten kannte ich fast nur von meinem täglichen Schulweg, den ich auch samstagmorgens leidvoll und düster quer durch die kleine Stadt unternahm und mittags fröhlich und mit wehenden, zerrauften Kleidern wieder zurücklief. Man möge mir deshalb die eine oder andere Ungereimtheit oder falsch verstandene Erinnerung verzeihen. Gerade mit den geografischen Zuordnungen der einzelnen Personen bin ich mir so gar nicht sicher. Wir Kinder versuchten damals, die Herkunft unserer Nachbarn nach dem entsprechenden Dialekt zu ermitteln. Wobei ich keine Ahnung hatte, welcher Dialekt in den Masuren gesprochen wurde oder in Danzig. Hätte ich ihn überhaupt verstanden?
Biegt man von der Glonner Straße in unsere Sackgasse ein, so grenzen an die linke Seite das Hirschläger-Haus und rechts das von uns so benannte Günther-Haus. Nie habe ich heraus-bekommen, wie viele Menschen denn nun wirklich in diesem Haus wohnten. Mir kam es bienenstockartig vor, auch verstand ich die Sprache seiner Bewohner nur unvollständig und deren Kultur blieb mir immer ein wenig fremd. Jeder schien mit jedem irgendwie verwandt oder verschwägert zu sein. Diese Leute suchten nicht, so wie wir, Abstand zu den Verwandten. Nein, sie blieben sich nahe und im Zentrum des Bienenstocks lag eine uralte Frau in einem Bett, die von uns allen nur die „Mudda“ genannt wurde. Wäre sie weniger schmächtig gewesen, sie wäre wohl die Bienenkönigin in diesem Haus gewesen. Es war ein ständiges Rufen, dauernd kam jemand aus dieser großen Sippe in das Zimmer, fragte was, brachte was, holte was oder schüttelte das Kissen der alten Frau aus. Und Mudda mitten drin. Keiner in dem Haus dachte auch nur daran, die alte Frau in Ruhe zu lassen, das Schlafzimmer der alten Frau zu einer Totenkammer zu machen. Für uns Kinder war es eher der lebendigste Raum in dem ganzen verwinkelten Haus. Und die Mudda genoss es. Wenn sie müde war, schlief sie einfach ein und ließ den Lärm Lärm sein. Wir besuchten diese zarte Frau, die da so klein und mager in ihrem weißen Bett lag und erzählten ihr, während sie sich aufrichtete, von unseren Fußballspielen, von den Raufereien und von der Schule und vom Schwarzfischen. Die dunklen, tiefen Augen der alten Frau begannen zu leuchten und auf dem von unzähligen Falten überzogenen Gesicht erstrahlte ein Lächeln wie ein Sonnenaufgang. Das lange weiße Haar schlängelte sich in einem Bündel an ihrem Hals entlang, ergoss sich über Brust und Bauch und verschwand dann unter dem Betttuch. Wir konnten nur ahnen, wie lang die Haare der Mudda wirklich waren. Natürlich freute sie sich über die Bande Rabauken, die wie ein frischer Wind durch ihr Krankenzimmer fuhr, und die Mudda geizte nicht mit Süßigkeiten. Immer wies sie ein Mitglied der Familie an, uns reichlich zu belohnen. Ich weiß nicht, wann die Bienenkönigin gestorben ist, aber über eines bin ich mir sicher: Sie und meine Großmutter verstehen sich sicher bestens, dort, wo die beiden jetzt sind.