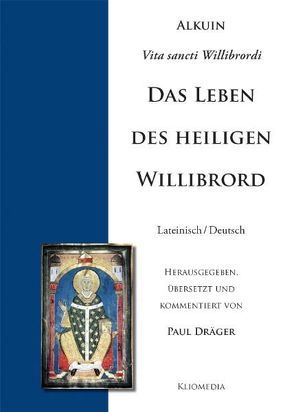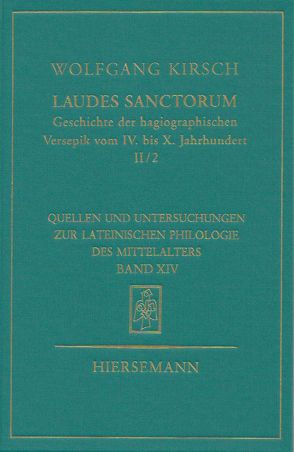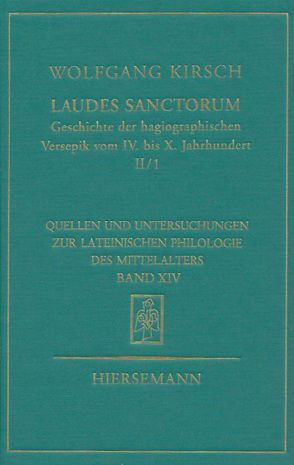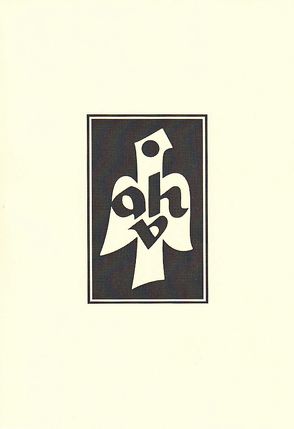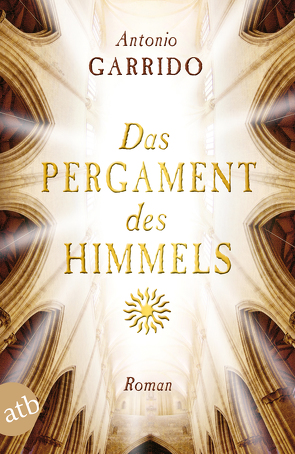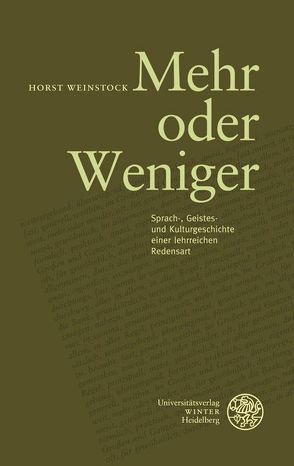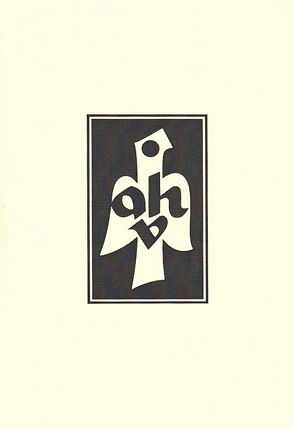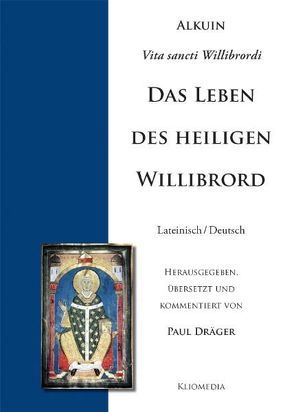
Im Jahr 2008 jährt sich zum 1350. Mal der Geburtstag des aus Northumbrien stammenden hl. Willibrord (658–739), Apostels der Friesen, Bischofs von Utrecht, Gründers von Echternach und Luxemburger Nationalheiligen, zu dessen Ehren an jedem Pfingstdienstag die Echternacher Springprozession durchgeführt wird. In keinem Geringeren als seinem Landsmann Alkuin (ca. 730/35–804), dem Leiter der Aachener Hofschule Karls des Großen, hat Willibrord seinen vermutlich ersten, jedenfalls wichtigsten Biographen gefunden (Vita sancti Willibrordi). Alkuin schafft ein Opus geminum (‚Zwillingswerk‘), d. h. dem ersten, in Prosa verfaßten Buch wird ein zweites, inhaltlich mehr oder minder identisches in Versen an die Seite gegeben, womit der Autor seine stilistische Gewandtheit unter Beweis stellt.
In Willibrords Jubiläumsjahr wird erstmals neben dem lateinischen Text eine vollständige deutsche Übersetzung seiner Vita vorgelegt, verbunden mit einem leserfreundlichen sprachlich-stilistischen, historischen und theologischen Kommentar sowie einer informativen Einführung.
Aktualisiert: 2020-05-28
> findR *
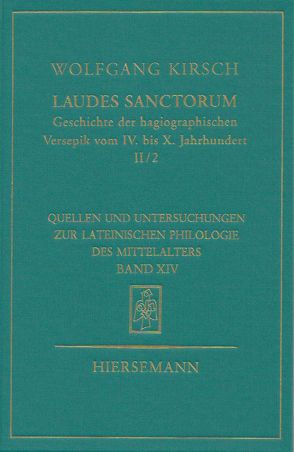
Laudes sanctorum Geschichte der hagiographischen Versepik vom IV. bis X. Jahrhundert Zweiter Halbband, Zweiter Teilband: Entfaltung (VIII. – X. Jahrhundert) Nach Walter Berschins monumentaler Übersicht über tausend Jahre lateinischer vorwiegend hagiographischer Biographik in Prosa kann der Verlag nunmehr eine Geschichte der hagiographischen Versepik vorlegen, die vom IV. bis zum X. Jahrhundert reicht. Der erste Halbband, erschienen 2004, führt vom Ende des IV. bis zur Wende vom VIII. zum IX. Jahrhundert. Behandelt werden der Johannespanegyrikus und die Felixnatilicia des Paulinus von Nola sowie das Carmen de martyrio Maccabaeorum, die Martinsepen des Paulinus von Périgueux und des Venantius Fortunatus, die metrischen Heiligenviten Bedas und Alkuins sowie die Miracula Nynie episcopi und schließlich die hagiographisch-historischen Dichtungen Alkuins und Æthelwulfs. Halbband zwei nun verfolgt die Entwicklung vom XIII. bis X. Jahrhundert in den Kapiteln Rhytmische Dichtungen, Opera gemina, Kleinere epische Formen I (im ersten Teilband); Epische Großformen, Kleinere epische Formen II, Metrische Translationsberichte, Tituli, Summarien, Kalendarien, Martyrologien (im zweiten Teilband). Im Mittelpunkt steht hierbei die beschreibende, vergleichende und genetische Untersuchung der Struktur dieser Werke. Gemeinsam sind ihnen ihr Stoff: das Leben bzw. die Passion von Heiligen, die Versform, der relativ große Umfang, die Verselbständigung der Einzelszene, die (abgesehen von Prudentius) offene Konstruktion, die immer neue Nachträge ermöglicht, und der Gestus des Rühmens. Im Übrigen dominiert der experimentelle Charakter der Dichtungen; zwar führen sie antike und spätantike Traditionen fort, doch wird die Entwicklung im Ganzen durch Brüche und immer neue Ansätze bestimmt. In die gesellschaftlich-kulturelle, insbesondere literarische Gesamtentwicklung gefügt werden die Dichtungen einerseits durch die Darstellung der Biographie des Dichters, soweit sie für das Anliegen belangvoll ist, anderseits durch die Frage nach ihren Adressaten, den intendierten Kommunikationssituationen und nach ihrer Funktion, drittens durch die Untersuchung der Beziehungen zu anderen literarischen Entwicklungen, etwa zur Bibelepik (Juvencus) bzw. zur liturgischen Hymnik (Hilarius, Ambrosius), ihre Beeinflussung durch die hagiographische und historiographische Prosa (Sulpicius Severus, Beda), durch das Aufkommen des opus geminum (Sedulius), die Prägung ihrer poetischen Sprache durch herausragende Dichtergestalten (Juvencus, Aldhelm), schließlich die Entwicklung von Ansätzen historischer Epik aus dem Geist der hagiographischen Passagen aus den Dichtungen (die, wie alle lateinischen Zitate, auch in deutscher Übersetzung geboten werden) und ihre Interpretation vermitteln einen Eindruck vom individuellen Kunstwollen und -vermögen der Dichter. Den Forschungsstand, insbesondere umstrittene Fragen, dokumentiert der Autor ausführlich, um dem Leser den Einstieg zu ermöglichen bzw. zu erleichtern. Jeder Halbband enthält ein Namen- und Sachregister sowie ein Verzeichnis der im Haupttext erörterten Dichterstellen. Wolfgang Kirsch (1938 – 2010) hat mit seinem großen Werk eine in ihrer Fülle bisher kaum wahrgenommene Literaturlandschaft erschlossen: Von Juvencus, der das lateinische Epos mit der «absoluten Dominanz einer einzigen Zentralgestalt, hinter der alle anderen Personen zurücktreten», revolutioniert, über die spätantiken hagiographischen Epen bis zu den karolingischen Großdichtungen und ihren Ausläufern. Die lateinische Epik ist jetzt bis zum Jahr 1000 überblickbar. Der 1. Halbband ist weiterhin wie folgt lieferbar: 1. Teil: XIV, 282 Seiten. Leinen. ISBN 978-3-7772-0404-8. 2. Teil: VI, 214 Seiten (S. 283 – 496). Leinen. ISBN 978-3-7772-0411-6.
Aktualisiert: 2021-02-02
> findR *
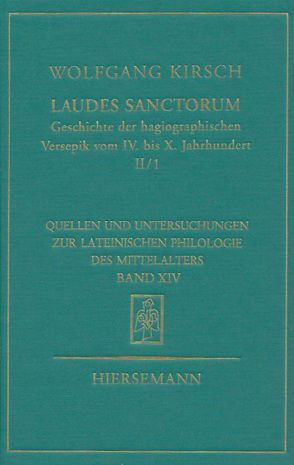
Laudes sanctorum Geschichte der hagiographischen Versepik vom IV. bis X. Jahrhundert Zweiter Halbband. Erster Teilband: Entfaltung (VIII. – X. Jahrhundert) Nach Walter Berschins monumentaler Übersicht über tausend Jahre lateinischer vorwiegend hagiographischer Biographik in Prosa kann der Verlag nunmehr eine Geschichte der hagiographischen Versepik vorlegen, die vom IV. bis zum X. Jahrhundert reicht. Der erste Halbband, erschienen 2004, führt vom Ende des IV. bis zur Wende vom VIII. zum IX. Jahrhundert. Behandelt werden der Johannespanegyrikus und die Felixnatilicia des Paulinus von Nola sowie das Carmen de martyrio Maccabaeorum, die Martinsepen des Paulinus von Périgueux und des Venantius Fortunatus, die metrischen Heiligenviten Bedas und Alkuins sowie die Miracula Nynie episcopi und schließlich die hagiographisch-historischen Dichtungen Alkuins und Æthelwulfs. Halbband zwei nun verfolgt die Entwicklung vom XIII. bis X. Jahrhundert in den Kapiteln Rhytmische Dichtungen, Opera gemina, Kleinere epische Formen I (im ersten Teilband); Epische Großformen, Kleinere epische Formen II, Metrische Translationsberichte, Tituli, Summarien, Kalendarien, Martyrologien (im zweiten Teilband). Im Mittelpunkt steht hierbei die beschreibende, vergleichende und genetische Untersuchung der Struktur dieser Werke. Gemeinsam sind ihnen ihr Stoff: das Leben bzw. die Passion von Heiligen, die Versform, der relativ große Umfang, die Verselbständigung der Einzelszene, die (abgesehen von Prudentius) offene Konstruktion, die immer neue Nachträge ermöglicht, und der Gestus des Rühmens. Im Übrigen dominiert der experimentelle Charakter der Dichtungen; zwar führen sie antike und spätantike Traditionen fort, doch wird die Entwicklung im Ganzen durch Brüche und immer neue Ansätze bestimmt. In die gesellschaftlich-kulturelle, insbesondere literarische Gesamtentwicklung gefügt werden die Dichtungen einerseits durch die Darstellung der Biographie des Dichters, soweit sie für das Anliegen belangvoll ist, anderseits durch die Frage nach ihren Adressaten, den intendierten Kommunikationssituationen und nach ihrer Funktion, drittens durch die Untersuchung der Beziehungen zu anderen literarischen Entwicklungen, etwa zur Bibelepik (Juvencus) bzw. zur liturgischen Hymnik (Hilarius, Ambrosius), ihre Beeinflussung durch die hagiographische und historiographische Prosa (Sulpicius Severus, Beda), durch das Aufkommen des opus geminum (Sedulius), die Prägung ihrer poetischen Sprache durch herausragende Dichtergestalten (Juvencus, Aldhelm), schließlich die Entwicklung von Ansätzen historischer Epik aus dem Geist der hagiographischen Passagen aus den Dichtungen (die, wie alle lateinischen Zitate, auch in deutscher Übersetzung geboten werden) und ihre Interpretation vermitteln einen Eindruck vom individuellen Kunstwollen und -vermögen der Dichter. Den Forschungsstand, insbesondere umstrittene Fragen, dokumentiert der Autor ausführlich, um dem Leser den Einstieg zu ermöglichen bzw. zu erleichtern. Jeder Halbband enthält ein Namen- und Sachregister sowie ein Verzeichnis der im Haupttext erörterten Dichterstellen. Wolfgang Kirsch (1938 – 2010) hat mit seinem großen Werk eine in ihrer Fülle bisher kaum wahrgenommene Literaturlandschaft erschlossen: Von Juvencus, der das lateinische Epos mit der «absoluten Dominanz einer einzigen Zentralgestalt, hinter der alle anderen Personen zurücktreten», revolutioniert, über die spätantiken hagiographischen Epen bis zu den karolingischen Großdichtungen und ihren Ausläufern. Die lateinische Epik ist jetzt bis zum Jahr 1000 überblickbar. Der 1. Halbband ist weiterhin wie folgt lieferbar: 1. Teil: XIV, 282 Seiten. Leinen. ISBN 978-3-7772-0404-8. 2. Teil: VI, 214 Seiten (S. 283 – 496). Leinen. ISBN 978-3-7772-0411-6.
Aktualisiert: 2021-02-02
> findR *
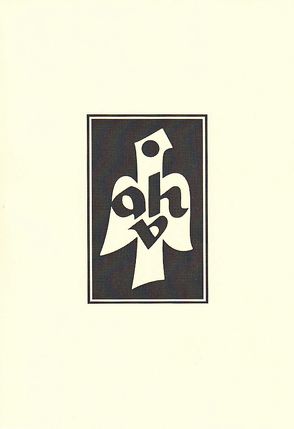
Nach Walter Berschins monumentaler Übersicht über tausend Jahre lateinischer vorwiegend hagiographischer Biographik in Prosa kann der Verlag nunmehr den ersten Halbband einer Geschichte der hagiographischen Versepik vorlegen, die vom IV. bis zum X. Jahrhundert reichen soll.Dieser erste Halbband führt vom Ende des IV. bis zur Wende vom VIII. zum IX. Jahrhundert. Behandelt werden im ersten Teilband der Johannespanegyrikus und die Felixnatalicia des Paulinus von Nola sowie das Carmen de martyrio Maccabaeorum, im zweiten die Martinsepen des Paulinus von Périgueux und des Venantius Fortunatus, die metrischen Heiligenviten Bedas und Alkuins sowie die Miracula Nynie episcopi und schließlich die hagiographisch-historischen Dichtungen Alkuins und thelwulfs.Im Mittelpunkt steht hierbei die beschreibende, vergleichende und genetische Untersuchung der Struktur dieser Werke. Gemeinsam sind ihnen ihr Stoff: das Leben bzw. die Passion von Heiligen, die Versform, der relativ große Umfang, die Verselbständigung der Einzelszene, die (abgesehen von Prudentius) offene Konstruktion, die immer neue Nachträge ermöglicht, und der Gestus des Rühmens. Im übrigen dominiert der experimentelle Charakter der Dichtungen; zwar führen sie antike und spätantike Traditionen fort, doch wird die Entwicklung im ganzen durch Brüche und immer neue Ansätze bestimmt. In die gesellschaftlich-kulturelle, insbesondere literarische Gesamtentwicklung gefügt werden die Dichtungen einerseits durch die Darstellung der Biographie des Dichters, soweit sie für das Anliegen belangvoll ist, anderseits durch die Frage nach ihren Adressaten, den intendierten Kommunikationssituationen und nach ihrer Funktion, drittens durch die Untersuchung der Beziehungen zu anderen literarischen Entwicklungen, etwa zur Bibelepik (Juvencus) bzw. zur liturgischen Hymnik (Hilarius, Ambrosius), ihre Beeinflussung durch die hagiographische und historiographische Prosa (Sulpicius Severus, Beda), durch das Aufkommen des opus geminum (Sedulius), die Prägung ihrer poetischen Sprache durch herausragende Dichtergestalten (Juvencus, Aldhelm), schließlich die Entwicklung von Ansätzen historischer Epik aus dem Geist der hagiographischen. Passagen aus den Dichtungen (die, wie alle lateinischen Zitate, auch in deutscher Übersetzung geboten werden) und ihre Interpretation vermitteln einen Eindruck vom individuellen Kunstwollen und -vermögen der Dichter.Den Forschungsstand, insbesondere umstrittene Fragen, dokumentiert der Autor (Jahrgang 1938) ausführlich, um dem Leser den Einstieg zu ermöglichen bzw. zu erleichtern. Der zweite Teilband enthält ein Namen- und Sachregister sowie ein Verzeichnis der im Haupttext erörterten Dichterstellen.Halbband zwei wird sich mit dem ersten verschränken und vor allem die kontinentale Entwicklung vom VIII. bis X. Jahrhundert verfolgen.
Aktualisiert: 2021-02-02
> findR *
Das Schicksal des Abendlandes
Die junge Byzantinerin Theresa will Pergamentmacherin werden - ein Unding in der Würzburger Zunft des Jahres 799. Ihr Aufbegehren löst eine Katatrophe aus, und mit knapper Not entkommt sie nach Fulda. Dort verwickelt sie der strenge Kirchenmann Alkuin von York, Ratgeber Karls des Großen, immer tiefer in die mörderischen Intrigen um eine gefälschte Urkunde. Von diesem Dokument hängt nicht weniger als die Herrschaft über das Abendland ab.
"Ein farbenprächtiges Tableau." NRZ
Aktualisiert: 2022-02-25
> findR *
Die einst je nach Brauch wechselnde Wortfolge vom Kleineren und Leichteren zum Größeren und Schwereren oder umgekehrt vom Größeren und Bedeutenderen zum Kleineren und Unbedeutenderen bürgerte sich im Neuhochdeutschen fest als 'mehr oder weniger' ein. Schon der Vierfache Schriftsinn hatte den einen wörtlichen um drei übertragene erweitert. Somit konnte ein wörtlich quantitatives Mehr auch ein übertragen qualitatives Weniger meinen. Der Eingott des Monotheismus leistet mehr als die Vielgötterei des Polytheismus. Insgesamt aber fördert menschlicher Geist die klare Stufung und Wörtlichkeit des Zahlen- und Buchstabensystems, des Dreischritts aus Geist-Wort-Tat und das Weiterleben des Altbewährten im stets auf echten Fortschritt hin zu überprüfenden Neuen. Das verhalf dem Vorbild herausragender Einzelfallentscheidungen zu einem Mehr sowohl nach Regeln und Gesetzen von Naturhaftigkeit als auch nach gottgefälliger Sittlichkeit.
Aktualisiert: 2021-02-23
> findR *
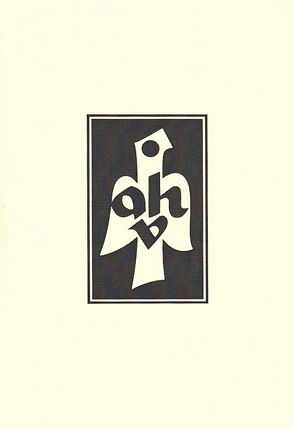
Nach Walter Berschins monumentaler Übersicht über tausend Jahre lateinischer vorwiegend hagiographischer Biographik in Prosa kann der Verlag nunmehr den ersten Halbband einer Geschichte der hagiographischen Versepik vorlegen, die vom IV. bis zum X. Jahrhundert reichen soll.Dieser erste Halbband führt vom Ende des IV. bis zur Wende vom VIII. zum IX. Jahrhundert. Behandelt werden im ersten Teilband der Johannespanegyrikus und die Felixnatalicia des Paulinus von Nola sowie das Carmen de martyrio Maccabaeorum, im zweiten die Martinsepen des Paulinus von Périgueux und des Venantius Fortunatus, die metrischen Heiligenviten Bedas und Alkuins sowie die Miracula Nynie episcopi und schließlich die hagiographisch-historischen Dichtungen Alkuins und thelwulfs.Im Mittelpunkt steht hierbei die beschreibende, vergleichende und genetische Untersuchung der Struktur dieser Werke. Gemeinsam sind ihnen ihr Stoff: das Leben bzw. die Passion von Heiligen, die Versform, der relativ große Umfang, die Verselbständigung der Einzelszene, die (abgesehen von Prudentius) offene Konstruktion, die immer neue Nachträge ermöglicht, und der Gestus des Rühmens. Im übrigen dominiert der experimentelle Charakter der Dichtungen; zwar führen sie antike und spätantike Traditionen fort, doch wird die Entwicklung im ganzen durch Brüche und immer neue Ansätze bestimmt. In die gesellschaftlich-kulturelle, insbesondere literarische Gesamtentwicklung gefügt werden die Dichtungen einerseits durch die Darstellung der Biographie des Dichters, soweit sie für das Anliegen belangvoll ist, anderseits durch die Frage nach ihren Adressaten, den intendierten Kommunikationssituationen und nach ihrer Funktion, drittens durch die Untersuchung der Beziehungen zu anderen literarischen Entwicklungen, etwa zur Bibelepik (Juvencus) bzw. zur liturgischen Hymnik (Hilarius, Ambrosius), ihre Beeinflussung durch die hagiographische und historiographische Prosa (Sulpicius Severus, Beda), durch das Aufkommen des opus geminum (Sedulius), die Prägung ihrer poetischen Sprache durch herausragende Dichtergestalten (Juvencus, Aldhelm), schließlich die Entwicklung von Ansätzen historischer Epik aus dem Geist der hagiographischen. Passagen aus den Dichtungen (die, wie alle lateinischen Zitate, auch in deutscher Übersetzung geboten werden) und ihre Interpretation vermitteln einen Eindruck vom individuellen Kunstwollen und -vermögen der Dichter.Den Forschungsstand, insbesondere umstrittene Fragen, dokumentiert der Autor (Jahrgang 1938) ausführlich, um dem Leser den Einstieg zu ermöglichen bzw. zu erleichtern.Der zweite Teilband enthält ein Namen- und Sachregister sowie ein Verzeichnis der im Haupttext erörterten Dichterstellen.Halbband zwei wird sich mit dem ersten verschränken und vor allem die kontinentale Entwicklung vom VIII. bis X. Jahrhundert verfolgen.
Aktualisiert: 2021-02-02
> findR *
MEHR ANZEIGEN
Bücher zum Thema Alkuin
Sie suchen ein Buch über Alkuin? Bei Buch findr finden Sie eine große Auswahl Bücher zum
Thema Alkuin. Entdecken Sie neue Bücher oder Klassiker für Sie selbst oder zum Verschenken. Buch findr
hat zahlreiche Bücher zum Thema Alkuin im Sortiment. Nehmen Sie sich Zeit zum Stöbern und finden Sie das
passende Buch für Ihr Lesevergnügen. Stöbern Sie durch unser Angebot und finden Sie aus unserer großen Auswahl das
Buch, das Ihnen zusagt. Bei Buch findr finden Sie Romane, Ratgeber, wissenschaftliche und populärwissenschaftliche
Bücher uvm. Bestellen Sie Ihr Buch zum Thema Alkuin einfach online und lassen Sie es sich bequem nach
Hause schicken. Wir wünschen Ihnen schöne und entspannte Lesemomente mit Ihrem Buch.
Alkuin - Große Auswahl Bücher bei Buch findr
Bei uns finden Sie Bücher beliebter Autoren, Neuerscheinungen, Bestseller genauso wie alte Schätze. Bücher zum
Thema Alkuin, die Ihre Fantasie anregen und Bücher, die Sie weiterbilden und Ihnen wissenschaftliche
Fakten vermitteln. Ganz nach Ihrem Geschmack ist das passende Buch für Sie dabei. Finden Sie eine große Auswahl
Bücher verschiedenster Genres, Verlage, Autoren bei Buchfindr:
Sie haben viele Möglichkeiten bei Buch findr die passenden Bücher für Ihr Lesevergnügen zu entdecken. Nutzen Sie
unsere Suchfunktionen, um zu stöbern und für Sie interessante Bücher in den unterschiedlichen Genres und Kategorien
zu finden. Unter Alkuin und weitere Themen und Kategorien finden Sie schnell und einfach eine Auflistung
thematisch passender Bücher. Probieren Sie es aus, legen Sie jetzt los! Ihrem Lesevergnügen steht nichts im Wege.
Nutzen Sie die Vorteile Ihre Bücher online zu kaufen und bekommen Sie die bestellten Bücher schnell und bequem
zugestellt. Nehmen Sie sich die Zeit, online die Bücher Ihrer Wahl anzulesen, Buchempfehlungen und Rezensionen zu
studieren, Informationen zu Autoren zu lesen. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen das Team von Buchfindr.