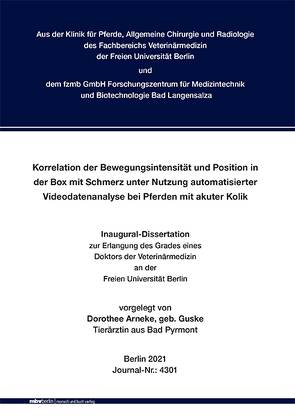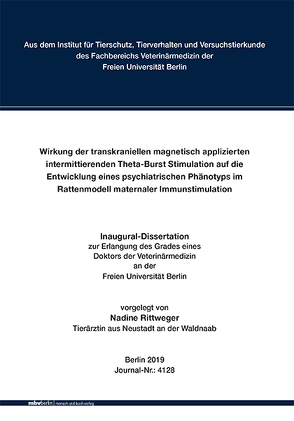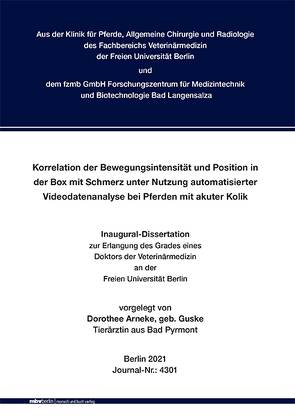
Die Schmerzerkennung und Beurteilung des Schmerzgrads beim Pferd stellt eine große Herausforderung dar, da Pferde sich nicht verbal äußern können und Fluchttiere sind, die als Schutzmechanismus versuchen, den Schmerz zu kaschieren. Insbesondere bei Pferden mit akuter Koliksymptomatik ist die frühzeitige Erkennung und Einschätzung des Schmerzes essenziell, um frühzeitig eine entsprechende Therapie einzuleiten und damit die Prognose zu verbessern. Bis heute gibt es keinen Goldstandard zur Erfassung des Schmerzes beim Pferd. Aus diesem Grund wurde in dieser Studie die Eignung verschiedener Parameter zur Schmerzerkennung und Graduierung bei Pferden mit akuter Koliksymptomatik untersucht.
In Teil A dieser Studie, einer Vorstudie, wurden 49 Pferde untersucht, die aufgrund von Koliksymptomen in die Klinik überwiesen wurden. Die Pferde wurden nach Einlieferung in die Klinik, am darauffolgenden Tag und am Tag der Entlassung untersucht, so dass die Pferde als ihre eigenen Kontrollen dienten. Zusätzlich wurde eine Kontrollgruppe untersucht, die ohne Schmerzen in die Klinik transportiert wurde. Zunächst wurden bei den Patienten verschiedene Schmerzscores, ein Score zur Einschätzung der Schwere der Kolik und ein Score zur Einschätzung der Sepsis erhoben. Im Anschluss wurden die Scores miteinander verglichen. Dabei stellte sich heraus, dass die Schwere der Kolik und die Schwere der Sepsis nicht zwangsläufig mit dem Schmerzgrad korrelierten. Zudem zeigte sich, dass verschiedene Schmerzscores basierend auf der Mimik gute Übereinstimmungen untereinander zeigten. Im Gegensatz dazu zeigte ein Vergleich dieser Schmerzscores mit Schmerzscores, die anhand von verhaltensbasierenden und physiologischen Parametern erhoben wurden, nur moderate Übereinstimmungen.
Weiterhin wurden die Herzfrequenzvariabilität und Blutdruckparameter untersucht. Bei der Herzfrequenzvariabilitäts-Analyse (HRV-Analyse) wurden das mittlere RR-Intervall (MeanRR), die Standardabweichung der Varianz der NN-Intervalle (SDNN), die Standardabweichung der Differenzen aufeinanderfolgender RR-Intervalle (RMSSD = root mean square of successiv differences between adjacent NN-Intervals), die absolute Anzahl der Paare benachbarter NN-Intervalle, die sich um mindesten 50 ms vom vorausgehenden NN-Intervall unterscheiden (NN50), der Prozentsatz der Paare benachbarter NN-Intervalle, die sich um mindesten 50 ms vom vorausgehenden NN-Intervall unterscheiden (pNN50), die Low-Frequency-Leistung (LF-Leistung), die High-Frequency-Leistung (HF-Leistung) und das Verhältnis von LF und HF als sympathovagale Balance (LF/HF-Ratio) bestimmt, sowie die mittlere Herzfrequenz (MeanHR) aus dem EKG ermittelt. Bei der Blutdruckmessung wurden der systolisch arterielle Blutdruck (SBD), der mittlere arterielle Blutdruck (MBD), der diastolisch arterielle Blutdruck (DBD) und der systemisch-vaskuläre-Widerstands-Index (SVR-Index) gemessen. Hinsichtlich der Eignung als Schmerzparameter erwiesen sich in dieser Studie die Herzfrequenz, MeanRR und SVR-Index als nützlich mit signifikanten Unterschieden zwischen den Patienten mit unterschiedlichen Schmerzgraden. Ob SBD, MBD, DBD, RMSSD, NN50 und pNN50 nützlich sein könnten, konnte in dieser Studie nicht klar definiert werden, da die Auswertung zu unterschiedlichen Ergebnissen führte. Für die übrigen Parameter konnte kein Zusammenhang mit Schmerz erkannt werden.
Die Auswertung einer Kontrollgruppe, bestehend aus 12 schmerzfreien Pferden, die in die Klinik überwiesen wurden, zeigte, dass nicht anzunehmen ist, dass Stress durch Transport oder die neue Umgebung die Messwerte der HRV-Analyse und Blutdruckmessung beeinflusste, da es keine signifikanten Unterschiede bei den Messwerten der Kontrollen von Tag 1 zu Tag 2 gab. Es gab Unterschiede in den Mittelwerten zwischen den Patienten und den Kontrollen, allerdings waren diese nur für RMSSD und SVR-Index signifikant, so dass die Untersuchung der Kontrollgruppe die Bedeutung von RMSSD und dem SVR-Index unterstrich, alle anderen Parameter allerdings relativierte.
In Teil B dieser Studie, dem Hauptteil, wurde ein Verfahren zur automatisierten Videodatenanalyse genutzt, mit dessen Hilfe es möglich war, Pferde in Videodaten automatisiert zu erkennen und Bewegungsparameter in Echtzeit abzuleiten. Dazu wurden 10 Pferde, die aufgrund von Koliksymptomatik in die Klinik überwiesen wurden, am Tag der Einlieferung, am folgenden Tag und am Tag der Entlassung für eine Stunde gefilmt. Mittels automatisierten Videodatenanalyse wurde die Bewegungsintensität mittels Optical Flow (OF) bestimmt und dem Schmerzgrad gegenüber gestellt, der mit Hilfe eines Schmerzscores (EQUUS-FAP) basierend auf der Mimik ermittelt wurde. Zudem konnten mit dieser Methode der automatisierten Videodatenanalyse Heatmaps erstellt werden, die den überwiegenden Aufenthalt der Pferde in der Box wiedergaben. Auch hierfür wurde ein Zusammenhang mit dem Schmerzgrad untersucht. Am Tag der Einlieferung war die Bewegungsaktivität der Patienten höher als am folgenden Tag sowie am Tag der Entlassung, allerdings war der Unterschied nicht signifikant. Ähnlich verhielt sich der Schmerzgrad der Patienten. Der Schmerzgrad war am Tag der Einlieferung signifikant höher als am Tag der Entlassung. Am Tag der Einlieferung und am folgenden Tag zeigte sich eine Korrelation zwischen Schmerzgrad und Bewegungsintensität. Je höher der Schmerzgrad war, desto höher war auch die Bewegungsintensität. Zudem zeigten Pferde, die euthanasiert oder chirurgisch behandelt wurden, eine höhere Bewegungsintensität als Pferde, die konservativ behandelt werden konnten. Die Heatmaps zeigten an allen drei Tagen für alle Pferde einen bevorzugten Standort im hinteren Teil der Box. Am Tag der Einlieferung zeigten sich die hochgradig schmerzhaften Pferde zusätzlich häufig in der Mitte der Box. Je weniger schmerzhaft die Pferde waren, desto häufiger wurden sie für kurze Zeiten an verschiedenen Lokalisationen innerhalb der Box gesehen, so dass der Verdacht nahe lag, dass mit abnehmendem Schmerzgrad mehr Interesse an der Umgebung vorlag. Sollte sich in weiteren Studien zeigen, dass die Bewegungsintensität und Position in der Box mit dem Schmerzgrad bei Pferden mit Kolik korreliert, steht auch Laien durch diese Studie ein Verfahren zur Verfügung, mit dem man in Echtzeit den Schmerzgrad anhand von Graphiken einfach und schnell ablesen kann.
Aktualisiert: 2021-12-23
> findR *

"Immunohistochemical and behavioral studies of postsynaptic serotonin1a receptor effects on adult neurogenesis"
With around 322 Million affected people worldwide and an increasing prevalence, depression is one of the most prevalent mental illnesses. The exact pathophysiological mechanisms of this disease have not been fully elucidated. In addition pharmacological therapy of depression comes along with a high non-responder rate and numerous adverse drug reactions. Further understanding of the etiology of depression is required to develop novel antidepressants with better efficacy and fewer adverse drug reactions. Studies of humans and animals suggest a dysregulation of the serotonergic system as well as alterations of adult neurogenesis in the development of depression. The 5-HT1A receptor, a subtype of the serotonin receptor family, was focussed in research and seems to play a significant role in the etiopathology of depression and the regulation of adult neurogenesis.
The 5-HT1A receptor is presynaptically located as an autoreceptor on serotonergic neurons in the raphe and postsynaptically as a heteroreceptor in the projection regions of serotonergic neurons such as the hippocampus. The well-established transgenic mouse model with an overexpression of postsynaptic 5-HT1A receptor (OE mouse) offers a good possibility to specifically investigate the effects of this receptor on adult neurogenesis, depression-like behavior, and hippocampus-dependent learning. Previous studies with OE mice indicate an antidepressant and proneurogenic effect of the postsynaptic 5-HT1A receptor. However, in these studies untreated or one-time treated mice were tested and, thus, compensatory mechanisms cannot be excluded. The present study aimed at analyzing the effects of chronic 5-HT1A receptor activation on adult neurogenesis, depression-like behavior and hippocampusdependent learning in OE mice compared to wildtype (WT) mice.
Furthermore, it is known that the serotonergic system is involved in the regulation of exerciseinduced adult neurogenesis. However, the proneurogenic effect in exercise-induced adult neurogenesis has not been related to any serotonin receptor-subtype yet. In this study, the involvement of the postsynaptic 5-HT1A receptor in exercise-induced adult neurogenesis was analyzed in the OE model. Both male and female mice were tested due to gender-specific differences in the prevalence and pathophysiology of the 5 HT1A receptor in depression as well as gender-specific differences in OE mice found in previous studies. After chronic 8-OH-DPAT or vehicle administration and in vivo labeling with BrdU, immunohistochemical studies for quantification of cell proliferation and survival in the dentate gyrus of male and female OE and WT mice were carried out. For analyzing exercise-induced adult neurogenesis a subgroup of both OE and WT mice had access or no access to a running wheel, respectively. Depression-like behavior of chronic 8-OH-DPAT or vehicle-treated OE and WT mice and untreated control animals was studied using the forced swim test and sucrose preference test. Differences in hippocampus-dependent learning of OE and WT animals were tested in the novel object recognition test and the novel object location test.
Voluntary wheel running was able to increase cell proliferation and survival in WT and OE mice. Considering the reduced distance traveled by OE mice, postsynaptically located 5-HT1A receptors are assumed to mediate a proliferative effect in exercise-induced adult neurogenesis.
Chronic 5-HT1A receptor activation did not result in increased cell proliferation or survival in either the transgenic mouse model or in WT animals. Female OE mice even showed a lower survival rate after chronic 5-HT1A receptor activation compared to WT animals and, correspondingly, depression-like behavior. The studies on hippocampus-dependent learning revealed no differences between OE and WT animals or the different treatment groups according to the results of cell survival. It is assumed that, in addition to 5-HT1A receptor desensitization after chronic receptor activation, mainly stress-causing factors such as injection and isolation were responsible for the present results. In conclusion, the results of our study, together with the results of a recent study on stress behavior of the OE mouse, indicate an increased stress sensitivity of the OE mouse. An interaction of sex hormones with postsynaptic 5-HT1A receptors as well as a decreased basal brain 5-HT concentration in female OE animals may result in a reduced cell survival rate and depression-like behavior of female OE animals following chronic 5-HT1A receptor activation. An analysis of stress response, the measurement of stress hormone concentrations such as corticosterone in blood and the determination of basal brain 5-HT concentrations in female transgenic mice are required to strengthen this assumption.
Aktualisiert: 2022-12-31
> findR *

Das Zungenband gehört zum erlaubten und üblicherweise eingesetzten Equipment im Pferderennsport in Deutschland. Über den deutschlandweiten Gebrauch und die Auswirkungen auf das Stressgeschehen beim Pferd ist bislang allerdings wenig bekannt. Steigendes öffentliches Interesse von Tierschutzorganisationen gegenüber dem Pferderennsport erhöht den Wunsch nach wissenschaftlich erhobenen Daten.
Vor diesem Hintergrund war es Ziel der vorliegenden Untersuchung, die Auswirkungen des Zungenbandes bei Rennpferden während des Trainings durch ausgewählte physiologische Blutparameter und der Herzfrequenzvariabilität zu ermitteln, um den Stressstimulus, der potentiell von einem Zungenbandeinsatz ausgehen kann, zu evaluieren. Zusätzlich wurden Fragebögen an Rennpferdetrainer versandt.
30 Traber und 29 Galopper von 9 verschiedenen Trainern haben für den klinischen Teil der Studie deutschlandweit eine Trainingseinheit unter realen Bedingungen mit Zungenband absolviert. Dieselben 30 Traber absolvierten die gleiche Trainingseinheit zu einem nahegelegenen weiteren Zeitpunkt zur gleichen Tageszeit erneut.
Die Blutproben und EKG-Sequenzen zur Bestimmung der Herzfrequenzvariabilität (HRV) wurden dazu in Ruhe, in Ruhe nach Einsetzen des Zungenbandes und unmittelbar nach dem Training entnommen und ausgewertet. Die Blutparameter Kortisol, Glukose, Laktat und Herzfrequenzanalyse-Parameter HF und LF, die Aussagen über die Parasympatikus- bzw. Sympathikusaktivität und sympathovagale Balance zulassen, wurden gemessen, um die Einflüsse auf den physiologischen Stoffwechsel und die HRV zu charakterisieren. Des Weiteren wurde das Verhalten während des Anlegens des Zungenbandes protokolliert.
Die Ergebnisse der Blutparameter Kortisol, Glukose und Laktat zeigten insgesamt nur einen leichten, aber nicht signifikanten Anstieg nach Anlegen des Zungenbandes, und eine signifikante Erhöhung von Kortisol und Laktat nach Beendigung des Trainings. Anhand der sich im Vergleich zu den Ruhewerten verändernden Laktatwerte lässt sich schlussfolgern, dass alle Pferde im anaeroben Bereich trainiert wurden.
Die Analyse der Frequenzbereichsparameter zeigte bei den Trabern nach Einsetzen des Zungenbandes eine Verschiebung der Parasympathikusaktivität hin zu einer dominierenden Sympathikusaktivität, die auch nach dem Training vorherrscht. Dies konnte bei den Galoppern nicht nachvollzogen werden. Hier waren über den gesamten Trainingsverlauf vermehrt die sympathischen Einflüsse auf das Herz dominant.
Die HRV kann als nichtinvasiver Parameter zur Erfassung der Aktivität des autonomen Nervensystems genutzt werden, um das Ausmaß des Stresses, dem die Pferde durch das Zungenband ausgesetzt sind, zu beurteilen. Weitere Einflüsse wie Rasse und Temperament dürfen dabei aber nicht ausser Acht gelassen werden.
Protokolliertes Kopfschlagen, Schweifschlagen und angespannte Gesichtsmuskulatur bis hin zum Steigen und einem damit einhergehenden Ausschluss aus der Studie wiesen in ihrer Form darauf hin, dass das Wohlbefinden der Pferde unter dem Einsatz des Zungenbandes litt.
Die Ergebnisse der Fragebögen zeigten, dass es deutschlandweit während des Trainings bei 17,2% und während des Rennens bei 19,2% der trainierten Pferde zum Einsatz von Zungenbändern kommt. Die relative Mehrheit der Pferde war zu diesem Zeitpunkt 4 Jahre alt.
Bei Galoppern kam das Zungenband bis zum vierten Lebensjahr seltener als bei den Trabern zum Einsatz. Es wurde unter Angabe leistungsverbessernder Endergebnisse trotz auftretender Probleme, die das Zungenband selbst mit sich bringt, im Rennsport eingesetzt. Besseres Handling und eine positive Unterstützung des Atmungsapparates standen dabei im Vordergrund.
Für Vergleiche wären weitere Studien mit höheren Fallzahlen und standardisierten Belastungstests unter Ausschluss weiterer potentieller Stressstimuli interessant.
Aktualisiert: 2022-12-31
> findR *
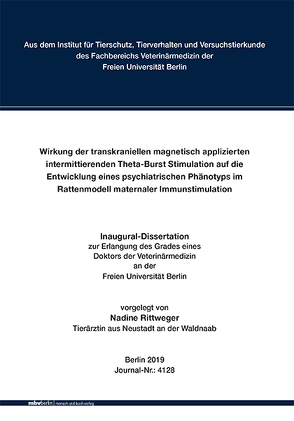
Schizophrenie ist weltweit eine der häufigsten und schwerwiegendsten psychiatrischen Erkrankungen. Trotz der Anwendung von modernsten Antipsychotika in Kombination mit individueller Psychotherapie leiden ungefähr 30 % der Patienten unter Rückfällen oder sprechen nur unzureichend auf die pharmakologische Behandlung an. Deshalb ist es wichtig, nach alternativen Behandlungsmöglichkeiten zu suchen. Eine vielversprechende Methode ist die transkranielle Magnetstimulation, da sie nicht-invasiv und schmerzfrei am Patienten angewendet werden kann. Mittels einer Magnetspule wird ein Magnetfeld erzeugt, das in der Lage ist über Depolarisation von Nervenzellen auf kortikale Bereiche des Gehirns erregend oder auch hemmend einzuwirken. Dadurch können Veränderungen in der Hirnaktivität, wie sie bei neuropsychiatrischen Krankheiten vorkommen, beeinflusst werden. Um die pathologischen Veränderungen im Gehirn hervorzurufen, wird in diesem Projekt das Poly(I:C)-Modell maternaler Immunstimulation an Ratten angewendet. Auf die Plastizität der Nervenzellen im Gehirn kann während seiner Entwicklung am meisten eingewirkt werden, daher findet die Magnetstimulation noch vor der Pubertät der Ratten im Alter von 6 Wochen statt. Verwendet wird ein intermittierendes Theta-Burst Protokoll repetitiver Stimulation.
Da die vollständige Ausprägung des Verhaltensphänotyps bei Schizophrenie erst im Erwachsenenalter auftritt, werden die Ratten im Alter von 12 Wochen in verschiedenen Verhaltensexperimenten getestet. Dazu gehören das Elevated Plus Maze, der Novel Object Recognition Test, das Morris Water Maze, der Pre-Pulse Inhibition Test, der Sucrose Consumption Test und der Porsolt Forced Swim Test. Anschließend wird eine Immunhistochemie der Gehirne mit den neuronalen Aktivitätsmarkern NeuN, Parvalbumin, Calbindin, cFos, Glutamat-Decarboxylase 67 und BDNF angefertigt.
Es konnten sowohl Unterschiede zwischen NaCl Kontroll- und Poly(I:C)-Tieren als auch zwischen Verum und Sham iTBS behandelten Tieren gefunden werden. Die Poly(I:C)-Tiere waren im Elevated Plus Maze weniger ängstlich als die Kontrolltiere. Nach der iTBS Behandlung kehrte sich dieses Verhältnis um. Im Novel Object Recognition Test zeigten die Poly(I:C)-Tiere ein Defizit im Langzeitgedächtnis, wohingegen sie im Morris Water Maze an den Tagen 2 und 4 hinsichtlich räumlichem Lernen und Gedächtnisbildung besser abschnitten als die anderen Gruppen. Im Porsolt Forced Swim Test waren die Sham-Kontrolltieren am inaktivsten. Es konnten keine Unterschiede zwischen den Gruppen im Pre-Puls Inhibition Test gefunden werden. In der Immunhistochemie sank die Expression von cFos und der Glutamat-Decarboxylase 67 im präfrontalen Kortex nach iTBS signifikant. Im Nucleus accumbens und dem ventralen tegmentalen Areal stieg die Expression von Calbindin und Glutamat-Decarboxylase 67 nach iTBS in den Poly(I:C)-Ratten signifikant an, wohingegen die Expression von cFos im ventralen tegmentalen Areal sank. Die Ergebnisse im dorsalen und ventralen Hippocampus waren sehr unterschiedlich.
Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass ein Langzeiteffekt der iTBS vorhanden ist und sie das Lernen in Poly(I:C)- und Kontrolltieren fördert. Allerdings haben viele Faktoren, wie das Handling, das Alter der Tiere und der Zeitraum zwischen Stimulation und Verhaltensversuchen, einen Einfluss auf die Ergebnisse. Die nicht vorhandenen Defizite im Pre-Puls Inhibition Test, welche normalerweise ein typisches Merkmal der Poly(I:C)-Tiere sind, sind ein Anzeichen dafür.
Aktualisiert: 2019-12-31
> findR *
MEHR ANZEIGEN
Bücher zum Thema animal behaviour
Sie suchen ein Buch über animal behaviour? Bei Buch findr finden Sie eine große Auswahl Bücher zum
Thema animal behaviour. Entdecken Sie neue Bücher oder Klassiker für Sie selbst oder zum Verschenken. Buch findr
hat zahlreiche Bücher zum Thema animal behaviour im Sortiment. Nehmen Sie sich Zeit zum Stöbern und finden Sie das
passende Buch für Ihr Lesevergnügen. Stöbern Sie durch unser Angebot und finden Sie aus unserer großen Auswahl das
Buch, das Ihnen zusagt. Bei Buch findr finden Sie Romane, Ratgeber, wissenschaftliche und populärwissenschaftliche
Bücher uvm. Bestellen Sie Ihr Buch zum Thema animal behaviour einfach online und lassen Sie es sich bequem nach
Hause schicken. Wir wünschen Ihnen schöne und entspannte Lesemomente mit Ihrem Buch.
animal behaviour - Große Auswahl Bücher bei Buch findr
Bei uns finden Sie Bücher beliebter Autoren, Neuerscheinungen, Bestseller genauso wie alte Schätze. Bücher zum
Thema animal behaviour, die Ihre Fantasie anregen und Bücher, die Sie weiterbilden und Ihnen wissenschaftliche
Fakten vermitteln. Ganz nach Ihrem Geschmack ist das passende Buch für Sie dabei. Finden Sie eine große Auswahl
Bücher verschiedenster Genres, Verlage, Autoren bei Buchfindr:
Sie haben viele Möglichkeiten bei Buch findr die passenden Bücher für Ihr Lesevergnügen zu entdecken. Nutzen Sie
unsere Suchfunktionen, um zu stöbern und für Sie interessante Bücher in den unterschiedlichen Genres und Kategorien
zu finden. Unter animal behaviour und weitere Themen und Kategorien finden Sie schnell und einfach eine Auflistung
thematisch passender Bücher. Probieren Sie es aus, legen Sie jetzt los! Ihrem Lesevergnügen steht nichts im Wege.
Nutzen Sie die Vorteile Ihre Bücher online zu kaufen und bekommen Sie die bestellten Bücher schnell und bequem
zugestellt. Nehmen Sie sich die Zeit, online die Bücher Ihrer Wahl anzulesen, Buchempfehlungen und Rezensionen zu
studieren, Informationen zu Autoren zu lesen. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen das Team von Buchfindr.