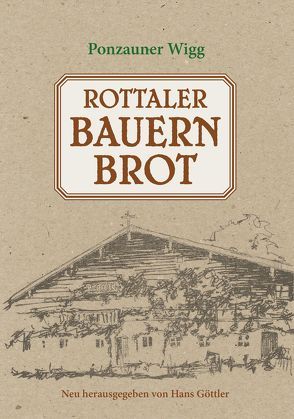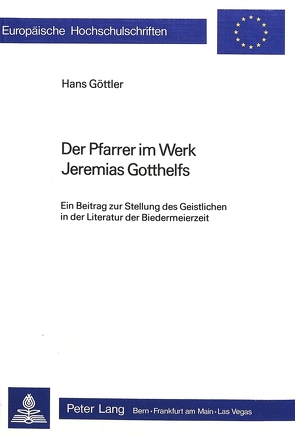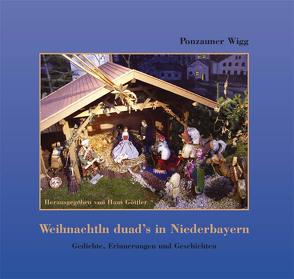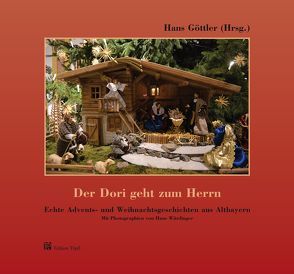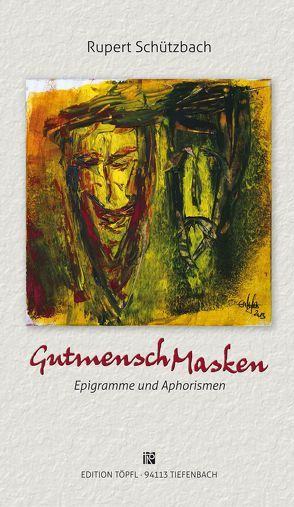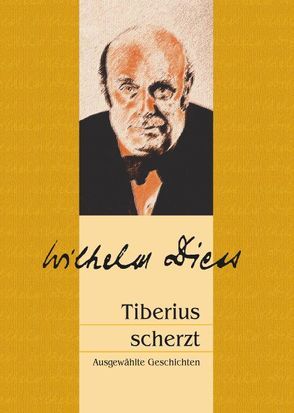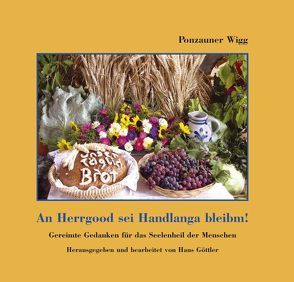"Fast alle Leute, die als Moralisten auftreten, tragen Gutmensch-Masken."
Schneidige Zungen gelebten Lebens
Er zaudert nicht, er zielt genau, er zieht keinen Colt, seine Waffe ist das Wort, und wenn er nicht trifft, dann hat er absichtlich knapp daneben gezielt und wenn er trifft, dann immer ins Schwarze. „Wo die Unordnung weiter wachsen kann, ist das Chaos noch nicht perfekt.“ Mit diesem Aphorismus begrüßt er mich. Er ist ihm gerade entschlüpft, vielleicht angesichts der Zettel, Papiere, Hefte, Bücher, die ihn umgeben. Da schiebt er zwei Sentenzen nach: „Glückliche Verlierer sind die eigentlichen Sieger“ und „Das Alter ist nicht unbedingt die Zeit für Karrieren.“ Vor gut 30 Jahren durfte ich Rupert Schützbach kennenlernen. Damals war er noch etwas jünger, als ich es heute bin, und nun wird er 80 Jahre alt, ungebrochen, der Schalk blitzt aus schmalen Augenschlitzen, und so sehr er Altersmilde ausstrahlt, vermag er auch dem Zorn mal Zügel zu geben. Wie nur kann ein so Stiller so laut werden?
Rupert Schützbach ist ein guter Freund geworden, seine Texte sind Takt- und Stichwortgeber, seine Worte, ausgesät wie Samen, sind vielfach aufgegangen und das schönste ist: Die Quelle versiegt nicht. Sie speist sich aus den täglichen Einfällen, die ihn zu umschwirren scheinen. Sie nährt sich aus einer reichhaltigen Kenntnis der Literatur unserer Tage und einer Beobachtungs- und Auffassungsgabe, mit der er die Gedanken sammelt, um sie anschließend wie der Bauer die Sense zu dengeln. Und so werden sie zu schneidigen Zungen gelebten Lebens. Schützbach-Aphorismen sind Ohrwürmer, sie dringen tief.
In diesem Buch hat Rupert Schützbach, neben neuen Epigrammen aus mehreren Jahren, Aphorismen, geschrieben im 80. Lebensjahr, gesammelt. Seit dem 5. Dezember 2012 hat er die täglichen Assoziationen, „subjektive Einzelgefühle“, wie er sagt, notiert, manchmal ein halbes Dutzend täglich. „Gedanken haben Widerhaken, an denen weitere Gedanken hängen bleiben. So entstehen Assoziationen.“ Und so entstehen Aphorismen. Unerhörte Wendungen, Wortbilder, Wortspiele und Pointen, auch Kalauer sind sein Material. Spiel und Fantasie sucht und findet er im unerschöpflichen Reservoir der Sprache. „Silbenfieber, Buchstabenkrebs, Sprachtod“ kennt er nicht, die Sprache ist ihm Verteidigungsmittel, Lebensmittel, Überlebensmittel, seit er als 14-Jähriger seine ersten Schreibversuche gemacht hat. Da war es noch weit bis zur ersten Veröffentlichung. Aber seit er als 30-Jähriger erstmals den Pegasus öffentlich gesattelt hat, hat er die Zügel nicht mehr losgelassen, alle Gangarten des Musenrosses ausprobiert.
Das Buch beginnt mit Epigrammen und ein jedes zeigt, was zum Beispiel 16 Wörter vermögen wie in dem Franz Kafka zugeeigneten Gedicht „Milena, meine Liebe“: „Von der Liebe / bleibt nie ein Rest. / Entweder es bleibt / die ganze Liebe / oder gar nichts.“ – Ein zweites nur wenige Worte längeres Gedicht ist betitelt mit „Abschied“: „Wer hat schon jemals / einen Schatten / lächeln gesehen? // Ich sah dich lächeln, / als du nur noch / ein Schatten / deiner selbst warst.“
Seine Texte geben die Richtung vor, nicht das Ziel. Sinn- und Gottsuche, Freundschaft, die drängenden Fragen des Menschseins und auch – aber ohne Zeigefingermentalität – die Mahnung, mit der Schöpfung sorgsam umzugehen. „Fast alle Leute, die als Moralisten auftreten, tragen Gutmensch-Masken.“ „Gutmensch-Masken“ – eine Metapher kann schon ein Aphorismus sein. Der Dichter weiß „Unter der Gürtellinie der Moral beginnt die Amoralität.“ Sich der Doppeldeutigkeit und Mehrwertigkeit der Sprache bewusst, schießt er manchen spitzen Pfeil ab, hält er seiner Zeit und ihren sich allzu gern mit Menschlichkeit tarnenden Akteuren den Spiegel vor. „Schreiben ist mein Leben, ich möchte mich artikulieren, ich gehe im Wort, in der Sprache auf. Aber das Schreiben ist auch eine Art seelische Hygiene, in der ich meine Komplexe und Hemmungen, meine Schwächen und Laster sublimiere.“
Er schlägt dem Tempo unserer Zeit ein Schnippchen. Das Hamsterrad, in dem wir laufen, dreht sich für uns zu schnell, für die Jünger des Kapitalismus noch zu langsam. Wer zeit- und ortlos der Optimierung allen Tuns huldigt, gerät über kurz oder lang buchstäblich unter die Räder. Schützbach-Literatur ist ein Meuterer gegen diese ach so moderne Aufholjagd. Sie verlangsamt die Tretmühle, sie entschleunigt. „Gegen die Zeit gewinnt nur, wer sie überhaupt nicht beachtet.“
Der im wunderschönen Passauer Stadtteil Hals unmittelbar an der Ilz – seinem Lebensfluss – geborene Dichter ist Mitglied des PEN-Clubs,
der Humboldt-Gesellschaft, der Regensburger Schriftstellergruppe International und des Passauer Literaturkreises. Den Kulturellen Ehrenbrief der Stadt Passau hat er bereits 1991 erhalten. Gerade ist der Kulturpreis Literatur des Landkreises Passau dazugekommen. Weit über 2000 literarische Einzelveröffentlichungen in Zeitungen und Zeitschriften stehen zu Buche. Ebenso Beiträge in über 150 Anthologien, Schulbüchern, Kalendern. Ein Dutzend Gedicht- und Epigrammbändchen, vier Aphorismusbücher und eine Erzählung hat er veröffentlicht. Längst hat er das Internet für sich entdeckt oder umgekehrt das weltweite Netz seine Früchte in den Korb gepackt. In vielen Zitatesammlungen ist er umgeben von Namen wie Oscar Wilde, Mark Twain, Albert Einstein, Michelangelo oder Konfuzius. Was in seiner Heimat nur Eingeweihte wissen: Der ehemalige Zollbeamte (der Aphorismus „Ich bin ein Zöllner. Ich kenne meine Grenzen“ ist sein wohl bekanntester) zählt zu den Meistern seines Fachs.
In der „Deutschen Literaturgeschichte“ von Wilhelm Bortenschlager heißt es: „Seit Erich Kästner hat kein deutscher Lyriker mehr so prosaische und doch poetische Aussagen mit hintergründigem Humor gemacht.“ Heinz Lemmermann schreibt in seinem Streifzug durch 400 Jahre Sinngedichte: „Auch im 20. Jahrhundert ist so manche Epigramm-Perle dazugekommen“ und nennt den so bescheiden und still vor sich hin arbeitenden Schützbach. In seiner Schreibklause im Ilztal, wo er sich umgeben hat mit vielen Büchern und Bildern regionaler Künstler – mit deren Urhebern er oft auch einen regen Briefwechsel führt oder geführt hat – ruht noch so mancher ungehobene Schatz, etwa der Roman „Die Taschendiebin“ und zahlreiche Gedichte. Es kreißt an seinem Schreibtisch. Und ehe man sich versieht, stolpert man über ein frisches Epigramm: „Es ist kein Versprecher, / Fritz wird immer frecher, / sagt zum Chefredakteur: / „Chefreaktionär!“ So sollte man ein Porträt nicht beenden, meint er. „Der Aphoristiker behandelt ein Thema nicht ein Buch lang, sondern nur einen Satz lang: Lakonie statt Langatmigkeit.“ Schon besser.
Stefan Rammer