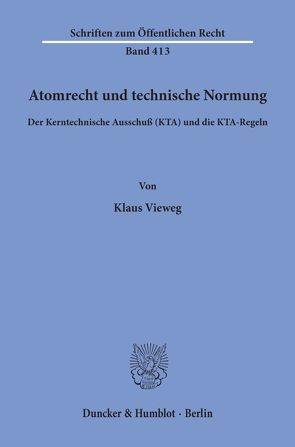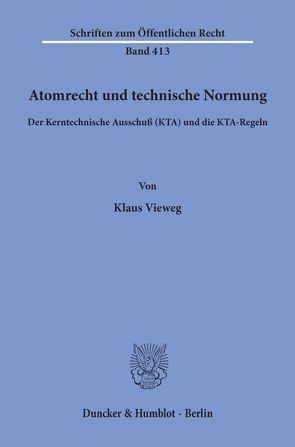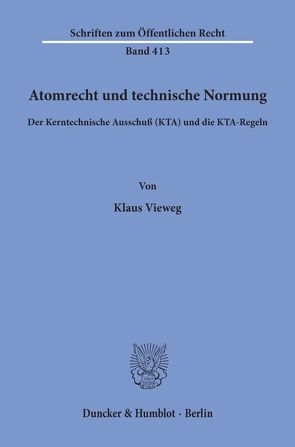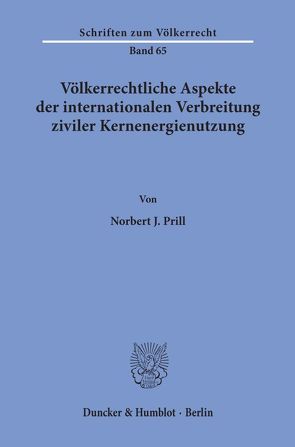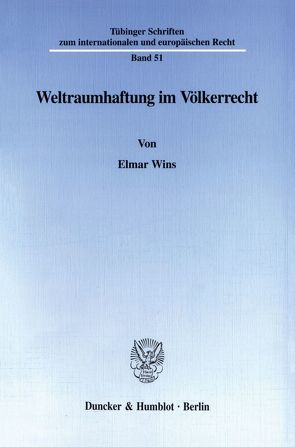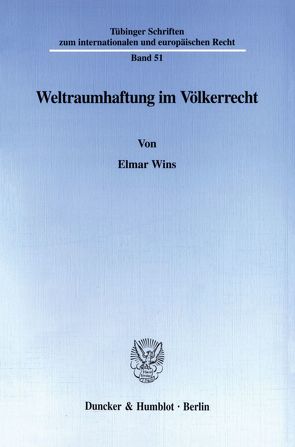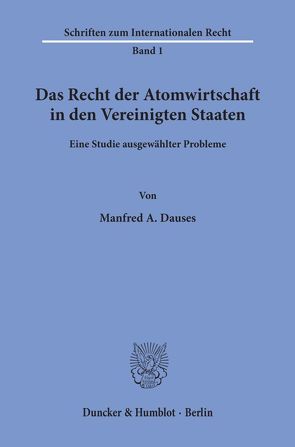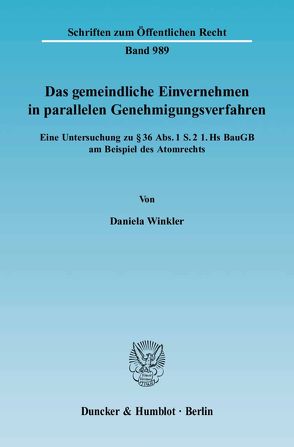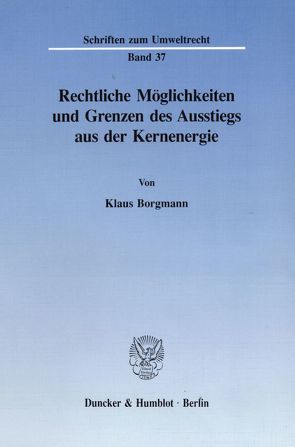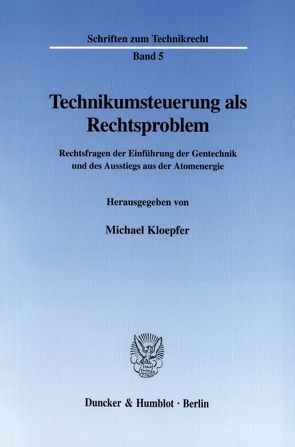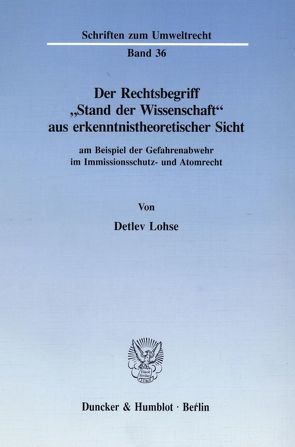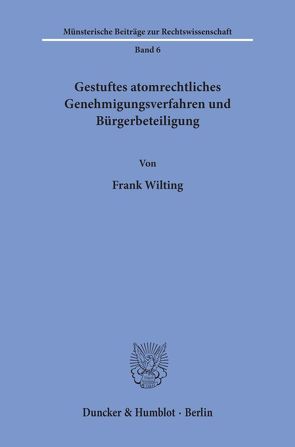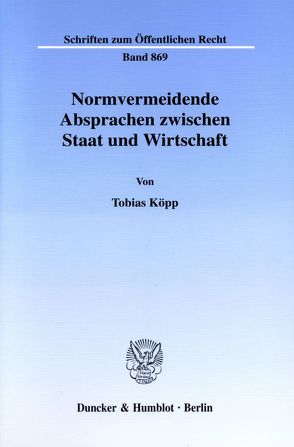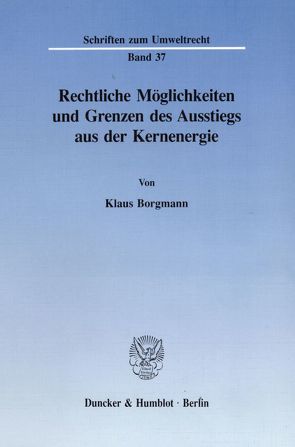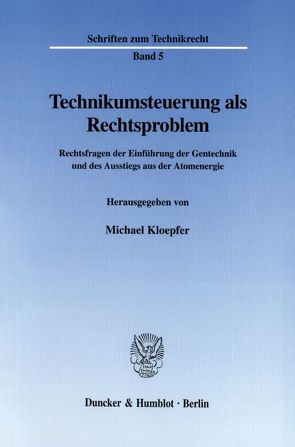Aktualisiert: 2023-06-15
> findR *
Aktualisiert: 2023-06-15
> findR *
Aktualisiert: 2023-06-15
> findR *
Aktualisiert: 2023-06-15
> findR *
Aktualisiert: 2023-06-15
> findR *
Aktualisiert: 2023-06-15
> findR *
Aktualisiert: 2023-06-15
> findR *
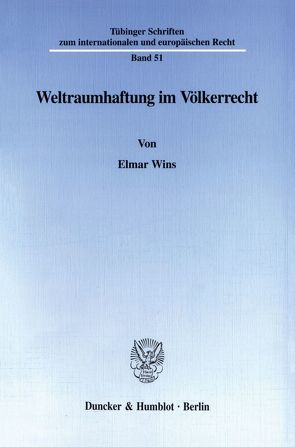
Weltraumhaftung beinhaltet die Regeln, die bei schadensverursachenden Aktivitäten im Weltraum Anwendung finden. Elmar Wins stellt in der vorliegenden Arbeit den völkerrechtlichen Teil dieser Regeln dar, bestimmt deren Stellung im Völkerrecht und bewertet sie hinsichtlich ihrer Alltagstauglichkeit.
In der kurzen Einführung in den völkerrechtlichen »Corpus Iuris Spatialis« geht der Autor kritisch auf die Begrenzung von Luft- und Weltraum anhand der Duldung von Satellitenüberflügen ein und begründet den objektiven Auslegungsansatz für die Weltraumverträge. Die Darstellung der Quellen der Weltraumhaftung konzentriert sich auf die Haftungsformen, den ersatzfähigen Schaden sowie die Einbeziehung von natürlichen Personen und Internationalen Organisationen. Zusätzlich werden die Feinheiten des Weltraumhaftungsübereinkommens von 1972 erläutert, die besondere Bedeutung und Funktion von Art. VI des Weltraumvertrags herausgestellt und die Unsicherheiten bei der allgemeinen völkerrechtlichen Verantwortlichkeit beschrieben.
Die Evaluation der Weltraumhaftung beginnt mit ihrer Positionsbestimmung in der Völkerrechtsordnung. Dabei berücksichtigt der Autor besonders die Tätigkeit der Völkerrechtskommission der Vereinten Nationen in den Bereichen Staatenverantwortlichkeit und Haftung für völkerrechtlich nicht verbotenes Verhalten. Aus den verschiedenen Betrachtungen offenbart sich die Sonderstellung der Weltraumhaftung im Völkerrecht. Die Alltagstauglichkeit der Weltraumhaftung fällt unterschiedlich aus. Bei dem Problem des Space Debris ist die Analyse aufgrund der mangelnden Nachweismöglichkeit des verursachenden Staats negativ. Dagegen lassen sich die Fragen der nuklearen Energiequellen im Weltraum mit Hilfe der Weltraumhaftung lösen. Auch auf die Internationalisierung und Privatisierung von Weltraumaktivitäten findet sie ausreichende Antworten. Es wird jedoch ersichtlich, daß privatrechtliche Haftungssysteme zunehmend an Bedeutung gewinnen.
Aktualisiert: 2023-06-15
> findR *
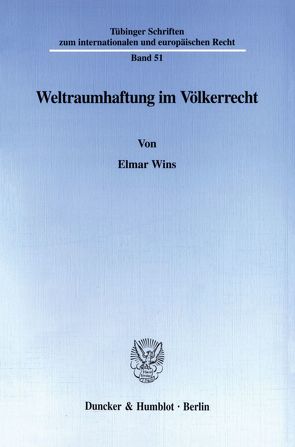
Weltraumhaftung beinhaltet die Regeln, die bei schadensverursachenden Aktivitäten im Weltraum Anwendung finden. Elmar Wins stellt in der vorliegenden Arbeit den völkerrechtlichen Teil dieser Regeln dar, bestimmt deren Stellung im Völkerrecht und bewertet sie hinsichtlich ihrer Alltagstauglichkeit.
In der kurzen Einführung in den völkerrechtlichen »Corpus Iuris Spatialis« geht der Autor kritisch auf die Begrenzung von Luft- und Weltraum anhand der Duldung von Satellitenüberflügen ein und begründet den objektiven Auslegungsansatz für die Weltraumverträge. Die Darstellung der Quellen der Weltraumhaftung konzentriert sich auf die Haftungsformen, den ersatzfähigen Schaden sowie die Einbeziehung von natürlichen Personen und Internationalen Organisationen. Zusätzlich werden die Feinheiten des Weltraumhaftungsübereinkommens von 1972 erläutert, die besondere Bedeutung und Funktion von Art. VI des Weltraumvertrags herausgestellt und die Unsicherheiten bei der allgemeinen völkerrechtlichen Verantwortlichkeit beschrieben.
Die Evaluation der Weltraumhaftung beginnt mit ihrer Positionsbestimmung in der Völkerrechtsordnung. Dabei berücksichtigt der Autor besonders die Tätigkeit der Völkerrechtskommission der Vereinten Nationen in den Bereichen Staatenverantwortlichkeit und Haftung für völkerrechtlich nicht verbotenes Verhalten. Aus den verschiedenen Betrachtungen offenbart sich die Sonderstellung der Weltraumhaftung im Völkerrecht. Die Alltagstauglichkeit der Weltraumhaftung fällt unterschiedlich aus. Bei dem Problem des Space Debris ist die Analyse aufgrund der mangelnden Nachweismöglichkeit des verursachenden Staats negativ. Dagegen lassen sich die Fragen der nuklearen Energiequellen im Weltraum mit Hilfe der Weltraumhaftung lösen. Auch auf die Internationalisierung und Privatisierung von Weltraumaktivitäten findet sie ausreichende Antworten. Es wird jedoch ersichtlich, daß privatrechtliche Haftungssysteme zunehmend an Bedeutung gewinnen.
Aktualisiert: 2023-06-15
> findR *
Aktualisiert: 2023-06-15
> findR *
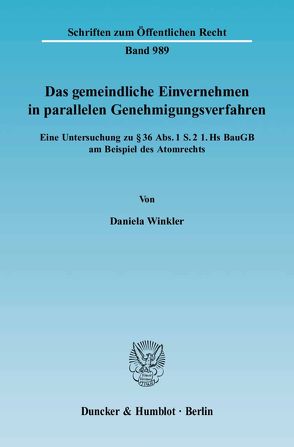
Die Bedeutung des § 36 Abs. 1 S. 2 1. Hs. BauGB wurde bislang entsprechend der gesetzgeberischen Intention auf Fallgestaltungen der Konzentration beschränkt. Daniela Winkler untersucht die Erweiterung des Anwendungsbereichs auf sog. parallele Genehmigungsverfahren. Durch eine detaillierte Auslegung des § 36 Abs. 1 S. 2 1. Hs. BauGB kommt sie zu dem Ergebnis, dass diese Vorschrift ein mehrfaches gemeindliches Einvernehmenserfordernis begründet, sofern der Inhalt der Parallelgenehmigung präjudizierend auf die Entscheidung der Gemeinde im Baugenehmigungsverfahren wirkt. Die tatsächliche Relevanz der Norm zeigt sich bei der Übertragung des Ergebnisses auf das Referenzgebiet des Atomrechts. Die Anwendung des § 36 Abs. 1 S. 2 1. Hs. BauGB illustriert, dass ein mehrfaches gemeindliches Einvernehmen in Ausnahmefällen erforderlich ist - zu diesen zählt etwa die atomrechtliche Errichtungsgenehmigung nach § 7 AtG. Das Genehmigungsverfahren nach § 6 AtG, welches auf Grund eines politischen Paradigmenwechsels in jüngerer Zeit verstärkte Aktualität erfahren hat, stellt dagegen keinen solchen Ausnahmefall dar.
Aktualisiert: 2023-06-15
> findR *

§ 7 Abs. 1 als zentrale Genehmigungsvorschrift des Atomgesetzes für Kernkraftwerke findet mangels Errichtung neuer Anlagen seit längerer Zeit ausschließlich auf Veränderungsgenehmigungen Anwendung. Christian Raetzke befaßt sich in seinem Werk mit der daraus folgenden Bedeutung für Wissenschaft, Rechtsprechung und Praxis.
Nach einer Behandlung verfahrensrechtlicher Aspekte wie Genehmigungsbedürftigkeit und Öffentlichkeitsbeteiligung widmet er sich im Schwerpunkt materiellrechtlichen Fragen. Hier erweist sich der Reiz der Veränderungsgenehmigung darin, daß sie alle "klassischen" Probleme des Genehmigungstatbestandes - vor allem den Umfang der Schadensvorsorge - anspricht und zusätzlich ganz eigene Fragen aufwirft, die vor allem ihr Verhältnis zur Ausgangsgenehmigung und zu nachträglichen Auflagen betreffen.
Erörtert wird, inwieweit nachträgliche Anforderungen, die über das ursprünglich Genehmigte hinausgehen, an die Anlage gestellt werden können. Es wird dargelegt, daß die nach dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik erforderliche Vorsorge gegen Schäden maßgeblich ist, eine bloße Änderung der Sicherheitsphilosophie oder neue Erkenntnisse im Restrisikobereich aber keine Anforderungen rechtfertigen. Dabei ist es gleichgültig, ob die neuen Maßstäbe den Gegenstand einer Veränderungsgenehmigung oder einer nachträglichen Auflage bilden.
Der Autor behandelt viele Einzelfragen, für die hier die Stichworte Probabilistik und Deterministik und schutzzielorientierte Anwendung des kerntechnischen Regelwerks stehen, und bringt zahlreiche Beispiele. Somit wird den interessierten Kreisen ein Leitfaden an die Hand gegeben, wann und nach welchen Maßstäben eine Veränderungsgenehmigung zu erteilen ist.
Aktualisiert: 2023-06-15
> findR *
Aktualisiert: 2023-06-15
> findR *
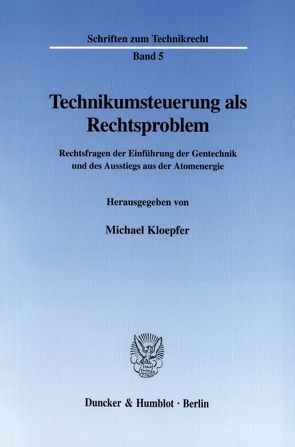
Der Band »Technikumsteuerung als Rechtsproblem - Rechtsfragen der Einführung der Gentechnik und des Ausstiegs aus der Atomenergie« enthält die Referate der gleichnamigen Berliner Tagung vom 6. November 2000. Acht namhafte Autoren aus Politik, Wirtschaft und Rechtswissenschaft setzen sich in der Schrift mit der Kernfrage der staatlichen Steuerbarkeit technischen Wandels teils grundlegend, teils anhand konkreter Fragestellungen auseinander.
Der immer rasanter ablaufende, nahezu alle Lebensbereiche des Menschen tangierende Technikwandel stellt neue Herausforderungen an politische und juristische Entscheidungsträger. Es gilt, die mit den technischen Innovationen verbundenen oder neu erkannten Risiken und gesellschaftlichen Implikationen rechtlich zu steuern bzw. umzusteuern. Dieser Regelungs- und Korrekturauftrag kann aber nur dann verantwortungsvoll erfüllt werden, wenn der Wissensstand der staatstragenden Akteure - zumindest annähernd - dem Stand der technischen Entwicklung entspricht. Das Wissensproblem ist damit Teil des Rechtsproblems der Technik(um)steuerung und verlangt nach einem interdisziplinären Diskurs, wie er in dieser Schrift geführt wird.
Technikumsteuerung durch Recht meint zunächst die rechtliche Bewältigung des Ausstiegs aus als korrekturbedürftig erkannten Risikotechniken bzw. die rechtlich gesteuerte Anpassung solcher Techniken an gewandelte gesellschaftliche Bedürfnisse. Auf der anderen Seite kommt dem technikumsteuernden Recht auch eine prospektive Funktion zu, in dem Sinne, daß eine rechtliche Infrastruktur etwa in Punkto Datenschutz, Gefahrenabwehr und Risikovorsorge die Verbreitung noch in Entwicklung befindlicher Techniken beschleunigen bzw. überhaupt erst ermöglichen kann. Dies bedeutet nicht ordnungsrechtliche Technikverhinderung, sondern die normative Abschirmung und Ermöglichung von Technik mit dem Ziel, die in ihr liegenden Chancen zum Nutzen der Allgemeinheit zu verwirklichen.
Diese Doppelfunktion des Technikrechts - einerseits technikbegrenzend, andererseits technikermöglichend auf Technikentwicklungen einzuwirken - spiegelt sich in den gesellschaftspolitisch besonders kontrovers diskutierten Vorhaben des Ausstiegs aus der Atomenergie und der Einführung der Gentechnik wider. Insbesondere die gesamtökonomischen Folgen und legistischen Möglichkeiten eines Ausstiegs aus der Atomenergie werden von den Autoren der Schrift kontrovers beurteilt. Aber auch die in hohem Maße grundrechtsrelevante Einführung und Förderung der Gentechnik wirft verschiedene politische und rechtliche Streitfragen auf.
Aktualisiert: 2023-06-15
> findR *
Aktualisiert: 2023-06-15
> findR *
Aktualisiert: 2023-06-15
> findR *
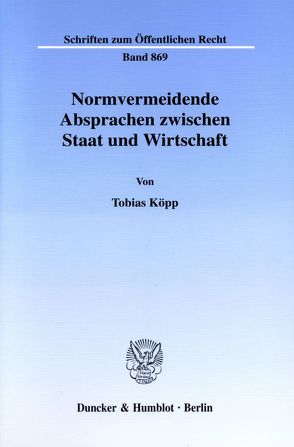
Absprachen zwischen Staat und Wirtschaft gewinnen zunehmend an Bedeutung. Die Atomenergiekonsensgespräche zwischen der Bundesregierung und den Energieversorgungsunternehmen sowie die Abkommen zur Reduzierung klimaschädigender Gase und zum Altautorecycling bilden nur einige Beispiele für den Vormarsch kooperativer Handlungsformen im Bereich der Normsetzung. Der Verfasser unterzieht die normvermeidende Absprache einer grundlegenden Analyse. Er entwickelt zunächst eine Typologie der verschiedenen Abspracheformen und untersucht die politisch-ökonomische Effizienz der Absprachen. Daran schließt sich die rechtliche Charakterisierung der Absprachen unter besonderer Berücksichtigung der Frage, ob die Absprachen rechtlich verbindliche Ansprüche auf Erfüllung oder Vertrauensschutztatbestände begründen. Tobias Köpp untersucht außerdem die rechtlichen Grenzen, die das Verfassungs-, Wettbewerbs- und Europarecht der staatlichen Mitwirkung an den Absprachen setzen. Hierzu erörtert er u. a. die Restriktionen, die sich aus Gesetzgebungspflichten, den Grundrechten Beteiligter und Dritter sowie dem Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip ergeben.
Aktualisiert: 2023-06-15
> findR *
Aktualisiert: 2023-05-25
> findR *
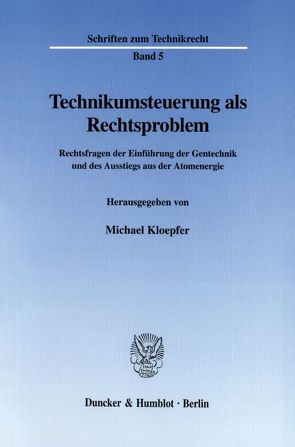
Der Band »Technikumsteuerung als Rechtsproblem - Rechtsfragen der Einführung der Gentechnik und des Ausstiegs aus der Atomenergie« enthält die Referate der gleichnamigen Berliner Tagung vom 6. November 2000. Acht namhafte Autoren aus Politik, Wirtschaft und Rechtswissenschaft setzen sich in der Schrift mit der Kernfrage der staatlichen Steuerbarkeit technischen Wandels teils grundlegend, teils anhand konkreter Fragestellungen auseinander.
Der immer rasanter ablaufende, nahezu alle Lebensbereiche des Menschen tangierende Technikwandel stellt neue Herausforderungen an politische und juristische Entscheidungsträger. Es gilt, die mit den technischen Innovationen verbundenen oder neu erkannten Risiken und gesellschaftlichen Implikationen rechtlich zu steuern bzw. umzusteuern. Dieser Regelungs- und Korrekturauftrag kann aber nur dann verantwortungsvoll erfüllt werden, wenn der Wissensstand der staatstragenden Akteure - zumindest annähernd - dem Stand der technischen Entwicklung entspricht. Das Wissensproblem ist damit Teil des Rechtsproblems der Technik(um)steuerung und verlangt nach einem interdisziplinären Diskurs, wie er in dieser Schrift geführt wird.
Technikumsteuerung durch Recht meint zunächst die rechtliche Bewältigung des Ausstiegs aus als korrekturbedürftig erkannten Risikotechniken bzw. die rechtlich gesteuerte Anpassung solcher Techniken an gewandelte gesellschaftliche Bedürfnisse. Auf der anderen Seite kommt dem technikumsteuernden Recht auch eine prospektive Funktion zu, in dem Sinne, daß eine rechtliche Infrastruktur etwa in Punkto Datenschutz, Gefahrenabwehr und Risikovorsorge die Verbreitung noch in Entwicklung befindlicher Techniken beschleunigen bzw. überhaupt erst ermöglichen kann. Dies bedeutet nicht ordnungsrechtliche Technikverhinderung, sondern die normative Abschirmung und Ermöglichung von Technik mit dem Ziel, die in ihr liegenden Chancen zum Nutzen der Allgemeinheit zu verwirklichen.
Diese Doppelfunktion des Technikrechts - einerseits technikbegrenzend, andererseits technikermöglichend auf Technikentwicklungen einzuwirken - spiegelt sich in den gesellschaftspolitisch besonders kontrovers diskutierten Vorhaben des Ausstiegs aus der Atomenergie und der Einführung der Gentechnik wider. Insbesondere die gesamtökonomischen Folgen und legistischen Möglichkeiten eines Ausstiegs aus der Atomenergie werden von den Autoren der Schrift kontrovers beurteilt. Aber auch die in hohem Maße grundrechtsrelevante Einführung und Förderung der Gentechnik wirft verschiedene politische und rechtliche Streitfragen auf.
Aktualisiert: 2023-05-25
> findR *

§ 7 Abs. 1 als zentrale Genehmigungsvorschrift des Atomgesetzes für Kernkraftwerke findet mangels Errichtung neuer Anlagen seit längerer Zeit ausschließlich auf Veränderungsgenehmigungen Anwendung. Christian Raetzke befaßt sich in seinem Werk mit der daraus folgenden Bedeutung für Wissenschaft, Rechtsprechung und Praxis.
Nach einer Behandlung verfahrensrechtlicher Aspekte wie Genehmigungsbedürftigkeit und Öffentlichkeitsbeteiligung widmet er sich im Schwerpunkt materiellrechtlichen Fragen. Hier erweist sich der Reiz der Veränderungsgenehmigung darin, daß sie alle "klassischen" Probleme des Genehmigungstatbestandes - vor allem den Umfang der Schadensvorsorge - anspricht und zusätzlich ganz eigene Fragen aufwirft, die vor allem ihr Verhältnis zur Ausgangsgenehmigung und zu nachträglichen Auflagen betreffen.
Erörtert wird, inwieweit nachträgliche Anforderungen, die über das ursprünglich Genehmigte hinausgehen, an die Anlage gestellt werden können. Es wird dargelegt, daß die nach dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik erforderliche Vorsorge gegen Schäden maßgeblich ist, eine bloße Änderung der Sicherheitsphilosophie oder neue Erkenntnisse im Restrisikobereich aber keine Anforderungen rechtfertigen. Dabei ist es gleichgültig, ob die neuen Maßstäbe den Gegenstand einer Veränderungsgenehmigung oder einer nachträglichen Auflage bilden.
Der Autor behandelt viele Einzelfragen, für die hier die Stichworte Probabilistik und Deterministik und schutzzielorientierte Anwendung des kerntechnischen Regelwerks stehen, und bringt zahlreiche Beispiele. Somit wird den interessierten Kreisen ein Leitfaden an die Hand gegeben, wann und nach welchen Maßstäben eine Veränderungsgenehmigung zu erteilen ist.
Aktualisiert: 2023-05-20
> findR *
MEHR ANZEIGEN
Bücher zum Thema Kernenergierecht
Sie suchen ein Buch über Kernenergierecht? Bei Buch findr finden Sie eine große Auswahl Bücher zum
Thema Kernenergierecht. Entdecken Sie neue Bücher oder Klassiker für Sie selbst oder zum Verschenken. Buch findr
hat zahlreiche Bücher zum Thema Kernenergierecht im Sortiment. Nehmen Sie sich Zeit zum Stöbern und finden Sie das
passende Buch für Ihr Lesevergnügen. Stöbern Sie durch unser Angebot und finden Sie aus unserer großen Auswahl das
Buch, das Ihnen zusagt. Bei Buch findr finden Sie Romane, Ratgeber, wissenschaftliche und populärwissenschaftliche
Bücher uvm. Bestellen Sie Ihr Buch zum Thema Kernenergierecht einfach online und lassen Sie es sich bequem nach
Hause schicken. Wir wünschen Ihnen schöne und entspannte Lesemomente mit Ihrem Buch.
Kernenergierecht - Große Auswahl Bücher bei Buch findr
Bei uns finden Sie Bücher beliebter Autoren, Neuerscheinungen, Bestseller genauso wie alte Schätze. Bücher zum
Thema Kernenergierecht, die Ihre Fantasie anregen und Bücher, die Sie weiterbilden und Ihnen wissenschaftliche
Fakten vermitteln. Ganz nach Ihrem Geschmack ist das passende Buch für Sie dabei. Finden Sie eine große Auswahl
Bücher verschiedenster Genres, Verlage, Autoren bei Buchfindr:
Sie haben viele Möglichkeiten bei Buch findr die passenden Bücher für Ihr Lesevergnügen zu entdecken. Nutzen Sie
unsere Suchfunktionen, um zu stöbern und für Sie interessante Bücher in den unterschiedlichen Genres und Kategorien
zu finden. Unter Kernenergierecht und weitere Themen und Kategorien finden Sie schnell und einfach eine Auflistung
thematisch passender Bücher. Probieren Sie es aus, legen Sie jetzt los! Ihrem Lesevergnügen steht nichts im Wege.
Nutzen Sie die Vorteile Ihre Bücher online zu kaufen und bekommen Sie die bestellten Bücher schnell und bequem
zugestellt. Nehmen Sie sich die Zeit, online die Bücher Ihrer Wahl anzulesen, Buchempfehlungen und Rezensionen zu
studieren, Informationen zu Autoren zu lesen. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen das Team von Buchfindr.