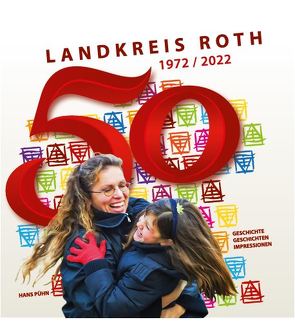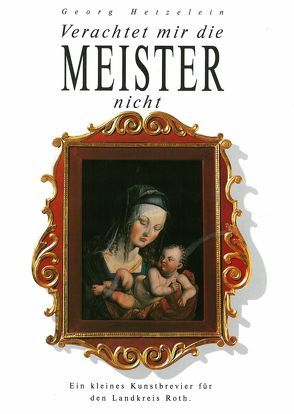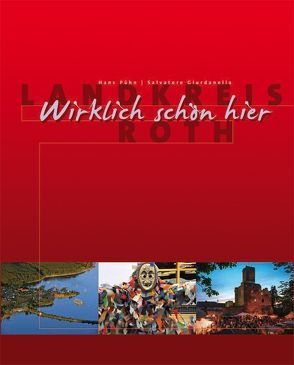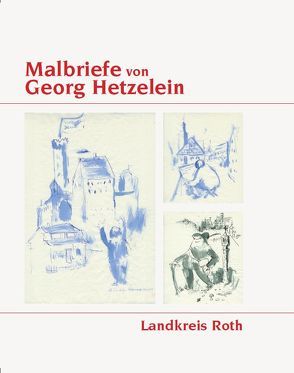Charlotte Bühl-Gramer* zu diesem Buch:
Lebensgeschichtliches Erzählen ist niemals nur eine erinnernde Rückschau auf die eigene Vergangenheit. Es ist immer auch ein zeitlich-biographischer Vermittlungsakt zwischen den verschiedenen Zeitebenen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und ein Diskursraum zwischen der eigenen Person und ihrer sozialen Umwelt. Im Rückblick werden dabei die persönlichen Erinnerungen nachträglich in Form und Struktur gebracht. Denn erst der Zusammenhang der Lebensgeschichte, der sich in der Retrospektive einstellt, weist einzelnen Erlebnissen und Erfahrungen ihre Bedeutung zu.
Im Lebensrückblick von Günther Kraus oszillieren die 18 kurzen Kapitel daher auch immer wieder zwischen einst und jetzt, aber auch zwischen dem vergangenen Geschehen und den Erinnerungsreflexen, den späteren Anreicherungen und Aufschichtungen der Erinnerung, die in die Gegenwart münden. Beides – Geschehenes und Erinnertes – ist nicht identisch, aber aufs Engste miteinander verwoben. Das „Andere“, „Frühere“ wieder aufsuchend, wird zur Gegenwart in Beziehung gesetzt und kann zeigen, wie und warum jemand so geworden ist, wie er ist. Retrospektive Verklärung, Larmoyanz oder gar eitle Selbstbespiegelung liegen Günther Kraus dabei völlig fern. Vielmehr wird das eigene Leben nicht nur in seiner sozialen Umwelt, sondern als tief in zeitgeschichtliche Kontexte eingebettet erfahren und erzählt – diese werden als erlebte und kommentierte Geschichte in der persönlichen Lebensgeschichte reflektiert.
Das autobiografische Gedächtnis nimmt, gerade bei ihm, der 1965 bis 1970 in Erlangen Geschichte studiert und über 30 Jahre lang Geschichte unterrichtet hat, immer auch das historische Gedächtnis zu Hilfe, da die allgemeine Geschichte jene des eigenen Lebens umfasst und als in hohem Maße identitätsrelevant erfahren und beschrieben wird. „Zeitleben“ nennt Günther Kraus denn auch in seinem Vorwort diese Verknüpfung des eigenen, fortschreitenden und fortgeschrittenen Lebens mit Geschichte. Die eigene Lebensgeschichte als „Zeitleben“ zu fassen, bedeutet für ihn vor allem ein Stück weit eine generationelle Verortung des eigenen Lebens. Generation wird dabei in einer horizontalen und einer vertikalen Perspektive thematisiert: Im horizontalen Zugriff werden die eigenen Sozialisationsbedingungen, Erfahrungen und Erlebnisse auch als altersspezifische Ausprägung, als Teil einer kollektiven Erfahrung und daraus abgeleiteter Gegenwarts- und Zukunftsperspektive verstanden und geschildert. Als basale Erlebnisschicht und besonderes Zeitfenster beschreibt er vor allem Kindheit und Jugendjahre in der Nachkriegszeit. Sie nehmen in der Schilderung der Lebensgeschichte(n) den größten Raum ein. Eng damit verwoben ist auch die Thematisierung von Generation in vertikaler Perspektive: der Familie als zentrale Bezugsgröße der Kindheit. Diese Familie ist eine kleine, dreiköpfige, vaterlose Familie, auch dies eine generationelle Grunderfahrung jener Zeit: Etwa 25 % aller Kinder der Kriegs- und Nachkriegszeit wuchsen in Deutschland ohne Vater auf – Vaterlosigkeit war also ein Massenschicksal in einer Zeit, in der traditionelle Familienkonstellationen – zumal auf dem Land – noch fundamentale Bedeutung hatten. Die Leerstelle des nie gekannten Vaters kann dabei vom Sohn nicht mit Bildern oder Erinnerungen gefüllt werden und bleibt wohl auch gerade deshalb ein lebensbegleitendes Thema.
Der biografisch-historische Erlebnisraum umfasst die alltags- und mentalitätsgeschichtliche Mikrohistorie des dörflichen Lebens in den 1940er und 1950er Jahren, aber auch die Wahrnehmung und Prägung durch die „große“ Geschichte der 1960er Jahre, die als „spannende Jahre“, aber auch als „Angstereignisse“ bezeichnet und erlebt werden. Das zeitgeschichtliche Panorama reicht dabei von der Erinnerung des Elfjährigen an die Entlassung der Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion im Jahr 1955 bis in die späten 1960er Jahre. Sie werden als Zeit des Aufbruchs, als entscheidende Jahre der eigenen politischen Sozialisation sowie als Fundament für die eigene gesellschaftliche Selbstverortung thematisiert. Diese ist getragen von einem hohen Ethos von Verantwortung, gesellschaftlichem und bürgerschaftlichem Engagement. Die durchaus auch von Zufällen geprägte Entscheidung für den Lehrerberuf erscheint dem Leser dabei als konsistenter Weg.
Der biografische Erfahrungsraum, der hier abgeschritten wird, kann ebenfalls ein Stück weit als generationenspezifisch gelesen werden: Er bleibt überschaubar, geht über Mittelfranken nicht hinaus. Erstreckt er sich doch – jenseits von Urlaubserlebnissen – zwischen der Kindheit im Dorf Thalmässing, der Studienzeit in Erlangen und dem Wohn- und Arbeitsort Nürnberg in seiner längsten Ausdehnung auf einer Achse von gerade einmal 75 Kilometern. Vor allem die Kindheitsgeschichte(n) aus Thalmässing, einem Dorf, das 1946 1.680 Einwohner zählte, schildern ein ländliches Milieu, das spätestens seit den 1970er Jahren zu verschwinden beginnt. Der Schriftsteller Godehard Schramm – acht Monate älter als Günther Kraus – hat ebenfalls Thalmässing immer wieder als Ort seiner Kindheit beschrieben, zuletzt im Jahr 2005 in seinem Buch „Mein Königreich war ein Apfelbaum“. Im Unterschied zu Günther Kraus kam er als Fünfjähriger in das Dorf und verließ es auch noch während seiner Schulzeit wieder, doch kreuzten sich auch ihre beiden Leben an diesem Ort. Poetischer Kindheitsroman eines Schriftstellers und lebensgeschichtliche Erinnerung eines Literarturliebhabers – es sind zweifellos zwei ganz unterschiedliche Textsorten. Doch sie kurz hintereinander zu lesen, hat dabei seinen ganz eigenen Reiz. Denn aus beiden Lektüren kann der Leser neben den ganz eigenen, unterschiedlichen biografischen Signaturen doch auch diesem Generationen-Gedächtnis an ein und demselben Ort nachspüren: Beide schildern sich als Fahrschüler an einem Schwabacher Gymnasium mit der „Gredl“, beide wollen nach der Lektüre der Jugendbücher von Erich Kloss Förster werden, und beide erzählen, wie der Gemeindediener mit der Glocke durch die Straßen läuft, um Bekanntmachungen zu vermelden.
Für Goethe, dem Lieblingsschriftsteller des Autors, ist die Verortung des Selbst in der Geschichte das zentrale Paradigma autobiografischen Schreibens. Im Vorwort seiner Autobiografie „Dichtung und Wahrheit“ formulierte er 1811: „Denn dies scheint die Hauptaufgabe der Biographie zu sein, den Menschen in seinen Zeitverhältnissen darzustellen und zu zeigen, inwiefern ihm das Ganze widerstrebt, inwiefern es ihn begünstigt, wie er sich eine Welt- und Menschenansicht darauf gebildet, und wie er sie, wenn er Künstler, Dichter, Schriftsteller ist, wieder nach außen abgespiegelt.“
„Alles hat seine Zeit“ ist nicht das Buch eines Künstlers, Dichters oder Schriftstellers. Es ist eine facettenreiche Schilderung einer persönlichen Lebens- und Erfahrungsgeschichte aus Mittelfranken – ein ruhiger Rückblick ohne Zorn, ohne verklärende Nostalgie oder fränkische Heimattümelei. Zugleich gibt es aufschlussreiche Einblicke in die Prägekräfte einer Lebensgeschichte, in die Genese von zentralen Lebensthemen, in das Gewordensein von Haltungen und Überzeugungen. Nicht zuletzt ist es auch ein Plädoyer für Selbstreflexion. Für mich hält dieses Buch freilich noch eine ganz besondere, private Lesart bereit – die einer ehemaligen Schülerin des Autors.
* Charlotte Bühl-Gramer, geb. Bühl, (* 23. Februar 1963 in Nürnberg) ist promovierte Historikerin, Schriftstellerin, Lexikographin und als Professorin Inhaberin des Lehrstuhls für Didaktik der Geschichte an der Universität Erlangen-Nürnberg. (https://www.nuernbergwiki.de/index.php/Charlotte_Bühl-Gramer)
Der Autor zu seinem Buch:
Wer im Blickpunkt der Öffentlichkeit steht, wer Großartiges vollbracht hat, der hat was zu erzählen. Aber ein Mensch, der eigentlich nie aus seiner Region, dem Frankenland, herausgekommen ist, außer auf Urlaubsreisen, was hat der schon zu berichten? In der Tat: nichts Spektakuläres. Und doch könnte vielleicht gerade in einer Zeit, die schnelllebiger denn je ist und zunehmend der Globalisierung unterworfen ist, ein Lebensbericht aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in einem überschaubaren Raum interessant sein, weil er so typisch für die Nachkriegsgeneration ist: ein Junge aus dem Kleinbürgertum bekommt die Chance, die soziale Leiter ein Stück hochzuklettern, um dann einer der vielen Träger des politischen und gesellschaftlichen Systems, das sich nach dem Krieg gebildet hat, zu werden. Aus dem Kleinbürger wird ein Angehöriger des Mittelstands, der dankbar für die Möglichkeit des Aufstiegs ist, der gerne und bewusst die etablierte Demokratie mitträgt, der aber nicht minder froh darüber ist, dass er einst die studentische Revolte kennen gelernt hat, weil dadurch sein kritisches Bewusstsein geschärft, ja vielleicht geprägt worden ist. Wenn dieser Lebensbericht dazu beiträgt, dass Ältere sagen können: „Ja, so oder so ähnlich war es auch bei mir damals!“ und wenn Jüngeren dadurch die Nachkriegsgeneration, die sie als Eltern oder Großeltern erleben und die so ganz anders ist, ein wenig näher gebracht wird, hat sich die Absicht des Autors erfüllt.
Vorwort
Warum schreibt jemand sein Leben auf?
Der eine, um mitzuteilen, wie es wirklich war. Der andere, um der Flüchtigkeit der Zeit wenigstens ein bisschen zu entgehen.
Beide Gründe haben mich nicht bewogen, die folgenden Seiten niederzuschreiben. Ich bin keine bekannte Persönlichkeit, von der man sich Enthüllungen erwartet, noch kann und will ich damit dem Vergessen weniger rasch entgehen.
Wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hat, ist es natürlich, dass man auf die gelebten Jahre zurückblickt. Vielleicht fürchtet man ja, dass man dies bald nicht mehr tun kann. Bei vielen verklären sich die entfernten Kinder- und Jugendjahre; sie möchten sich diese noch einmal vor Augen halten, um Gebrechen und Beschwerlichkeiten des Alters wenigstens kurzfristig zu verdrängen. Oder man möchte auch so etwas wie eine Bilanz ziehen, Soll und Haben gegenüberstellen, eine Rendite ermitteln. Hat sich dies alles gelohnt?
Ich will weder meine Kinder- und Jugendjahre noch einmal erleben, noch will ich der Gegenwart entfliehen. Ich frage mich ebenso wenig – schon gar nicht in der Öffentlichkeit –, ob sich mein Leben gelohnt hat oder ob es ein Flop war. Meine Absicht ist, manches, das in unserer schnelllebigen Zeit zu vergessen droht, zu bewahren, etwa das mittelfränkische Dorf meiner Kindheit und Jugend, das Leben auf dem Lande mit seinen engen Grenzen, die Nachkriegszeit mit ihrem Wandel von Not zum Wohlstand. Ich möchte auch zu manchen Themen Stellung nehmen, die irgendwie mit mir zu tun haben, die aber vielleicht nicht nur für mich relevant sind.
Natürlich weiß ich, dass mein Sein und Werden nicht außergewöhnlich sind, doch bei meinem Rückblick ist mir aufgefallen, dass sie – aus soziologischer Sicht – typisch, exemplarisch für meine Nachkriegsgeneration sind: Ein Mensch von kleinbürgerlichem Herkommen lebt auf dem Land (in Franken), klettert einige Stufen der sozialen Leiter hinauf, weil die Umstände dafür günstig sind, zeigt durch Beruf und Einstellung die Lebensweise eines Mittelstandsangehörigen, entfernt sich nicht nur räumlich von seiner personalen dörflichen Umwelt, lebt in der Stadt und seine Bodenhaftung ist so stark, dass er seinen Lebensraum nur urlaubsbedingt verlässt. In diesem knappen Lebensabriss können sich gewiss viele, die bei Kriegsende oder kurz nach dem Krieg geboren wurden, wiederfinden. Man sollte nicht nur von Zeitgeist, sondern auch von Zeitleben sprechen!
Der Leser wird also vergeblich nach Anekdoten und Histörchen Ausschau halten; ich denke, Schulgeschichten etc. gibt es genügend. Vielleicht vermögen diese Zeilen auch einem jungen Menschen die Nachkriegsgeneration, die als Eltern oder Großeltern erlebt wird, etwas näher zu bringen, beizutragen zum Verständnis, warum sie so ist, wie sie geworden ist.