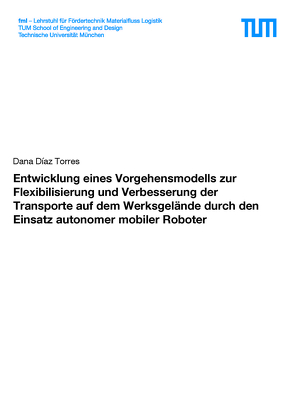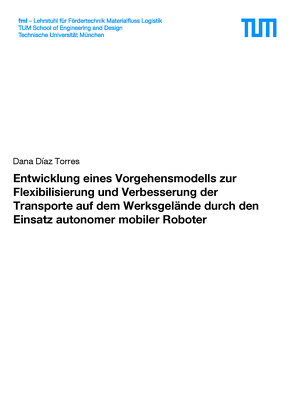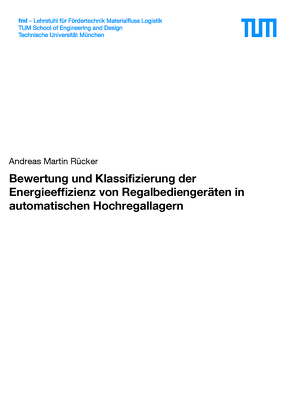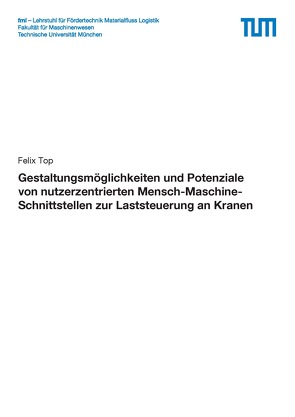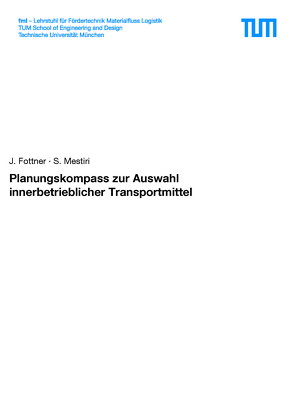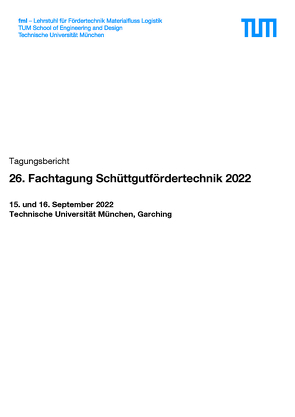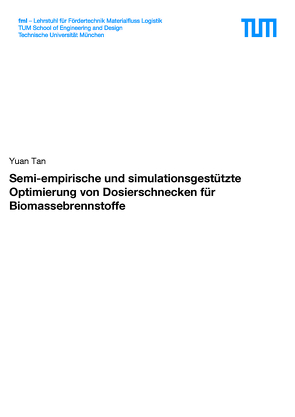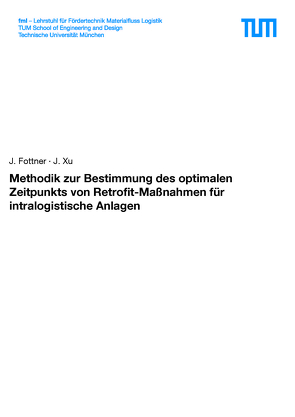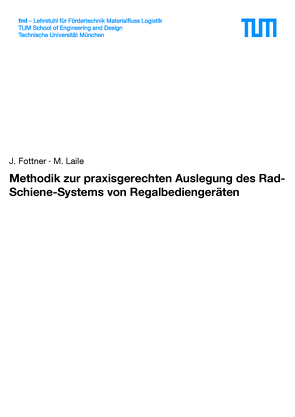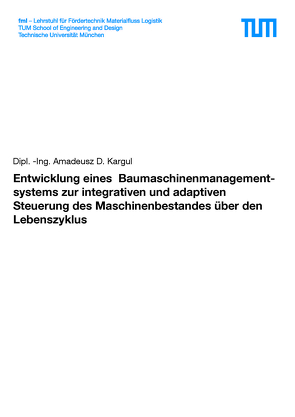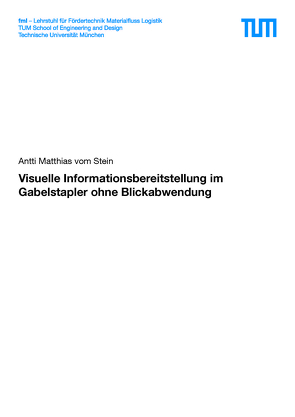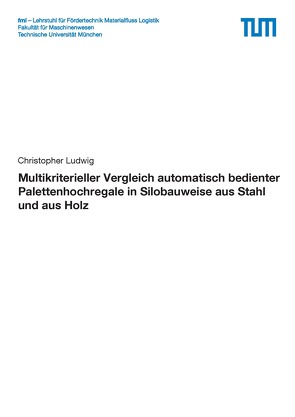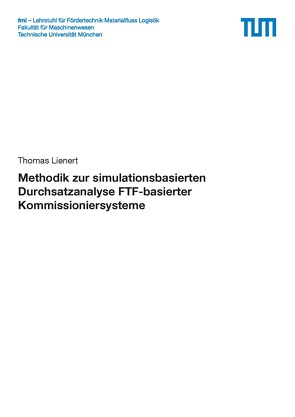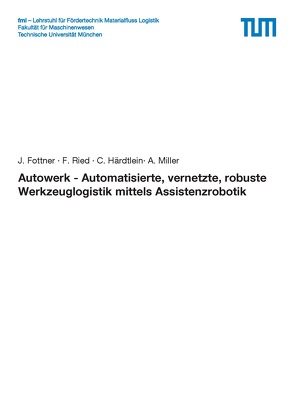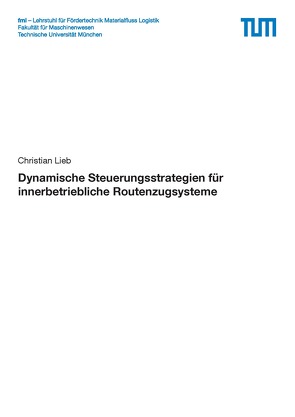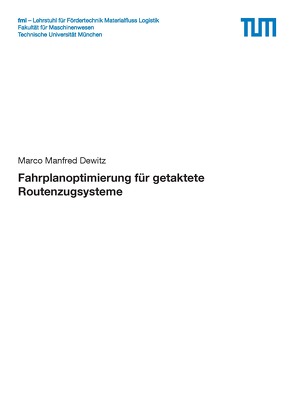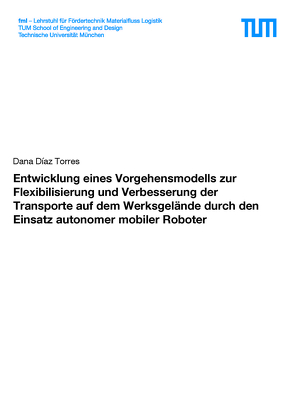
Autonome mobile Roboter für den Waren- und Materialtransport in der Intralogistik bieten das Potenzial – neben der selbständigen Ausführung des Transports – auch Entscheidungen in einem vorgegebenen Entscheidungskontext eigenständig zu treffen. Dadurch können komplexe Logistikaufgaben vom Roboter übernommen werden. Die Implementierung solch vielseitiger Systeme, welche zum einen höhere Autonomiestufen als konventionelle fahrerlose Transportsysteme aufweisen und zum anderen nicht nur innerhalb, sondern auch außerhalb der Gebäude auf einem Werksgelände fahren, stellt aktuell eine Planungsherausforderung dar. Die fehlende Expertise im Hinblick auf technische, organisatorische und prozessuale Aspekte autonomer mobiler Roboter im Outdoor-Bereich ist hier besonders hervorzuheben. Zwar können Erkenntnisse selbstfahrender Kraftfahrzeuge und autonomer mobiler Anwendungen im Indoor-Bereich teilweise übernommen werden, allerdings sind die Anforderungen nicht eins zu eins auf ein Werksgelände übertragbar, vor allem auch in Bezug auf rechtliche, geografische und sicherheitstechnische Anforderungen.
In der vorliegenden Forschungsarbeit wurde daher ein Vorgehensmodell für die Implementierung autonomer mobiler Roboter auf dem Werksgelände entwickelt. Den Kern des Vorgehensmodells bildet die Entwurfsmethode Axiomatic Design, welche die strukturierte Suche und Zuordnung geeigneter Lösungen für zuvor festgelegte Anforderungen beinhaltet. Nach den Grundlagen und der Diskussion bestehender Modelle und Methoden für das Vorgehen sind im Rahmen der Konzeption zunächst Kundenanforderungen, welche auf qualitativen Interviews, einer Prozessanalyse und dem aktuellen Stand der Wissenschaft basieren, generiert worden. Anhand der systematischen Suche und Zuordnung sowie der Ergänzung um Metriken liefert Axiomatic Design einen auf Kundenanforderungen basierenden Gestaltungsentwurf. Im Zuge einer demonstratorischen Umsetzung bei einem Automobilhersteller wurde dieser Entwurf in konkrete Gestaltungsrichtlinien überführt. Diese Gestaltungsrichtlinien wiederum bieten Anwendern und Herstellern eine fundierte Planungsgrundlage und -unterstützung bei der Einführung autonomer mobiler Roboter auf dem Werksgelände.
Aktualisiert: 2023-05-25
> findR *
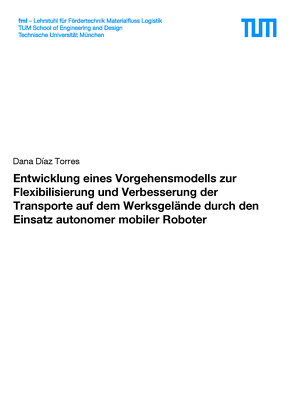
Autonome mobile Roboter für den Waren- und Materialtransport in der Intralogistik bieten das Potenzial – neben der selbständigen Ausführung des Transports – auch Entscheidungen in einem vorgegebenen Entscheidungskontext eigenständig zu treffen. Dadurch können komplexe Logistikaufgaben vom Roboter übernommen werden. Die Implementierung solch vielseitiger Systeme, welche zum einen höhere Autonomiestufen als konventionelle fahrerlose Transportsysteme aufweisen und zum anderen nicht nur innerhalb, sondern auch außerhalb der Gebäude auf einem Werksgelände fahren, stellt aktuell eine Planungsherausforderung dar. Die fehlende Expertise im Hinblick auf technische, organisatorische und prozessuale Aspekte autonomer mobiler Roboter im Outdoor-Bereich ist hier besonders hervorzuheben. Zwar können Erkenntnisse selbstfahrender Kraftfahrzeuge und autonomer mobiler Anwendungen im Indoor-Bereich teilweise übernommen werden, allerdings sind die Anforderungen nicht eins zu eins auf ein Werksgelände übertragbar, vor allem auch in Bezug auf rechtliche, geografische und sicherheitstechnische Anforderungen.
In der vorliegenden Forschungsarbeit wurde daher ein Vorgehensmodell für die Implementierung autonomer mobiler Roboter auf dem Werksgelände entwickelt. Den Kern des Vorgehensmodells bildet die Entwurfsmethode Axiomatic Design, welche die strukturierte Suche und Zuordnung geeigneter Lösungen für zuvor festgelegte Anforderungen beinhaltet. Nach den Grundlagen und der Diskussion bestehender Modelle und Methoden für das Vorgehen sind im Rahmen der Konzeption zunächst Kundenanforderungen, welche auf qualitativen Interviews, einer Prozessanalyse und dem aktuellen Stand der Wissenschaft basieren, generiert worden. Anhand der systematischen Suche und Zuordnung sowie der Ergänzung um Metriken liefert Axiomatic Design einen auf Kundenanforderungen basierenden Gestaltungsentwurf. Im Zuge einer demonstratorischen Umsetzung bei einem Automobilhersteller wurde dieser Entwurf in konkrete Gestaltungsrichtlinien überführt. Diese Gestaltungsrichtlinien wiederum bieten Anwendern und Herstellern eine fundierte Planungsgrundlage und -unterstützung bei der Einführung autonomer mobiler Roboter auf dem Werksgelände.
Aktualisiert: 2023-03-30
> findR *

Die zunehmende Digitalisierung von Arbeitsprozessen ermöglicht es Unternehmen, große Datenmengen über ihre Prozesse zu sammeln. Die KI-basierte Analyse dieser Daten verspricht jedoch nicht nur Effizienzsteigerungen und Prozessoptimierungen, sondern ermöglicht es den Arbeitgebern auch, das Verhalten und die Produktivität der einzelnen Mitarbeiter im Detail zu beurteilen.
Die Verwendung von KI in industriellen Prozessen (und in anderen Arbeitsumgebungen) wirft somit die Sorge einer starken Zunahme der Kontrolle durch den Arbeitgeber auf, wodurch die Macht der Arbeiter und Angestellten innerhalb des Unternehmens und in der Gesellschaft untergraben wird. Dies verstärkt ethische Bedenken hinsichtlich des Verlusts der Autonomie am Arbeitsplatz. Zu den möglichen Folgen gehören die Verringerung der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, da eine ständige Überwachung das Stressniveau erhöht, sowie das Risiko, dass eine übermäßige Transparenz der Arbeitsleistung einen Arbeitnehmer direkt oder indirekt unter Druck setzen könnte. Gewerkschaften, Wissenschaft und verschiedene andere Beobachter weisen darauf hin, dass diese ethischen Bedenken weitgehend auf ein Schlüsselelement der (tatsächlichen oder erwarteten) Nutzung der KI zurückgeführt werden können: Sie soll feststellen, wie sich die Mitarbeiter anpassen müssen, um die Prozessleistung zu verbessern.
Das Ziel des A Human Preference Aware Optimization System (HPAO) Forschungsprojekt war es, Wege aufzuzeigen, KI ethisch sinnvoll zu nutzen und den Mitarbeiter wieder in den Mittelpunkt der Prozessgestaltung zu rücken. Das von uns prototypisch entwickelte und in Pilotversuchen getestete System für die algorithmische Schichtplanung fördert das Wohlergehen und die Autonomie der Mitarbeiter*innen durch die Berücksichtigung von Bedürfnissen und Präferenzen bei der Zuweisung zu Schichten und Aufgaben. Die Wertschätzung der individuellen Stärken und Präferenzen verspricht zudem, die Motivation der Mitarbeiter*innen bei der Arbeit an den von ihnen bevorzugten Aufgaben zu steigern.
Darüber hinaus können KI-basierte Bedenken reduziert werden, da die Mitarbeiter von den Ergebnissen der KI profitieren. Das System verwendet die Datenanalyse mit dem Ziel, die Prozesse durch die Zuweisung von Aufgaben zu optimieren, die Mitarbeiter bevorzugen, anstatt den Arbeitsablauf der Mitarbeiter entsprechend dem Prozess anzupassen.
Das resultierende und hier vorliegende Handbuch soll Firmen, Arbeitnehmer, Betriebsräte und KI-Entwickler unterstützen, indem es aufzeigt, wie man auf Prozessmetriken zugreifen kann, welche Arten von KI für die Prozesse geeignet sind und mit welchen Herausforderungen die Entwickler konfrontiert sein werden. Zusätzlich präsentiert das Handbuch die Ergebnisse des Forschungsprojektes, ordnet die Erkenntnisse ein und gibt einen Ausblick in die Zukunft.
Aktualisiert: 2023-04-13
> findR *
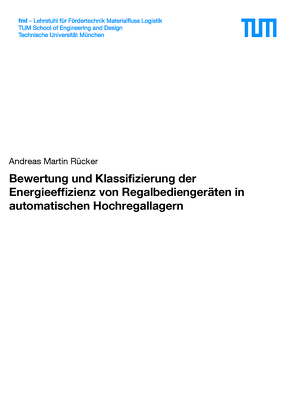
Im Rahmen dieser Dissertation wird eine Problemstellung aus dem Spannungsfeld der modernen Intralogistik behandelt. Die Energieeffizienz spielt im Rahmen der Herausforderungen, denen moderne Intralogistiksysteme ausgesetzt sind, eine wichtige Rolle. Verschiedene Einflussfaktoren begünstigen die Entwicklung von immer energieeffizienteren Geräten. Dabei spielen sowohl die gesetzlichen Rahmenbedingungen als auch die Forderungen von Kunden eine Rolle.
Die Arbeit befasst sich mit der Bewertung und der Klassifizierung von Regalbediengeräten in automatischen Hochregallagern. Automatische Hochregallager finden sich oft in Produktionsbetrieben und Logistikzentren. Sie dienen der Speicherung von Lagergütern. Von außen erkennt man Gebäude, die Hochregallager beinhalten, meist an ihrem rechteckigen Grundriss, der großen Höhe (bis über 40 m) und der meist fensterlosen Fassade. Ein Hochregallager besteht aus einer Anzahl von Regalzeilen mit vielen einzelnen Lagerplätzen für Kleinteilebehälter, Tablare, Paletten oder weitere Ladungsträger. Automatische Hochregallager werden mit Regalbediengeräten oder Sattelitenfahrzeugsystemen betrieben. Diese Arbeit beschränkt sich auf die Betrachtung von Regalbediengeräten für Kleinladungsträger oder Paletten und untersucht deren Energiebedarf und Durchsatz. Die Ergebnisse sind zum Teil auch auf Geräte für andere Ladungsträger übertragbar. Im Rahmen von Messungen wurden vier verschiedene Regalbediengeräte untersucht. Mithilfe der gewonnenen Erkenntnisse wurde ein Simulationsmodell zur Untersuchung eines breiten Gerätebereichs implementiert. Auf Basis von Simulationsstudien wurde eine Bewertung und eine Klassifizierung der Energieeffizienz entwickelt.
Die Arbeit stellt einen ersten Versuch zur Bewertung von Geräten innerhalb der Intralogistik auf Basis der Gesamtheit ihrer physikalischen Eigenschaften dar. Am Beispiel eines Regalbediengeräts wird eine mögliche Umsetzung und die Verwendung einer solchen Bewertung gezeigt. Eine Bewertung stellt die Grundlage für die Einführung von Verbesserungen dar. Eine initiale Bewertung deckt Verbesserungspotenziale auf. Diese Potenziale können anschließend gezielt ausgeschöpft und die Verbesserungen im Nachgang evaluiert werden. Die Arbeit zeigt darüber hinaus mögliche Einsparpotenziale, die im Rahmen der Untersuchungen festgestellt wurden, auf.
Aktualisiert: 2023-01-31
> findR *
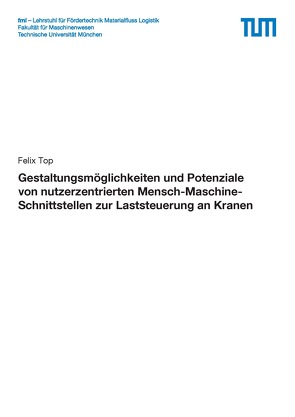
Ziel dieser Arbeit ist es, einen Gestaltungsrahmen zur Entwicklung nutzerzentrierter Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMIs) zur Laststeuerung an Kranen zu entwickeln. Es wird gezeigt, dass die Berücksichtigung eines systematischen Designansatzes eine erhöhte Gebrauchstauglichkeit der HMIs sowie eine verringerte mentale Beanspruchung beim Bediener erwarten lässt, was in erhöhter Intuitivität im Vergleich zum etablierten maschinenzentrierten HMI resultiert. Der entwickelte Gestaltungsrahmen bietet erstmals eine systematische Grundlage zur Ableitung nutzerzentrierter HMIs und kann bereits während des Entwicklungsprozesses zum Konzeptvergleich herangezogen werden.
Mit Hilfe des Gestaltungsrahmens können zwei nutzerzentrierte Steuerungskonzepte abgeleitet werden: das richtungsorientierte und das zielorientierte Steuerungskonzept. Es wird gezeigt, dass bei beiden Konzepten positive Einflüsse auf die Gebrauchstauglichkeit, mentale Beanspruchung und Intuitivität erwartet werden können. In einer Laborstudie (48 Probanden ohne Vorerfahrung) werden die beiden Steuerungskonzepte mit dem maschinenzentrierten HMI verglichen. Sowohl die Effekte auf die mentale Beanspruchung als auch auf die Gebrauchstauglichkeit belegen den positiven Einfluss der nutzerzentrierten Konzepte und die höhere Intuitivität.
Zur weiteren Untersuchung werden beide Steuerungskonzepte in je zwei Ausprägungen (insgesamt vier HMIs) an einem Ladekran mit vier Freiheitsgraden und Auslegerspitzensteuerung umgesetzt. Bei den zielorientierten HMIs erfolgt die Vorgabe des Zielpunkts entweder in Form eines Lichtpunkts, der mit einer 3D-Kamera erfasst wird, oder über Holografien mit Hilfe der AR-Brille Microsoft Hololens. Beide zielorientierten HMIs sind funktionsfähig, weisen jedoch technische Limitationen auf. Bei den richtungsorientierten HMIs erfolgt die Eingabe der gewünschten Bewegungsrichtung des Hakens entweder über Joysticks auf einer Funksteuerung oder über Wischbewegungen auf einem Tablet, so dass die Hakenbewegung immer parallel zur Eingabe ist. Das Proof of Concept wird für alle HMIs erbracht. In der Evaluationsstudie (56 Probanden in zwei Bedienergruppen) werden die richtungsorientierten HMIs mit dem maschinenzentrierten HMI verglichen. Es zeigt sich, dass sowohl Novizen als auch Experten von den richtungsorientierten HMIs profitieren, auch wenn die Effekte bei den Novizen stärker ausfallen. Dies liefert weitere Belege für die Validität des Gestaltungsrahmens und stützt gleichzeitig die Erwartung, dass die richtungsorientierten HMIs zu einer höheren Intuitivität führen.
Das Ziel, einen Beitrag zur Entwicklung, Implementierung und Evaluation von nutzerzentrierten HMIs zur Laststeuerung an Kranen zu leisten, wurde erreicht. Weitere Untersuchungen, vor allem zur Weiterentwicklung des zielorientierten Steuerungskonzepts, werden empfohlen.
Aktualisiert: 2022-12-08
> findR *

Automatisierte Förderanlagen nehmen in der Intralogistik eine wichtige Rolle ein. Mit
einer vergleichsweise hohen Lebensdauer der Mechanik werden sie im Laufe ihres
Lebenszyklus immer wieder an veränderte Gegebenheiten adaptiert, modernisiert,
mithilfe neuer Erkenntnisse optimiert oder aufgrund gesteigerten Bedarfs erweitert. Um
diese Änderungen an bestehenden Anlagen effizient und mit einer hohen Qualität
durchzuführen, können die Anpassungen an digitalen Modellen vorab getestet werden.
Zur Erstellung der Modelle fehlen jedoch insbesondere bei bestehenden Anlagen
oftmals aktuelle Daten, welche daher mit einem hohen manuellen Aufwand erfasst
werden müssen. Dies führt dazu, dass der Einsatz von Modellen häufig aus
wirtschaftlichen Gründen abgelehnt und stattdessen mögliche Probleme bei den
Änderungen in Kauf genommen werden. Vor diesem Hintergrund war es das Ziel des
Projektes, einen Beitrag zu einer aufwandsarmen Erfassung von Daten aus
bestehenden Förderanlagen zu leisten. Es sollte ein Konzept entwickelt werden,
welches Daten automatisiert erfasst und so aufbereitet, dass sie für eine
Modellerstellung eingesetzt werden können.
Daher wurde im Projekt ausgehend von der Analyse des aktuellen Stands der
Wissenschaft und Technik im Bereich von Förderanlagen sowie deren
Modellerstellung iterativ ein dreistufiges Verfahren zur Extraktion und Verarbeitung von
Daten aus bestehenden Förderanlagen erarbeitet. Die erste Stufe, die
Datenaufnahme, basiert auf dem Konzept eines intelligenten Förderguts, welches
ausgestattet mit Messsensorik, Daten seiner Umgebung in Form von Kamerabildern,
Beschleunigungen und Drehraten sowie der Lichtintensität während der Überfahrt über
eine Förderanlage aufnimmt. Diese Daten werden in der zweiten Stufe, der
Dateninterpretation, in verschiedenen Modulen zu zeitstempelbasierten Bewegungsund
Umgebungsdaten umgewandelt. In der dritten Stufe entstehen daraus durch das
Verfahren der Rekonstruktion Modellierungsdaten, welche Aufschluss über das
Layout, die Geometrie sowie weitere Zusatzattribute der zu analysierenden
Förderanlage geben. Basierend auf diesen Teilkonzepten wurde das intelligente
Fördergut als Behälter für drei verschiedene Kleinladungsträgergrößen
demonstratorisch umgesetzt. Zudem wurden Module der Dateninterpretation und der
Rekonstruktion implementiert, um die entstandenen Teilkonzepte für Referenz-
Anlagenkonfigurationen zu testen und zu bewerten.
Aktualisiert: 2022-11-17
> findR *
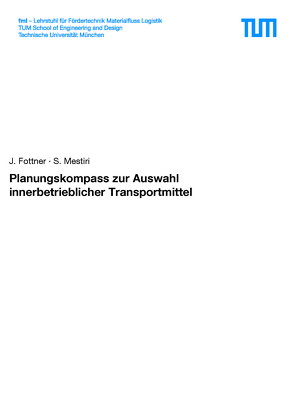
Innerbetriebliche Transportsysteme sind integraler Bestandteil logistischer Netzwerke und ein Erfolgsfaktor im Umgang mit den Herausforderungen, denen sich die Logistik heute gegenübersieht: In einem dynamischen Umfeld wirtschaftlicher,
sozialer und politischer Randbedingungen muss die Logistik performant, zuverlässig und mit hoher Qualität funktionieren, während zugleich Flexibilität und der Umgang mit Komplexität verlangt werden. Zudem hängt der wirtschaftliche Erfolg eines Unternehmens davon ab, wie schnell, reibungslos und kostengünstig Materialien durch Produktion und Lager fließen. Den innerbetrieblichen Transportsystemen kommt somit eine entscheidende Rolle für den reibungslosen Produktionsablauf zu.
Durch die unterschiedlichen Aspekte, die bei den Transportmitteltypen jeweils im Fokus stehen, unterscheiden sich zugehörige Planungsansätze in Methodik und zu Grunde liegenden Annahmen. Ein darauf basierender Vergleich verschiedener Transportsysteme ist daher ungenau und mit dem Risiko behaftet, eine suboptimale, unter Umständen nicht anforderungsgerechte Lösung zu wählen. Zudem ist die gleichzeitige Anwendung verschiedener Ansätze fehleranfällig, zeitaufwändig und erfordert Expertenwissen.
Im Forschungsprojekt PlaKAT wird daher ein ganzheitlicher Ansatz für die vergleichende Dimensionierung und Bewertung von Transportsystemen entwickelt. Dieser Ansatz unterstützt den Planern, eine möglichst optimale Lösung unter Berücksichtigung vorgegebener Randbedingungen zu ermitteln. Der Planungsansatz stützt hierzu auf ein generisches Simulationsmodell, wodurch ein Leistungsnachweis des Transportsystems gegeben werden kann, in dem auch dynamische Einflüsse berücksichtigt werden. Die Anwendung des Planungsansatzes ermöglicht somit die Erstellung sinnvoller Systemkonfigurationen bereits in den früheren Phasen der Planung.
Aktualisiert: 2022-12-08
> findR *
Energieeffizienz und Nachhaltigkeit, Erfahrungsberichte von Schüttgutfördertechnikexperten beim Betrieb von Anlagen oder die neuesten Forschungsergebnisse aus der Schüttgutfördertechnik. Dies sind einige der Themen, die die Referenten der 26. Fachtagung Schüttgutfördertechnik von 15. bis 16. September 2022 an der Technischen Universität München vorstellen. Im begleitenden Tagungsband stellen die Autoren ihre Themen in umfänglich vor.
Aktualisiert: 2022-11-03
> findR *
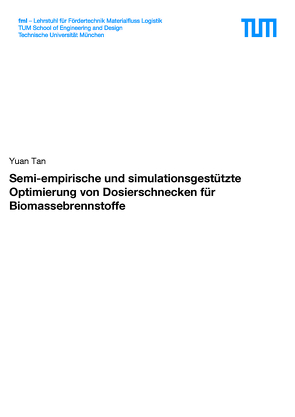
Als einer der ältesten Stetigförderer wird der Schneckenförderer zwar am häufigsten für das Fördersystem von Biomassevergasern genutzt, jedoch ergeben sich Herausforderungen für den Markt infolge der Zunahme an verfügbaren Biomassearten und der Erweiterungen der Einsatzmöglichkeiten. Aus diesem Grund ist mit weiteren Innovationen auf diesem Gebiet zu rechnen. Hierbei besteht Forschungsbedarf im Hinblick auf einen brennstoffflexiblen Förderer, der eine luftarme Zufuhr von Biomasse zur Verhinderung des Rückflusses der Falschluft erlaubt. Ein solcher Förderer wird bisher nur in einer begrenzten Anzahl an Studien berücksichtigt und es ist bislang keinem Hersteller gelungen, ihn zur Verfügung zu stellen. Daher zielt das EU-Projekt ‚FlexiFuel‘ auf diese Art des Förderers ab.
Da eine zuverlässige analytische Beschreibung eines vollständig gefüllten Schneckenförderers nicht möglich ist, wird im Rahmen dieser Arbeit eine luftarme Dosierschnecke semiempirisch ausgelegt und dimensioniert. Grundlage dafür ist eine auf deutsche Normen (hpts. VDI 2330) basierende und in der Fachwelt anerkannte analytische Vorgehensweise, mit der die zur Förderung bei hohem Füllstand nötige Antriebsleistung annähernd geschätzt werden kann. Weiterhin werden die Datensätze, die zur Auslegung der zielorientierten Dosierschnecke und zur Vorhersage der potenziellen Problematiken erforderlich sind, durch empirische Forschungen am Referenzförderer und drei modifizierten Prototypen erhoben. Zur Charakterisierung der Förderung der gewählten Biomasse werden drei Eingangsgrößen – der Volumenstrom am Einlass, die Schneckenneigung und die Schneckendrehzahl – für jeden durchgeführten Versuch variiert. Die entsprechenden Auswirkungen auf die beiden Hauptzielgrößen ‚Ausgangsvolumenstrom‘ und ‚Antriebsmoment‘ werden anschließend mit statistischen Methoden deskriptiv dargestellt. Zur Ergänzung der Labortests bieten sich zudem Discrete-Element-Method/Computational-Fluid-Dynamics Simulationen des virtuellen Prototyps an, mit dem der dichte Füllstand der Biomasse im Schneckentrog validiert werden kann. Mit dem quantitativen Vergleich der Porosität unter variierten Betriebspunkten werden der potenzielle Rückfluss aus dem Vergaser und die Möglichkeit einer Falschluftzufuhr bei der Dosierung der Biomasse ausgewertet.
Schließlich wird aufbauend darauf der finale Prototyp für das EU-Projekt entwickelt, der sich für eine luftarme Dosierung von acht oft genutzten Biomassebrennstoffen eignet und dessen Anwendung den Bedarf am Biomassevergaser europaweit abdecken kann.
Aktualisiert: 2022-12-15
> findR *
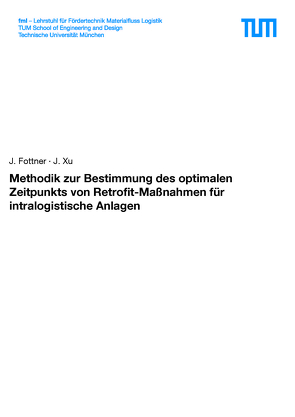
Regalbediengeräte werden für die automatische Ein- und Auslagerung unterschiedlicher Güter sowohl in Hochregallagern als auch in automatischen Kleinteilelagern eingesetzt und spielen daher für die Automatisierung der Intralogistik eine große Rolle. Diese Intralogistiksysteme sind mit hohen Investitionskosten verbunden, weshalb Anlagenbetreiber daran interessiert sind, eine möglichst lange Nutzungsdauer bei niedrigen Betriebskosten zu erzielen. Trotz regelmäßiger Instandhaltungsmaßnahmen sind nach einiger Zeit größere Retrofits notwendig, da beispielsweise die Verfügbarkeit von Ersatzteilen oder qualifiziertem Service-Personal für bestimmte Komponenten nicht mehr gegeben ist. Anlagenbetreiber fehlt häufig die Erfahrung zur Einschätzung der vielen Einflussgrößen, die bei einer Dringlichkeitsbewertung eines Retrofits zu berücksichtigen sind. Gleichermaßen sind die positiven Effekte durch Modernisierungen nicht explizit sichtbar. Aus diesem Grund wirken die hohen Kosten für Retrofits oft abschreckend, weshalb wichtige Modernisierungen in der industriellen Praxis allgemein zu spät initiiert werden. In Folge führt dies zu überalterten Anlagen mit steigenden Betriebskosten sowie größeren Ausfallrisiken. Diese Faktoren reduzieren die Wirtschaftlichkeit der Anlage, was für insbesondere kleinere Unternehmen finanzielle Schwierigkeiten bedeuten kann. Vor diesem Hintergrund war es das Ziel des Projekts OptiFit – Methodik zur Bestimmung des optimalen Zeitpunkts für Retrofit-Maßnahmen für intralogistische Anlagen die Rahmenbedingungen für Retrofit-Prozesse zu optimieren und insbesondere Anlagenbetreiber zu befähigen, zukünftige Modernisierungen rechtzeitig anstoßen zu können. Letzteren sollte grundlegendes Wissen vermittelt werden, um dem Erfahrungs- bzw. Wissensdefizit bezüglich Retrofits entgegenzuwirken sowie die Sensibilisierung für Aufwand und Nutzen von Modernisierungen zu erhöhen.
Daher wurde im Rahmen des Projektes zunächst der aktuelle IST-Stand von Modernisierungsprojekte für Regalbediengeräte mittels Expertengespräche analysiert, um häufige Herausforderungen und Hürden in der Praxis für Anlagenbetreiber und Retrofit-Anbieter zu identifizieren. In einem weiteren Schritt erfolgte die Erarbeitung der für Retrofit relevanten Wissensinhalte im intensiven Austausch mit Retrofit-Experten. Die Gesamtheit der Inhalte wurde in unterschiedliche Themenblöcke unterteilt und anschließend in die Form eines Leitfadens überführt. Zum Schluss wurden die Inhalte des Retrofit-Leitfadens von Experten und potenziellen Anwendern hinsichtlich Neutralität, Verständlichkeit und Anwendungsorientierung evaluiert.
Aktualisiert: 2022-09-08
> findR *
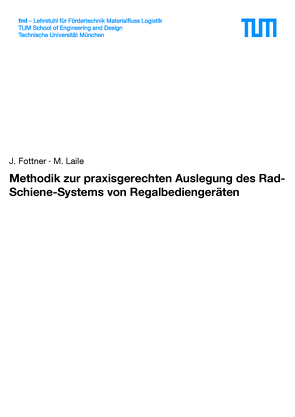
Für die Auslegung des Rad-Schiene-Systems von Regalbediengeräten kommen hauptsächlich Normen und Richtlinien, die das Rad-Schiene-System von Kranen adressieren, zum Einsatz. Zu nennen sind hier die inzwischen zurückgezogene DIN 15070 und die FEM 1.001. Die Auslegung nach diesen beiden Methoden führt aus einer Reihe von Gründen zu ungenauen Ergebnissen. Diese sind insbesondere die Verwendung eines ungenauen Lastkollektivs, welches lediglich die maximalen und minimalen Kontaktkräfte berücksichtigt, sowie die Nichtberücksichtigung der Gesamtzahl der Rollkontakte über die Auslegungslebensdauer. Diese methodischen Schwächen werden von der DIN EN 13001-3-3 aufgegriffen. Daher ist zu erwarten, dass diese zu einer genaueren Auslegung des Rad-Schiene-Systems führt. Das darin verwendete Lastkollektiv sowie die Gesamtzahl der Rollkontakte sind zum Auslegungszeitpunkt bei Regalbediengeräten allerdings nur schwer abschätzbar.
Vor diesem Hintergrund war das Ziel des Forschungsprojekts MARS die Entwicklung einer Auslegungsmethode, welche die einfache Anwendbarkeit der DIN 15070 bzw. der FEM 1.001 mit der genauen Berechnung nach DIN EN 13001-3-3 vereint. Insbesondere sollten Modelle entwickelt werden, welche in der Lage sind, basierend auf zum Auslegungszeitpunkt bekannten RBG- und Lagerparametern die Lastkollektive sowie die Gesamtzahl der Rollkontakte vorherzusagen. Diese Vorhersagemodelle sollten gemeinsam mit dem Berechnungsvorgehen nach DIN EN 13001-3-3 in einen Softwaredemonstrator implementiert werden. Zum Abschluss sollte die so entwickelte Auslegungsmethode getestet und mit der bisherigen Auslegung nach DIN 15070 und FEM 1.001 verglichen werden.
Daher wurde im Rahmen des hier beschriebenen Forschungsprojekts zunächst ein Simulationsmodell zur Berechnung dieser beiden Auslegungsgrößen erstellt. Dieses nutzt in Zusammenarbeit mit dem projektbegleitenden Ausschuss ausgewählte Eingangsgrößen zur Berechnung der beiden Zielgrößen. Das erstelle Simulationsmodell wurde im Anschluss zur Generierung von Datensätzen genutzt. Dabei wurden die Eingangsgrößen mithilfe von Methoden der statistischen Versuchsplanung so kombiniert, dass eine maximale Informationsdichte erreicht wurde. Die generierten Datensätze wurden zum Training und zum Test von Vorhersagemodellen für die beiden Zielgrößen genutzt. Im Anschluss wurde ein Softwaredemonstrator erstellt, welcher die Vorhersagemodelle mit den Berechnungen der DIN EN 13001-3-3 verbindet. Zum Abschluss fand ein Test der neu entwickelten Auslegungsmethode und ein Vergleich mit den bisher verwendeten Methoden statt.
Aktualisiert: 2022-05-19
> findR *

Der Einsatz von neuen Technologien und die Digitalisierung prägen die industrielle Produktion.
Bei der Vernetzung von Objekten, Menschen und Maschinen wird dabei von der vierten
industriellen Revolution, der Industrie 4.0, gesprochen. Technologien wie Robotik, Augmented
Reality, Big Data, Künstliche Intelligenz und Internet der Dinge tragen dazu bei, den Umbruch
zur Industrie 4.0 voranzutreiben. Diese technologischen Entwicklungen ziehen Auswirkungen
auf Arbeitsinhalte, -aufgaben und -prozesse mit sich. Speziell im Bereich der Automobillogistik
werden im Zuge von Industrie 4.0 weitreichende Veränderungen erwartet. Der Mensch und
seine Kompetenzen sind für die erfolgreiche Implementierung der neuen Technologien im Unternehmen
von großer Relevanz. Allerdings ist zu erwarten, dass die körperlich belastenden
Routineaufgaben abnehmen werden, während die Aufgaben des Menschen sich hin zu neuen
Tätigkeitsfeldern im Bereich der Planung und Kontrolle verschieben. Dabei ist unklar, wie die
Digitalisierung und Automatisierung die erforderlichen Kompetenzen in der Logistik verändern
werden. Getrieben durch den Wettbewerbsdruck und den demographischen Wandel besteht
für die Unternehmen Handlungsbedarf, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und
Qualifikationsbedarfe frühzeitig zu ermitteln.
Die Literatur befasst sich bereits mit möglichen Veränderungen und prognostiziert künftig notwendige
Kompetenzen. In diesem Zusammenhang stellt sich weiterführend die Frage, inwiefern
der Wandel Unternehmen veranlasst, sich mit Qualifizierungsstrategien und -maßnahmen
zu beschäftigen:
Welche Einflüsse haben neue Technologien auf die Logistik und welcher Wandel ergibt sich
bezüglich der notwendigen Kompetenzen?
Aus diesem Grund erfolgt in dieser Studie eine Untersuchung von Kompetenzmanagement in
den Unternehmen. Zudem soll überprüft werden, wie stark die Veränderungen eingeschätzt
werden und ob eine systematische Ermittlung von Kompetenzen für die Digitalisierung und
Automatisierung in der Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie notwendig ist. Dafür beleuchtet
der erste Teil der Studie den Einsatz von Kompetenzmanagement im betrieblichen Kontext.
Der zweite Teil konzentriert sich auf die maßgeblichen Technologien der Digitalisierung und
Automatisierung und untersucht deren Verwendung sowie Auswirkungen auf die Kompetenzanforderungen.
Der dritte Teil befasst sich mit der Digitalisierung und Automatisierung bei den
Unternehmen und einem entsprechenden Kompetenzmanagement. Abschließend werden
die Ergebnisse aus der Studie zusammengefasst und zukünftiger Forschungs- und Untersuchungsbedarf
abgeleitet.
Aktualisiert: 2022-08-04
> findR *
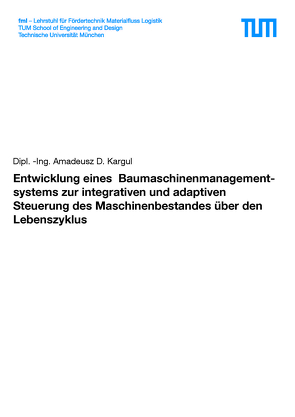
Maschinenbetreiber nutzen für die organisatorische Steuerung des Maschinenbestandes verschiedene analoge als auch digitale Werkzeuge. Dadurch entstehen Funktions- und Informationsbrüche, die die Aufgaben des Betreibers erschweren, da relevante Informationen aus verschiedenen Anwendungen manuell verknüpft werden, um eine ganzheitliche Betrachtung einer Baumaschine als auch des gesamten Bestandes zu erhalten. Diese Informationssilos erschweren weiter die Entwicklung von datengestützten Ansätzen, die eine ganzheitliche Steuerung des Maschinenbestandes unterstützen.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird ein Baumaschinenmanagement zur integrativen und adaptiven Steuerung des Maschinenbestandes über deren Lebenszyklus entwickelt. Das Ergebnis ist ein System, dass die maschinenspezifischen Handlungsfelder in Bezug auf die Maschinenverwaltung, die -einsatzplanung, den -betrieb, sowie das -controlling mithilfe
von informations- und steuerungsbasierten Funktionen integrativ vereint. Adaptiv bedeutet in diesem Kontext, dass Lernverfahren sich an die bereitgestellten Maschinen- und Auftragsinformationen im Rahmen einer Modellbildung anpassen und Maschinenbetreibern einen funktionellen Mehrwert generieren. Dadurch entstehen adaptive Funktionen, die mithilfe von modellgestützten Verfahren die organisatorische Steuerung des Maschinenbestandes durch eine erweiterte Diagnostik unterstützen sowie durch datengestützte Entscheidungsgrundlagen erweitern. Der adaptive Ansatz stellt eine logische Weiterentwicklung eines integrativen Baumaschinenmanagements dar, da die ganzheitliche Betrachtung von Baumaschinen die Entwicklung von modellgestützten Verfahren für den Maschinenbetreiber wesentlich erleichtert.
Aktualisiert: 2022-09-01
> findR *
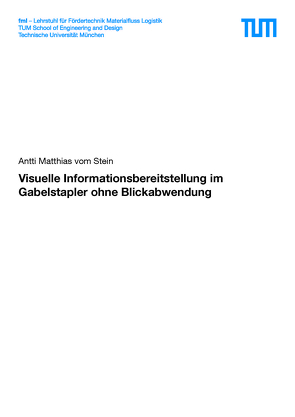
In der vorliegenden Arbeit wird am Beispiel des Gegengewichtstaplers untersucht, wie der Betrieb von manuell bedienten Flurförderzeugen mittels neuer Konzepte in der Mensch-Maschine-Schnittstelle optimiert werden kann. Dies soll durch zwei Arten der visuellen Informationsbereitstellung realisiert werden, die keine oder nur eine geringe Blickabwendung von den primären Tätigkeiten Lasthandling und Lasttransport erfordern. Die Ausgangsbasis dazu bildet die Grundlagenforschung zur visuellen Wahrnehmung, die besagt, dass der Mensch über zwei Sehtypen im visuellen System verfügt. Neben dem fovealen Sehen, welches uns als das scharfe Sehen bewusst wird, gibt es das periphere Sehen, über das wir die Umgebung wahrnehmen. Die Arbeit verfolgt den Ansatz, beide Sehtypen für eine Informationsbereitstellung zu adressieren und in getrennten Probandenstudien zu untersuchen.
Die Wahrnehmung über das foveale Sehen führt zu einer zentralen Informationsbereitstellung mittels Einblendungen virtueller Informationen. Hier besteht eine große Schnittmenge mit der Augmented-Reality-Technologie. Die angezeigte Information vermittelt eine spezifische Aussage zur Assistenz beim Lasthandling. Es zeigt sich, dass mit dem gewählten Konzept einer Anzeige auf der Frontscheibe keine Optimierung hinsichtlich von Bearbeitungsdauern beim Lasthandling erzielt wird. Eine Verbesserung bei der Genauigkeit von Bedienvorgängen lässt sich nachweisen.
Die zweite Art der Informationsbereitstellung beruht auf visuellen Reizen, die in der Sehperipherie angeordnet sind und keine symbolhaften Informationen, sondern binäre Warnsignale transportieren. Die peripheren Warnungen führen zu signifikant besseren Ergebnissen im Vergleich zu anderen getesteten Warnvarianten. Bei der Untersuchung in Form von Realfahrten wird zusätzlich der Einfluss durch die Bedienung eines Staplerterminals auf die Wahrnehmung der Warnung betrachtet. Zudem werden neben unimodalen visuellen Warnungen auch multimodale, also über unterschiedliche Sinnesorgane wahrgenommene Varianten getestet.
Aktualisiert: 2022-03-31
> findR *
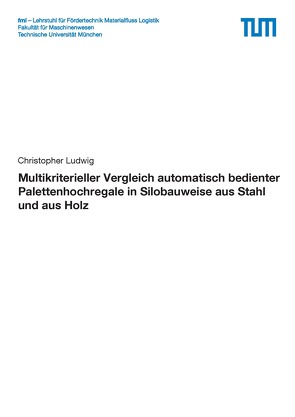
Automatisch bediente Palettenhochregale in Silobauweise werden zur Lagerung großer Artikelbestände auf kleiner Grundfläche eingesetzt. Bislang wurden die Regalkonstruktionen nahezu ausschließlich aus Stahl hergestellt. Seit dem Jahr 2005 gibt es jedoch auch einige Regalkonstruktionen, welche zu großen Teilen aus Holz bestehen. Gründe für Hochregale aus Holz waren bisher die bekannten Vorteile des Baustoffs Holz gegenüber dem Baustoff Stahl: geringere ökologische Auswirkungen, längere Tragfähigkeit im Brandfall, höhere Korrosionsbeständigkeit. Hochregale aus Holz bestehen aber auch aus anderen Baustoffen, welche die erwähnten Vorteile nicht aufweisen. Zudem unterscheiden sich die beiden Baustoffe Holz und Stahl noch in zahlreichen weiteren Eigenschaften. Eine wissenschaftliche Untersuchung der Unterschiede zwischen den beiden Regalbauweisen fand bislang noch nicht statt. Als Folge bestehen Unsicherheiten und die Holzbauweise wird in der Praxis nur bei wenigen Planungen berücksichtigt und folglich selten eingesetzt.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es einen multikriteriellen Vergleich der beiden Regalbauweisen durchzuführen. Dabei werden neben den Regalkonstruktionen selbst auch alle übrigen Komponenten von Hochregallagern berücksichtigt, da diese mit den Regalkonstruktionen direkt oder indirekt in Verbindung stehen und sich die Unterschiede bei den Regalkonstruktionen somit auch auf die Komponenten auswirken können.
Für die Erreichung des genannten Ziels werden zunächst mögliche Unterschiede zwischen den beiden Regalbauweisen durch eine Analyse der Prozesse innerhalb der Regallebenszyklusphasen sowie durch Hersteller- und Betreiberbefragungen gesammelt. Da die Unterschiede zwischen den Regalbauweisen auch von den Ausprägungen der Hochregallager (z. B. Regalgröße, Lagergut) abhängen können, werden anschließend mittels Auswertung einer Statistik von gebauten Hochregallagern sowie Befragungen von Planern und Herstellern häufig eingesetzte Hochregalvarianten ermittelt. Anhand dieser erfolgt dann die Untersuchung der möglichen Unterschiede. Können Unterschiede festgestellt werden, so werden im nächsten Schritt die Auswirkungen auf zuvor definierte Leistungsmerkmale bzw. Bewertungskriterien bestimmt.
Von dreizehn untersuchten möglichen Unterschieden liegen neun tatsächlich vor. Diese zeigen Auswirkungen auf sechs verschiedene Bewertungskriterien. Signifikante Unterschiede zwischen den beiden Regalbauweisen liegen jedoch nur bei fünf Bewertungskriterien vor. Für die finale Bewertung der Regalbauweisen wird eine Nutzwertanalyse durchgeführt. Mit dieser Methode sowie den ermittelten Auswirkungen auf die Bewertungskriterien können Interessenten der beiden Regalbauweisen die für sie vorteilhafteste Bauweise identifizieren. Das dazu nötige Vorgehen wird anhand eines Beispiels veranschaulicht.
Aktualisiert: 2022-01-20
> findR *
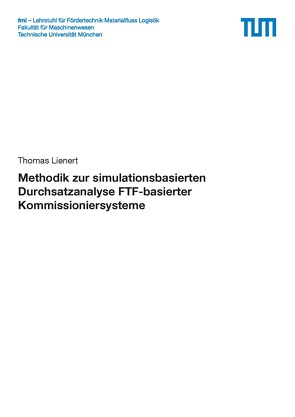
Kommissioniersysteme, in welchen eine Flotte Fahrerloser Transportfahrzeuge (FTF) die Ein- und Auslageraufträge ausführen, bieten verschiedene Vorteile gegenüber herkömmlichen, zumeist regalbediengerätbasierten Automatisierungslösungen. Sie sind hinsichtlich des Durchsatzes leicht skalierbar, können flexibel gestaltet und erweitert werden, weisen eine erhöhte Redundanz auf und ermöglichen eine Sequenzierung bereits innerhalb des Lagersystems. Auf der anderen Seite erfordern FTF-basierte Kommissioniersysteme komplexe Steuerungsstrategien, um einen effizienten und robusten Betrieb zu ermöglichen. Insbesondere der Verkehr innerhalb des Lagersystems muss derart gesteuert werden, dass es weder zu Kollisionen noch zu Blockaden zwischen den Fahrzeugen kommt.
Eine Herausforderung bei der Planung und Auslegung FTF-basierter Kommissioniersysteme besteht in der Bestimmung der Anzahl der Fahrzeuge, welche notwendig ist, um den geforderten Durchsatz zu erzielen. Analytische Methoden ermöglichen aufgrund der dynamischen Prozesse lediglich eine Näherungslösung. Die Absicherung der Planung erfordert die Durchführung einer Simulation, welche mit einem hohen Aufwand verbunden ist.
In der vorliegenden Arbeit wird eine Vorgehensweise zur Simulation von FTF-basierten Kommissioniersystemen vorgestellt, welche zum einen die Modellierung der Systeme beinhaltet, um diese in einer Simulationsumgebung abzubilden. Zum anderen umfasst die Vorgehensweise Steuerungsstrategien, welche notwendig sind, um die Ablauffähigkeit der Simulation sicherzustellen. Der Aufbau des Modells wird allgemeingültig strukturiert, sodass sich die Methodik in unterschiedlichen Simulationsumgebungen umsetzen lässt.
Mithilfe der vorgestellten Methodik lassen sich unterschiedliche FTF-basierte Kommissioniersysteme hinsichtlich des erzielbaren Durchsatzes analysieren. Eine individuelle Modellerstellung für jeden Anwendungsfall ist nicht mehr notwendig, wodurch sich der Aufwand bei der Durchführung der Simulation reduzieren lässt.
Aktualisiert: 2022-03-31
> findR *
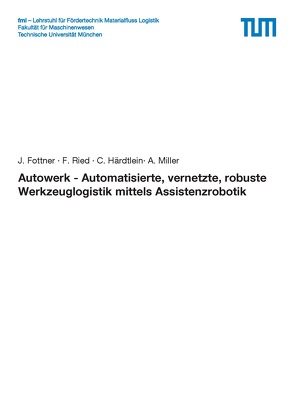
Die Prozesse der Werkzeuglogistik werden aktuell nahezu ausschließlich manuell verrichtet. Bei gleichzeitig steigenden Anforderungen an die Produktionslogistik im Allgemeinen und die Werkzeuglogistik im Speziellen stoßen diese inzwischen immer häufiger an ihre Grenzen. Dies äußert sich in Verzögerungen in der Werkzeugbereitstellung, was im schlimmsten Fall die Unterbrechung von Produktionsaufträgen zur Folge hat.
Vor diesem Hintergrund setzte sich das Forschungsvorhaben Automatisierte, vernetzte, robuste Werkzeuglogistik mittels Assistenzrobotik (AutoWerk) die Entwicklung eines Konzepts zur Automatisierung und Vernetzung der Werkzeuglogistik zum Ziel, das die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Werkzeugbereitstellung erhöht und zusätzlich eine Fokussierung menschlicher Arbeitskraft auf wertschöpfende Prozesse erlaubt. Das Konzept beinhaltet die Befähigung mobiler Assistenzroboter, Werkzeuge selbständig und termintreu an Fertigungsmaschinen bereitzustellen, beziehungsweise diese zurück in ein Werkzeuglager zu transportieren.
Zur Automatisierung der erforderlichen Transport- und Handhabungsprozesse wurden sowohl hardware- als auch softwareseitig neuartige Lösungen entwickelt. Auf Seiten des mobilen Roboters wurden unter anderem eine Möglichkeit zur automatisierten Konfiguration für unterschiedliche Werkzeugtypen und eine simulationsbasierte Zielposenplanung des Manipulators umgesetzt. Zur Planung und Steuerung der automatisierten Werkzeuglogistik wurde ein zentrales Leitsystem entwickelt, das auf Grundlage von Fertigungsaufträgen Transportaufträge für Werkzeuge ermittelt, optimiert und an die mobilen Roboter übermittelt. Außerdem stellt es eine umfassende Benutzeroberfläche zur Verfügung, über die Werkskräfte direkt und intuitiv mit dem System interagieren können.
Die einzelnen Elemente wurden anschließend implementiert und zu einem Gesamtsystem integriert. Dessen Funktionsfähigkeit und industrielles Potential konnte anhand einer demonstratorischen Umsetzung der automatisierten Werkzeuglogistik mittels mobiler Robotik bestätigt werden.
Das angestrebte Forschungsziel wurde erreicht.
Aktualisiert: 2021-11-23
> findR *

Die Zielsetzung dieses Forschungsvorhabens ist die Steigerung des Durchsatzes von
Shuttle-Systemen mit gassen- und ebenengebundenen Fahrzeugen durch den Einsatz mehrerer Shuttle-Fahrzeuge in derselben Ebene und mehrerer Lift-Fahrzeuge in demselben Schacht. In der Ebene und im Lift entstehen dadurch Bereiche, die von
mehreren Fahrzeugen (Server) gemeinsam befahren und als Multi-Server-Systeme
bezeichnet werden. Ein robuster und effizienter Betrieb des daraus hervorgehenden
Multi-Server-Shuttle-Systems setzt allerdings hohe Anforderungen an die Steuerung.
Außerdem macht die Vielzahl an unterschiedlichen Konfigurationen die Durchsatzbestimmung des Gesamtsystems zu einer Herausforderung.
Zu Beginn des Forschungsprojekts wurden mithilfe von Expertengesprächen und einer
Literaturrecherche der Stand der Technik von Shuttle- und Multi-Server-Systemen erarbeitet. Auf dieser Basis wurden relevante Ausprägungen von Multi-Server-Shuttle-
Systemen und deren Auswirkungen auf die Freiheitsgrade der Steuerung identifiziert.
Für die ausgewählten Systemausprägungen wurden Betriebsstrategien für die Zuweisung der Aufträge an die Lift- und Shuttle-Fahrzeuge sowie Bewegungsstrategien für die Ausführung der Aufträge entwickelt. Anschließend wurde ein parametrierbares Simulationstool erstellt, in welches sich die Steuerungsstrategien einbinden sowie unterschiedliche Konfigurationen analysieren und bewerten lassen. Mithilfe des entwickelten Simulationsmodells wurden Parameterstudien durchgeführt und basierend auf den Simulationsergebnissen Handlungsempfehlungen zur durchsatzoptimalen Konfiguration der Systeme abgeleitet.
Multi-Server-Shuttle-Systeme stellen eine bisher wenig beachtete Variante von Shuttle-Systemen dar, die gegenüber herkömmlichen Lösungen eine erhöhte Durchsatzleistung erzielen kann. Dabei lässt sich insbesondere auch die Leistung von Bestandsanlagen erhöhen, indem diese durch Hinzufügen weiterer Lift- und Shuttle-Fahrzeuge und unter Anwendung der entwickelten Steuerungsstrategien in Multi-Server-Shuttle-Systeme überführt werden.
Aktualisiert: 2021-11-23
> findR *
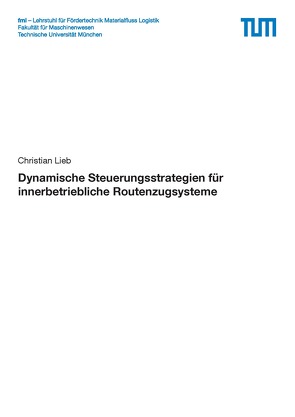
Routenzugsysteme zur innerbetrieblichen Produktionsversorgung sind derzeit meist mit statischen Routen und festen Abfahrtstakten geplant. Geänderte Anforderungen an die Reaktionsfähigkeit der Systeme erfordern eine dynamische, flexible und dennoch robuste Produktionsversorgung. Eine statische Steuerung der Materialbereitstellung führt dann häufig zu einem ineffizienten oder instabilen Systembetrieb.
In dieser Arbeit wurde daher untersucht, wie dynamische Steuerungsstrategien konzipiert sein müssen, um kurzfristig bekannte Transportbedarfe unter der Berücksichtigung des aktuellen Systemzustands robust und effizient zu bearbeiten. Dazu wurden auf Basis einer modularen Struktur 18 Steuerungsstrategien mit unterschiedlichem Dynamisierungsgrad entwickelt und algorithmisch ausgestaltet. Wichtigste Bausteine für die dynamischen Module sind die Berücksichtigung von Zeitfenstern und effizienten Tourenbildungsalgorithmen. Als zugrundeliegendes mathematisches Optimierungsproblem wurde das Vehicle Routing Problem with Time Windows (VRPTW) identifiziert und durch den Einsatz einer Multiple Ant Colony System (MACS)-Metaheuristik gelöst.
Zur Bewertung der Steuerungsstrategien wurden ereignisdiskrete Simulationsexperimente durchgeführt. Für repräsentative Systemausprägungen und Einsatzszenarien wurden je Strategie die Kombinationen aus Umlaufbestand und Routenzügen, die zum Sicherstellen einer robusten Produktionsversorgung erforderlich sind, ermittelt. Je weniger Ressourcen benötigt werden, desto effizienter agiert eine Steuerungsstrategie. Je mehr Einsatzszenarien robust versorgt werden können, desto höher ist die Effektivität. Im Mittel führen dynamischere Modulausprägungen immer zu einer zumeist statistisch signifikanten Steigerung der Effektivität und Effizienz der Produktionsversorgung. Gerade die Effizienz einer Steuerungsstrategie variiert jedoch in Abhängigkeit des Routenzugsystems und Einsatzszenarios, so dass auch statische Steuerungsstrategien in manchen Fällen zu einem effizienzoptimalen Systembetrieb führen können. Insbesondere bei flexiblen Transportnetzwerken können die dynamischeren Strategien jedoch eine deutliche Einsparung an Transportressourcen ermöglichen.
Grundsätzlich muss die Auswahl einer Steuerungsstrategie immer in Abhängigkeit des konkreten Routenzugsystems und Einsatzszenarios erfolgen. Die Ergebnisse dieser Arbeit liefern dazu Anhaltspunkte und Handlungsempfehlungen.
Aktualisiert: 2021-11-23
> findR *
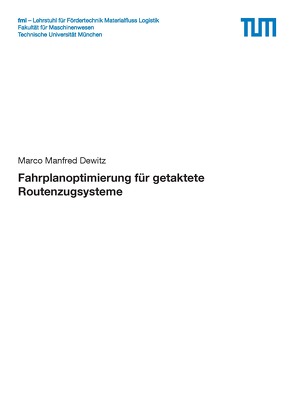
Moderne Logistikkonzepte zur Produktionsversorgung basieren in zunehmendem Maße auf „just in time“ Ansätzen für die Bereitstellung von Material. Durch eine hochfrequente Anlieferung kleinerer Losgrößen lassen sich Bestände reduzieren und die innerbetriebliche Logistik kann flexibler auf Veränderungen reagieren. Routenzugsysteme bieten das Potenzial, diese Anforderungen effizient zu erfüllen. Allerdings stellt die Planung solcher Systeme aufgrund der vielfältigen technischen und prozessualen Gestaltungsmöglichkeiten eine komplexe Aufgabenstellung dar. Getaktete Routenzugsysteme, welche nach einem Taktfahrplan ähnlich denen im öffentlichen Verkehr betrieben werden, sind eine in der Praxis häufig anzutreffende Ausprägungsform. Hier ist es Aufgabe der operativen Logistikplanung, Routen, Fahrpläne und Ladelisten zu definieren und laufend an Umfeldveränderunen anzupassen.
Aufgrund des Änderungs- und Einweisungsaufwandes, welcher mit einer Routenabpassung einhergeht, sowie weiterer betrieblicher Restriktionen kann dieser Freiheitsgrad in der Praxis jedoch limitiert sein. Hier stellt die Anpassung des Routenzugfahrplans eine naheliegende Lösung dar, um auf eine geänderte Transportnachfrage zu reagieren. Für diese Aufgabenstellung wird in dieser Arbeit ein Modell präsentiert, durch welches getaktete Routenzugsysteme mit statischen Routen operativ geplant werden können. Es werden Berechnungszusammenhänge hergeleitet, wie sich Transportnachfrage und Transportangebot, sowie Takt-, Umlauf- und Abfahrtszeiten gegenseitig beeinflussen. Darauf aufbauend bilden zwei mathematische Optimierungsprobleme die Kernergebnisse dieser Arbeit: Das „Routenzugfahrplan-Problem“ ermöglicht die Generierung einsatzoptimaler und überschneidungsfreier Routenzugfahrpläne. Durch Lösung des überlagerten, „integrierten Routenzugtakt-Problems“ können darüber hinaus die Taktzeiten der Routenzüge bestimmt werden, sodass eine gegebene Transportnachfrage gedeckt werden kann.
Für dieses Gesamtplanungsmodell zur Takt- und Fahrplanplanung werden optimale Lösungsverfahren präsentiert und anhand zweier Anwendungsfälle aus der Automobilindustrie evaluiert. Es wird gezeigt, dass die Anwendung der Forschungsergebnisse zu einer signifikanten Effizienzsteigerung beim Betrieb getakteter Routenzugsysteme mit statischen Routen führen kann.
Schedule optimisation for cyclic tugger train systems
Marco Dewitz
Modern logistics concepts for production supply focus a "just-in-time" provision of material. When delivering smaller batch sizes in high frequencies, stock in the production can be reduced and the internal logistics can react more flexible to changes. Tugger trains offer the potential to fulfil these requirements efficiently. However, the planning of such systems is a complex task due to the diverse technical and procedural design options. Cyclic tugger train systems, which are operated according to a regular interval timetable similar to those in public transport, are often encountered in industrial applications. For those systems routes, timetables and loading lists have to be planned and adapted to changes in the environment within the operational logistics planning.
Due to the implementation and training effort, which occurs when changing routes, as well as other operational restrictions, this degree of freedom can be limited in practice. Here, the adaptation of the tugger train schedule is an obvious solution to respond to a changing transport demand. To fulfil this task, this dissertation suggests a model to generate cyclic tugger train schedules with static routes within the operational logistics planning. Correlations between the transport demand and transport capacity are derived and formulas are presented by which cycle times, tour durations and departure times of the tugger trains can be calculated. Based on this, two mathematical optimization problems form the core results of this dissertation: The "tugger train schedule problem" allows the generation of non-overlapping schedules which can be carried out with a minimum number of tugger trains. By solving the overlying, "integrated route cycle time problem", the cycle times of the tugger trains can furthermore be determined, so that a given transport demand can be met.
To solve this overall planning model for cycle time and timetable planning, an optimal solution algorithm is presented and evaluated using two applications from the automotive industry. It is shown that the application of the research results can lead to a significant increase in efficiency when operating cyclic tugger train systems with static routes.
Aktualisiert: 2022-10-26
> findR *
MEHR ANZEIGEN
Oben: Publikationen von Lehrstuhl für Fördertechnik Materialfluß Logistik (fml) TU München
Informationen über buch-findr.de: Sie sind auf der Suche nach frischen Ideen, innovativen Arbeitsmaterialien,
Informationen zu Musik und Medien oder spannenden Krimis? Vielleicht finden Sie bei Lehrstuhl für Fördertechnik Materialfluß Logistik (fml) TU München was Sei suchen.
Neben praxiserprobten Unterrichtsmaterialien und Arbeitsblättern finden Sie in unserem Verlags-Verzeichnis zahlreiche Ratgeber
und Romane von vielen Verlagen. Bücher machen Spaß, fördern die Fantasie, sind lehrreich oder vermitteln Wissen. Lehrstuhl für Fördertechnik Materialfluß Logistik (fml) TU München hat vielleicht das passende Buch für Sie.
Weitere Verlage neben Lehrstuhl für Fördertechnik Materialfluß Logistik (fml) TU München
Im Weiteren finden Sie Publikationen auf band-findr-de auch von folgenden Verlagen und Editionen:
Qualität bei Verlagen wie zum Beispiel bei Lehrstuhl für Fördertechnik Materialfluß Logistik (fml) TU München
Wie die oben genannten Verlage legt auch Lehrstuhl für Fördertechnik Materialfluß Logistik (fml) TU München besonderes Augenmerk auf die
inhaltliche Qualität der Veröffentlichungen.
Für die Nutzer von buch-findr.de:
Sie sind Leseratte oder Erstleser? Benötigen ein Sprachbuch oder möchten die Gedanken bei einem Roman schweifen lassen?
Sie sind musikinteressiert oder suchen ein Kinderbuch? Viele Verlage mit ihren breit aufgestellten Sortimenten bieten für alle Lese- und Hör-Gelegenheiten das richtige Werk. Sie finden neben