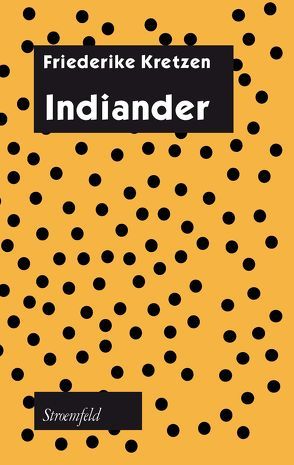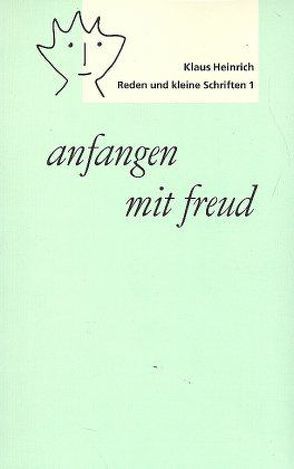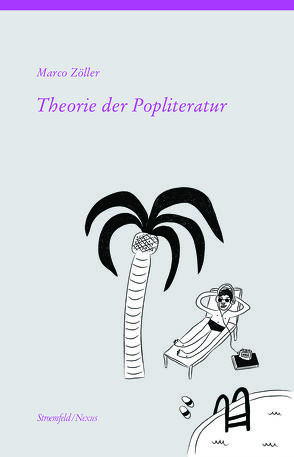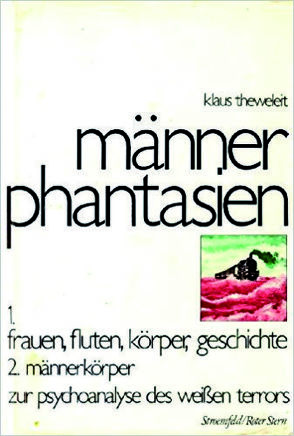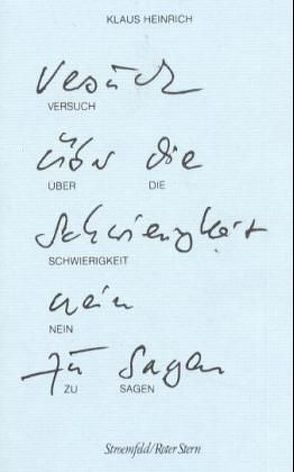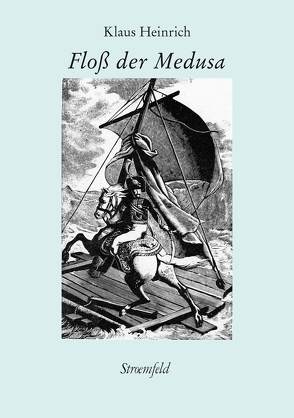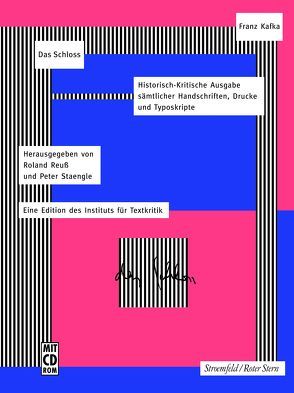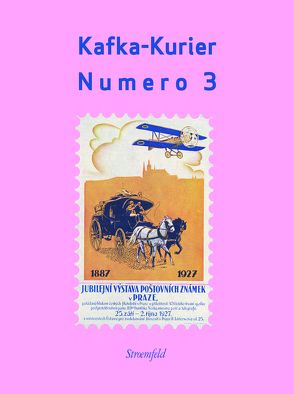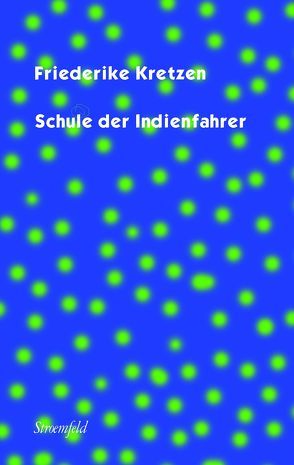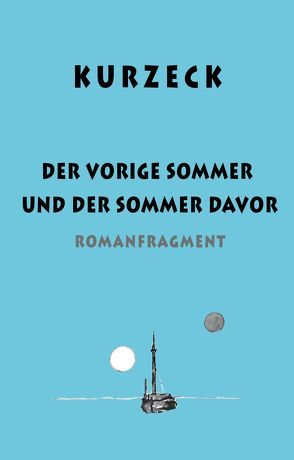»die bedeutendsten Prosaarbeiten aus meinem bisherigen Schafen« in der Druckfassung von 1920
Mit der Sammlung Seeland hat Robert Walser nach eigener Aussage sein schweizerischstes Buch veröfentlicht, das zugleich entschieden europäisch gemeint war. Es erschien 1920 im Max Rascher-Verlag in Zürich. Die Entstehungsgeschichte reicht zurück bis Anfang 1917, als Walser mit dem Huber-Verlag über einen Sammelband, »Studien und Novellen«, verhandelte. Dieses Projekt wurde zwar nicht realisiert, aus ihm entwickelten sich aber die beiden Bücher Poetenleben und Seeland. Dem Verlag gegenüber äusserte Walser über die sechs Texte der Sammlung Seeland, die zuvor an verschiedenen Orten einzeln erschienen waren, er habe sie »für die Buchherausgabe neu und so vorteilhaft wie möglich geformt, Satz für Satz aufmerksam geprüft und inhaltlich teilweise stark bereichert«. Beim Huber-Verlag kam eine Veröfentlichung nicht zustande. Walser bot die Sammlung dann umgehend dem Rascher-Verlag an, der sich bereit erklärte, das Buch unter der Bedingung zu verlegen, dass Karl Walser es illustriere. Gegen den Wunsch des Autors, das Buch lieber »unillustriert« zu lassen, stattete der Verlag es als »Luxusausgabe« aus und erhofte sich dank der Illustrationen des damals bekannten Buchkünstlers einen Verkaufserfolg bei Liebhabern. Schliesslich erschien es erst 1920 – zu einem Zeitpunkt, als die Infation die Gewinne aus dem Verkauf jedoch zunichte machte. In der KWA werden der Druck von 1920 und das Manuskript jeweils in einem eigenen Band ediert. Nachwort und Dokumentation des Druckbandes (KWA I 11) ma- chen die Entstehungsgeschichte von Seeland nachvollziehbar. In KWA IV 3 wird das Manuskript vollständig faksimiliert und in einer diplomatischen Umschrift wiedergegeben. Die Zeitschriftenfassungen der Texte werden in den jeweiligen Bänden von Abt. II integral ediert, so dass ein Nachvollzug der gesamten Textgenese möglich wird. Die Bände werden von einer elektronischen Edition online begleitet, in der alle Materialien in digitaler Form zugänglich sind.
Aktualisiert: 2019-03-15
> findR *

Im Jahr 1982 in Frankfurt-Eschersheim ein langes Wochenende
im Herbst. Der Erzähler ist mit Frau und
Kind bei Freunden zu Besuch. Vielleicht das letzte Wochenende,
bevor die Freunde nach Südfrankreich ziehen.
Der Erzähler ist müde. Will schlafen. Um ihn her
der Nachmittag und die vertrauten Stimmen und dazu
die Stimmen in seinem Kopf. Und dann muß er erzählen!
Eine lange Reise. Und wir begleiten ihn in das Land
seiner Kindheit. Das Oberhessen aus der Zeit nach dem
Krieg und bis in die Siebziger Jahre. Gestern noch hier
und jetzt ein versunkenes Land.
Man muß die ganze Gegend erzählen, die Zeit! Und
dazu die Menschen. Kleinbauern, Handwerker und
Gießereiarbeiter. Die Oberdorfwitwen, die alten Leute
und ihre Geschichten. Und die Kinder, als wir alle noch
Kinder waren. Die alten Kaufläden. Flohmarkt- und
Flüchtlingsgeschichten. Wie es bei der Arbeit zugeht.
Lebensläufe, Vergangenheiten, die Zeit. Was die Zeit
mit uns macht. Das Fernsehen. Die Liebe. Drei Paargeschichten.
Wie man mitten im Pferdefuhrwerk- und
Dampflokzeitalter als Sechsjähriger in Lollar am Güterbahnhof
bei der amt lichen Waage steht (neben einer
großen Pfütze) und weiß vom Hörensagen, die Erde
ist eine Kugel. Ein langer Herbstnachmittag und er ist
sechs und muß sich alle Stimmen und Farben und jede
Einzelheit merken. Hier will er ein Dichter und groß
werden! Wenn man auf einem Berg wohnt, führt jeder
Heimweg am Ende bergauf.
Die Nachkriegs-, die Not-, die Hunger-, die Hamster-,
die Schwarzmarkt- und dann die neue und immer noch
eine neuere neue Zeit. Der Fortschritt. Und fängt dann
zu fahren an. Baustellen, der Straßenbau, Autobahnen,
Schnellstraßen und Autobahnzubringer. Staatssekretäre,
Ehrenjungfrauen und das Weltbild der Igel. Eine
vergessene alte Landstraße, die leer in der Sonne liegt.
Supermärkte, Einkaufsfahrten, Räubergeschichten, ein
gelungener Amoklauf und die langen Sommer der späten
Sechziger Jahre. Ein ganzes Zeitalter und jeder Augenblick
fängt zu reden an.
'Schon mein ganzes Leben lang wollte ich dieses Buch
schreiben.' (Peter Kurzeck)
Seit Mitte der neunziger Jahre arbeitet Peter Kurzeck an
dem großen autobiographisch-poetischen Projekt Das
alte Jahrhundert. Die ersten vier Bände sind bereits erschienen:
Übers Eis (1997)
Als Gast (2003)
Ein Kirschkern im März (2004)
Oktober und wer wir selbst sind (2007).
'Über das Autobiographische hinaus entsteht eine faszinierende
Zeitgeschichte.' (Norbert Wehr im WDR)
'…vielleicht werden es ja noch mehr, die einen der
größten zeitgenössischen deutschen Schriftsteller für
sich entdecken.'
(Bettina Schulte in der Badischen Zeitung)
Vorabend wurde im Sommer 2010 von Peter Kurzeck im
Literaturhaus Frankfurt öffentlicht diktiert.
Aktualisiert: 2019-03-15
> findR *

Von größter Bedeutung für Walsers schriftstellerische
Entwicklung in der 2. Hälfte der 1920er Jahre war seine
Verbindung zur Feuilletonredaktion der »Prager Presse
«. Über 200 Beiträge, weit mehr als in irgend einer
anderen Zeitung, sind dort erschienen. Diese hohe
Präsenz hatte ihren Grund im besonderen kulturpolitischen
Auftrag dieses Feuilletons. Der Kulturteil der
nach Gründung der tschechischen Republik ins Leben
gerufenen, mit staatlichen Mitteln finanzierten Zeitung
sollte einerseits die Bindung der deutschsprachigen
Minderheit an den tschechischen Staat befördern, andererseits
im Ausland das hohe Niveau des tschechischdeutschen
Kulturlebens repräsentieren. Die Redaktion
war daher mit den entsprechenden Mitteln ausgestattet
und um namhafte Beiträger bemüht. Ein breites Spektrum
der literarischen Moderne von Peter Altenberg bis
Stefan Zweig war hier vertreten.
Die Lektüre im Kontext dieser Zeitung eröffnet neue
Perspektiven auf Walsers späte Berner Prosa, etwa auf
die besondere Nähe ihrer »poetologischen Modernität«
zu den avantgardistischen Bestrebungen der Prager Literatur-
und Kunstszene nach 1918. Auch genrespezifische
Fragen und Beobachtungen lassen sich mit Walsers
Prager Veröffentlichungen verbinden. So sind die
zahlreichen Gedichte, die (fast) nur hier zu lesen waren
und die eine neue Periode der lyrischen Produktion in
Walsers Spätwerk hörbar werden lassen, eine Besonderheit
der Veröffentlichungen in der »Prager Presse«.
Aber auch die übrigen Publikationen in der »Prager
Presse« bilden innerhalb von Walsers Spätwerk ein eigenes
Corpus, das sich beispielsweise von den Publikationen
in der »NZZ« oder im »Berliner Tageblatt« signifikant
unterscheidet.
Da ein großer Teil der Druckmanuskripte in der Sammlung
des Chefredakteurs Arne Laurin überliefert ist, ist
hier ein analytischer Vergleich von Zeitungsdrucken
und Manuskripten (die in KWA V 2 ediert werden) in
einzigartiger Weise möglich.
Das Editorische Nachwort charakterisiert die Zeitung
und Walsers Beziehung zu ihr. Der Dokumentarische
Anhang versammelt die zahlreichen Briefe an den
Feuilletonredaktor Otto Pick und weitere Zeugnisse,
die über diese Beziehung Aufschluss geben können
oder Aussagen zu bestimmten Texten enthalten.
Die elektronische Edition enthält die Faksimiles der
originalen Zeitungsdrucke.
Aktualisiert: 2019-03-15
> findR *

Sehr verehrter Herr.
Indem Sie sicher begreifen werden, daß nicht alles,
was aus der Feder eines Vielbeschäftigten springt, abdruckbar
und kunstkritikwiderstandbar sein kann,
schicke ich Ihnen im Drang der Geschäfte, womit ich
mich überhäuft erblicke, vier neue Prosastücke und
grüße Sie eifrig, d.h. aus einem gewissen Eifer heraus,
hochachtungsvollst
Ihr sehr ergebener
Robert Walser [an Otto Pick, 29.11.1926]
»Robert Walsers Prager Reinschriftmanuskripte zum
ersten Mal kritisch ediert«
Mit den Prager Manuskripten erscheint der erste
Band der Abteilung V der Kritischen Robert-Walser-
Ausgabe, in der die Manuskripte zur kleinen Form
nach Standorten zusammengefasst präsentiert werden.
Der vorliegende Band versammelt 103 Reinschriftmanuskripte,
die heute im Museum der Tschechischen
Literatur bewahrt werden. Sie wurden fast
alle in der Prager Presse gedruckt. Die in deutscher
Sprache erscheinende tschechische Zeitung veröffentlichte
so viele Beiträge Walsers wie kein anderes Blatt;
zwischen 1925 und 1937 erschienen hier mehr als zweihundert
Texte.
Die Handschriften sind in Originalgröße faksimiliert,
einer diplomatischen Umschrift gegenübergestellt
und mit einem Kommentar zur Entstehung und
Datierung versehen. Im Zusammenspiel mit der Edition
der Zeitungsdrucke in der Prager Presse (KWA
III 4) und der Mikrogramme in der Abteilung VI – zu
fast allen der in Prag gedruckten Texte sind mikrographische
Aufzeichnungen erhalten – erlaubt dieser
Band den Nachvollzug von Walsers Arbeitsweise ab
Mitte der 1920er-Jahre und damit einen Einblick in
sein spezifisches Schreibverfahren für das Feuilleton.
Aktualisiert: 2019-03-15
> findR *

»Guten Tag, Riesin!«
Sprühende Evokationen der »Weltstadt« Berlin, Satiren
auf den journalistischen Jargon, ironische Porträts des
hauptstädtischen Gesellschaftslebens, atmosphärisch
dichte Schilderungen der Stadt-Landschaft, klassische
Reportage-Texte – eine Vielfalt feuilletonistischer
Genres hat Robert Walser zwischen 1907 und 1927 in
Samuel Fischers ›Neuer Rundschau‹ veröffentlicht.
Dabei ändern sich Ton und Sujet seiner Beiträge nach
der Rückkehr zu Beginn des Jahres 1913 in die Schweiz
deutlich. In der Berliner Zeit war Walser, oft in unmittelbarer
Nachbarschaft von Peter Altenberg, regelmässig
in der Rubrik »Rundschau« bzw. »Anmerkungen«
zu lesen, einer Rubrik, die nach der Vorstellung des Redakteurs
Oscar Bie die Mitte halten sollte »zwischen einer
produktiven und einer mehr kritischen Art«, um so
den »schweren Anfang« des essayistischen Hauptteils
»in ein leichteres Spiel des Geistes aufzulösen«. Später
rückten Walsers Texte in den opulenter gestalteten
Hauptteil auf, erschienen seltener, wurden experimenteller.
Zwischen dem 1920 gedruckten Dramolett Das
Christkind und der letzten Veröffentlichung, den 1927
erschienenen, auf mikrographische Entwürfe zurückgehenden
Drei Studien, war Walser in der »Neuen Rundschau
« nicht vertreten. In diesen Jahren wandelte sich
die Zeitschrift äusserlich und inhaltlich. In der Ausgabe
der Drucke in der »Neuen Rundschau« wird den einzelnen
Texten Walsers jeweils eine Kontextdokumentation
vorangestellt. Die Faksimiles der Originalbeiträge sind
in der begleitenden elektronischen Edition der KWA zu
finden. Im Editorischen Nachwort wird die Beziehung
Walsers zur Zeitschrift und zum S. Fischer Verlag beschrieben
– ergänzt durch einen Dokumentarischen
Anhang mit Briefen und weiteren Zeugnissen, die seine
Beziehung zur Redaktion illustrieren können.
Aktualisiert: 2019-03-15
> findR *
»in mühsamer Winterarbeit … die bestmögliche Form« als Faksimile und diplomatische Umschrift
Das Druckmanuskript der Sammlung Seeland erlaubt einen genauen Blick auf Robert Walsers schriftstellerische Arbeitsweise und illustriert den hohen Anspruch, mit dem er die Auswahl der bereits in verschiedenen Zeitschriften veröfentlichten Texte für die Buchausgabe um- und neu geschrieben hat. »Die sechs Stücke werden im Druck gut aussehen«, schrieb er in einem Brief an den Journalisten und Schriftsteller Emil Wiedmer. Der intensive Arbeitsprozess lässt sich an einer relativ grossen Anzahl von Bearbeitungsspuren, die sich auf den Blättern des Seeland-Manuskripts fnden, gut ablesen. Die überlieferten Romanmanuskripte, die Reinschriften der Kurzprosa oder die Mikrogramme weisen nicht dasselbe Ausmass solcher Korrekturen von Walsers Hand auf. Das Seeland-Manuskript gewährt daher einen bislang noch wenig bekannten Einblick in Walsers poetische Werkstatt.
Aktualisiert: 2019-03-15
> findR *
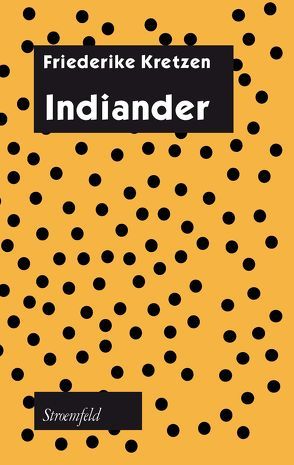
Sie sind wieder da, die lange vergrifenen Indiander, mit denen die Schule der Indienfahrer ihren Anfang genom- men hat. Wir lassen alles liegen und gehen die Hauptstrasse hoch in die Stadt zum Bayerkaufhaus, wo die Campingmöbel im Freien stehen. Eine Hollywoodschaukel ist eine Wolke, die mit Geld auf die Welt geschaft worden ist. Wir setzen uns sofort hinein. Und sie passt zu den Haaren. Wer das schreibt, ist das Kind, das in Indiander ein Kind werden will. Mitten in den westdeutschen Wirtschafts- wunderzeiten sitzt es in der Küche der Grossmutter über sein Heft gebeugt und sieht die Buchstaben auf ihren ganz eigenen Bahnen wie Katzen im Schnee ge- hen. Denn das Leben, zu dem das Kind in der Schule einen Aufsatz schreiben soll, schneit in diesem Buch unablässig herein. Und wie soll es dem anders gerecht werden können als in einer abwegigen Schreibweise? Kein Wunder also, dass es eine Rechtschreibschwäche hat. Weswegen es Diktat üben muss. Wilfred, der ein Berg ist, diktiert, und während sich die Kleine dem Diktat unterwirft, erschreibt sie sich zugleich die notwendigen Öfnungen in der Sprache, durch die sie, auf den Armen und Beinen der Wörter entkommen kann. So erfährt sie, dass der hingeschriebene Tisch, die Bank, der Apfel auf dem Blatt wie Dinge zu hausen beginnen. Und zugleich können sich die Wörter aufmachen, aus der Tür treten, weiter durch den Flur und raus aus dem Fenster, wo sie zum Rhein laufen, um mit der Fähre ans andere Ufer überzusetzen. dass sie als Von Friederike Kretzen bei Stroemfeld lieferbar: Übungen zu einem Aufstand. Roman 195 Seiten, geb., ISBN 978-3-87877-814-1 Natascha, Véronique und Paul. Roman 210 Seiten, geb., ISBN 978-3-86600-008-7 Schule der Indienfahrer. Roman 264 Seiten, geb., ISBN 978-3-86600-272-2 Die Autorin: 1956 in Leverkusen geboren, Studium der Soziologie und Ethnologie, Arbeit als Dramaturgin am Residenz- Theater München. Seit 1983 freie Autorin in Basel. Ver- fasserin zahlreicher Romane, u. a. »Indiander«, 1996, »Ich bin ein Hügel«, 1998, »Übungen zu einem Auf- stand«, 2002, »Natascha, Véronique und Paul«, 2012. Neben der schriftstellerischen Arbeit als Literaturkriti- kerin, Essayistin und Dozentin an der ZHdK und am Li- teraturinstitut Biel tätig. Seit 1996 Leitung der Schreib- arbeit an der ETH Zürich. 2018 Schweizer Literaturpreis für »Schule der Indienfahrer«. Schreiben, Schrift, Diktat und Dichtung wirken als Hauptakteure Schule. In der uns die Geschichte einer erschriebenen Kindheit eine Sprache beibringt, die das Ungesagte be-
Aktualisiert: 2019-03-15
> findR *
anfangen mit freud – ein
Appell, der Aussperrung
bis 1945 nicht eine zweite
folgen zu lassen, die einer
Provinzialisierung gleichkäme.
Für die Geisteswissenschaften
in unserem
Land – anders als in
Frankreich – ist die Psychoanalyse
kein Ferment
der Reflexion geworden.
Nur eine Philosophie, die
den Menschen als bedürftiges
und begehrliches
Wesen ernstnimmt, vermag auch den Aufklärungsanspruch
ernstzunehmen, den die psychoanalytische
Deutung erhebt, und den Psychoanalytiker als Bundesgenossen
eigenen Erkennens. Ihr vornehmstes Ziel
heute ist, den Schleier der Faszination zu durchdringen,
der den Selbstzerstörungswunsch der Gattung umgibt.
Aktualisiert: 2019-03-15
> findR *

Die Angst ist ein Bindemittel menschlicher Beziehung.
Sie konstituiert und stabilisiert die bestehenden
Machtverhältnisse. Sollen diese nicht gefährdet werden,
darf sie an Bedeutung nicht verlieren.
Der gängige Diskurs, der Beziehungen definiert und
etabliert, ist ein hierarchischer. Seien es politische, gesellschaftliche
oder jene zwischen zwei Individuen – Beziehungen
werden im Gefälle eingerichtet. Die Angst
hat in diesem Narrativ eine beachtliche Hebelfunktion.
Als Folge der Entmachtung der Aggressionen im Dienste
des Ich bleibt sie unentbehrlich für die Regulierung
hierarchischer Beziehungen. Diese Aggressionen ermöglichen
uns, mit einem Schrei auf die Welt zu kommen,
uns gestalterisch in diese einzumischen und als eigenständiges
und verantwortliches Subjekt Entwicklung
und Entfaltung zu erwirken. Die Entbehrung dieser Aggressionen
bedeutet Ohn(e)macht – und das ist Angst.
Der bestehende Schuld- und Opferdiskurs ist mass geblich
verantwortlich für deren Enteignung. Die gängige
Annahme, dass die Angst ein Gefühl ist, ein lebensnotwendiges
Gefühl, das uns vor Gefahren schützt, vermag
uns Einblick zu geben in ihre Wichtigkeit und Unentbehrlichkeit
für die bestehenden Machtverhältnisse.
Es ist nicht die Angst, die uns vor Gefahren schützt, es
ist die Furcht. In der Furcht haben wir keine Angst: Die
Aggressionen im Dienste des Ich bleiben dabei unbeschädigt.
Damit kommt der Angst eine ganz andere
Bedeutung zu: Sie ist nicht Indikator einer bevorstehenden
Gefahr, sondern einer bestehenden Form von
Gewalt, mit der Hierarchien geschaffen und Machtverhältnisse
eingerichtet werden. Die Angst ist ausschliesslich
ein Bindemittel hierarchischer Beziehungen – und
kein Schutzfaktor. Es ist die Angst, die gefürchtet werden
muss.
Im intersubjektiven Diskurs ist die Unterscheidung der
Individuen nicht mehr im hierarchischen Gefälle ablesbar,
sondern in der Gleichwertigkeit der Differenz. Die
Anerkennung des Andern als anders als Ich, als Nicht-
Ich, bleibt das einzig Verbindende. In dieser Dynamik
wird ein Raum der Kommunikation, des Konfliktes und
des Begehrens eröffnet. In diesen Beziehungen wird
nicht die Schuld und nicht die Angst als verbindendes
Element eingesetzt, sondern die Anerkennung der Differenz.
Intersubjektive Beziehungen erfordern Arbeit, viel Arbeit
an sich selber – und nicht am Anderen –, um die
Verortung als Subjekt ständig zu regulieren, die Differenz
und gleichzeitig die Variabilität von Ich auszuhalten,
ja auszuhalten, Ich im intersubjektiven Raum erst
zu konstituieren.
Dieser Paradigmenwechsel ermöglicht Subjekt der Aggression
zu werden und nicht ein Objekt der Angst. Er
bedeutet, die Verantwortung für die eigenen Aggressionen
zu übernehmen und sie nicht über Projektionen
auszulagern, um dann als Opfer Schuld zuweisen zu
können. Gesellschaft, Kultur und Frieden gelingen in
der Bestätigung, dass das einzig Verbindende zwischen
Menschen die Differenz ist.
Aktualisiert: 2019-03-15
> findR *
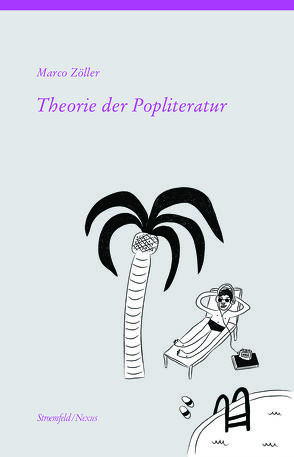
Mitte der neunziger Jahre wurde die literarische Öffentlichkeit
durch eine Reihe neuartiger Romantexte
aufgerüttelt, die wenig Rücksicht auf tradierte literarische
Konventionen nahmen und dabei sehr viel näher
am Puls der wiedervereinigten Bundesrepublik waren
als die meisten anderen Texte dieser Zeit: der Begriff
der »Popliteratur« war plötzlich in aller Munde.
Mehr als zwanzig Jahre sind inzwischen vergangen,
seitdem Christian Kracht mit seinem 1995 erschienenen
Roman Faserland den Startschuss für die Diskussion
um eine neue Schreibweise gesetzt hat.
Trotz intensiv geführter Debatten herrscht jedoch bis
heute keineswegs Klarheit darüber, worin die Besonderheit
popliterarischen Erzählens besteht. Hier setzt
die vorliegende Studie an. In enger Auseinandersetzung
mit den literarischen Texten sowie den bereits vorliegenden
Theorieangeboten entwickelt sie eine Systematik
der popliterarischen Schreibweise.
Dabei macht der Autor deutlich, dass die Popliteratur,
obwohl sie erst in den Neunzigern von einer breiten
Leserschaft wahrgenommen wurde, bereits in den achtziger
Jahren entstanden ist. Die Ausdifferenzierungen
in vielen wesentlichen Bereichen des kulturellen, sozialen
und ökonomischen Lebens, die sich in diesem
Jahrzehnt potenziert haben, erscheinen dabei ebenso
als entscheidende Faktoren für die Entstehung und
Etablierung der Popliteratur wie auch ein allgemeiner
Wandel der Werte: etwa eine veränderte Haltung zum
Konsum, eine Abkehr von der radikalen Politisierung
der siebziger Jahre oder die Individualisierungstendenz
hinsichtlich aller Fragen des Lebensstils.
Die Popliteratur reflektiert diesen umfassenden, gesamtgesellschaftlichen
Einschnitt. Die besonders seit
dieser Zeit zu beobachtende massive Zunahme an Zeichen
und Zeichensystemen – im Bereich der Medien,
der Marken und Produkte, der populären Musik, der
Mode und Selbstinszenierungen, des Alltags und der
Freizeitgestaltung usw. – liefert ihr das Ausgangsmaterial,
das in den Erzählungen in kreativer und spielerischer
Weise verarbeitet wird. Dabei folgt die Popliteratur
dem gestalterischen Prinzip, das die amerikanische
Pop Art bereits für den Bereich der bildenden Kunst
etabliert hatte. Die systematischen Überlegungen plausibilisiert
die Studie am Beispiel zentraler popliterarischer
Werke, etwa von Rainald Goetz, Thomas Meinekke,
Christian Kracht und Benjamin von Stuckrad-Barre.
Aktualisiert: 2019-03-15
> findR *
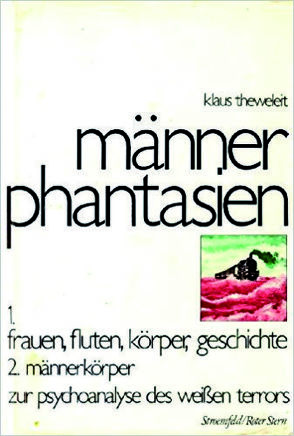
Im Herbst 1977 erschien bei uns der erste Band von
Klaus Theweleits Männerphantasien: Frauen, Fluten,
Körper, Geschichte. Und 1978 – vor vierzig Jahren! –
folgte der zweite Band: Männerkörper. Zur Psychoanalyse
des weißen Terrors.
Männerphantasien wurde unser erfolgreichstes Buch,
hundertfach besprochen, mit Übersetzungen ins Englische,
Serbokroatische, Schwedische, Italienische, Japanische,
Polnische und Französische und Taschenbuch-
Lizenzausgaben bei Rowohlt, dtv, Piper. Seit ein paar
Jahren vergriffen, wird der Doppelband hier endlich
wieder vorgelegt. Er ist noch so aktuell wie damals.
»Theweleit berührt im ersten Band seiner phantastischen
Erzählungen über ›Frauen, Fluten, Körper, Geschichte‹
Bilder von scheinbarer Heimlichkeit, löst
sie aus ihrer verwunschenen Erstarrung, daß man ihn
manchmal schnell umarmen möchte … es ist hier nicht
möglich, den vielfältigen Bewegungen des Buches zu
folgen – man muß es lesen.«
– Gisela Stelly, DIE ZEIT
»Gegenstand seiner staunenswert phantasiereichen,
umfangreichen und heiteren Darstellung ist der Bürger
als Abwehr- und Verdrängungs-Akrobat … untersucht
wird von Theweleit, wie aus dem wilhelminischen
Manne, der den Zwängen zur Ich-Autonomie, wie sie
das bürgerliche Selbstbewußtsein postuliert, nur durch
Anlegen eines Charakterpanzers standhalten kann, der
faschistische Held wird … die Disposition zum Faschisten
wird jeder an sich erkennen, der keiner ist! Theweleits
Arbeit ist der bisher am weitesten führende Beitrag
linker Theoretiker zur Faschismusdebatte. «
– Bazon Brock, DIE ZEIT
»Vielleicht die aufregendste deutschsprachige Publikation
dieses Jahres … ein vermischendes, ein entgrenztes,
ein verschwenderisch überfließendes Diagnostizieren
der männerrechtlichen Eroberungskultur.«
– Rudolf Augstein, DER SPIEGEL
»Männerphantasien ist die gleichzeitig schönste, spannendste
und für den Alltag wichtigste Neuerscheinung
des Jahres.«
– Reinhard Hübsch, Stuttgarter Nachrichten
Zwar findet der Historiker Sven Reichardt einiges
›überholt‹ (wie Historiker müssen), schließt aber: ›Ein
besserer Ersatz ist immer noch nicht zu erkennen‹. Das
war 2006. (2018 auch noch nicht).
Aktualisiert: 2019-03-15
> findR *
Versuch über die Schwierigkeit nein zu sagen
Neinsagen ist die Formel des Protestes. In einer Welt,
die zu Protesten Anlaß bietet, scheint es nicht überflüssig,
diese Formel zu untersuchen.
Aktualisiert: 2019-03-15
> findR *
Aus dem Vorwort: "Floß der Medusa ist nur ein anderer Name für das von Katastrophen bedrohte Vehikel der Zivilisation, das die Geschlechterspannung, dank der wir leben, im Zustand der Erstarrung transportiert. Das Verhältnis zwischen Perseus und Medusa harrt bis heute der Aufarbeitung - so viel wenigstens haben uns die frühen Intellektuellen, die wir Mythologen nennen, und die Artisten bis heute gezeigt ... Allen drei Studien gemeinsam ist die Annäherung an den Aufklärer Ovid, dessen Andenke ich dieses Buch widme."
Aktualisiert: 2019-03-15
> findR *
Benjamins als Habilitationsschrift geplante Studie über den »Ursprung des deutschen Trauerspiels« ist nicht nur wegen der »erkenntniskritischen Vorrede« eine seiner berühmtesten und zugleich methodisch anspruchsvollsten Arbeiten. Sie hat sowohl im engeren Kreis der Barockforschung wie in der Allgemeinheit philosophisch-literaturwissenschaftlicher Fragestellungen tiefe Spuren hinterlassen. Der hier erstmals als Faksimilenachdruck vorgelegte Text war von Benjamin bis in die typographische Gestalt hinein geplant worden. Die lebenden Kolumnentitel und die verwendete Schwabacher spielen für die Lektüre des Textes eine nicht zu unterschätzende Rolle. Ihre Bedeutung für das Verständnis des Textes wird in dem sorgfältigen Faksimilenachdruck wieder erkennbar. Das Nachwort von Roland Reuß orientiert über die textkritischen Probleme, die das Original aufweist. Es bietet außerdem eine ausführliche Darstellung der Druckgeschichte des Textes.
Aktualisiert: 2019-03-15
> findR *
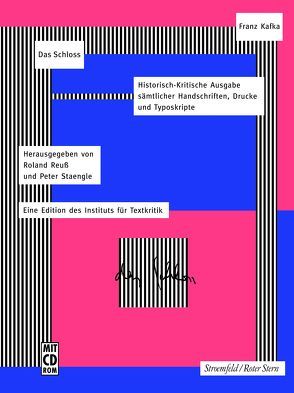
Mit der Edition der Handschriften zu Kafkas »Das Schloss« legt die Franz Kafka-Edition (FKA) nach »Der Process« (1997) den zweiten umfangreichen Roman- Entwurf Kafkas in Faksimile und chronologisch differenzierter diplomatischer Umschrift vor. Es handelt sich um Kafkas letzten, Fragment gebliebenen Versuch, einen Roman zu schreiben. Begonnen wurde er im Winter 1922 zu Beginn des Kuraufenthalts in Spindlermühle, unterhalb der Schneekoppe, unweit der heutigen tschechischen Grenze zu Polen. Die Handschrift erstreckt sich über sechs Hefte und ist – im Unterschied zum Manuskript von »Der Process« – durchgängig linear organisiert, wobei die FKA in Heft 1 erstmals die Problematik des doppelten Anfangs sinnfällig macht, die in den früheren Ausgaben Max Brods und Malcolm Pasleys zugunsten einer einfacheren Lektüre in den Anhang bzw. textkritischen Apparat verbannt wurde. Sinnlich wahrnehmbar wird in der FK A auch erstmals Kafkas Kniff bei der Destabilisierung der Erzählperspektive, einen zunächst als Ich-Erzählung beginnenden Text durch den bruchartigen Übergang zur Er-Perspektive nach ca. 50 Seiten (bei rückwirkender Änderung des Personalpronomens der zunächst geschriebenen Passagen) zu befremden. Die Handschrift selbst ist, wie häufg bei Kafka, ohne vorausliegenden Plan unmittelbar in die überlieferten Hefte geschrieben. Die Spuren der äußeren Umstände ihrer Entstehung (Ortswechsel) lassen sich an den manchmal begegnenden Änderungen des Schreibmaterials (Bleistift, verschiedene Tinten) gut verfolgen. Die Transkription der FKA bemüht sich zugleich um größtmögliche Präzision und um gute Lesbarkeit. Die konsequente Faksimilierung der Handschriften ermöglicht die Überprüfung der editorischen Entscheidungen auf jeder Seite. Mit der historisch-kritischen Ausgabe von »Das Schloss« liegt ein weiterer Meilenstein der Kafka-Edition von Roland Reuß und Peter Staengle vor.
Aktualisiert: 2019-03-15
> findR *
Aus dem Inhalt:
Guido Massino: "Der Unterschied ist Galizien und Budapest." Zum biographischen und kulturellen Hintergrund von Kafkas Erzählung "Ein Bericht für eine Akademie" 5-16
Hartmut Bind: Über Strindbergs Kelchkragen 17-18
Hans-Gerd Koch: Der junge Flaneur 19-22
Matthias Steinhart: "Ich habe über Dickens gelesen." Eine Lesefrucht zu einem Tagebucheintrag von Franz Kafka 23
Peter Widlok: Kafka und Josefine Mišek; Spuren zu einer Unbekannten 24-31
Eva Maria Mandl und Anthony Northey: Die reichen und einflußreichen Löwys 32-42
Alena Wagnerová: Ein Fund: Zwei Briefe von Oskar Pollak an Johannes Nádherný 43-46
Marit Müller: Max Benses Nachwort zur geplanten Neuauflage der "Theorie Kafkas" 47-48
Aktualisiert: 2019-03-15
> findR *

Anton Bruckner »ist ein armer verrückter Mensch, den
die Pfaffen von St. Florian auf dem Gewissen haben«
– dieser Satz von Johannes Brahms reißt schlaglichtartig
eine unüberbrückbare Kluft auf zwischen dem ins
gehobene Bildungsbürgertum integrierten Komponisten,
in dessen Arbeitszimmer über dem Schreibtisch
ein Reproduktionsstich der Mona Lisa und über dem
Sofa ein Stich der Sixtinischen Madonna hing, und dem
gesellschaftlich nur schwer einzuordnenden Bruckner,
in dessen karg möblierter Wohnung sich hinter einem
grünen Vorhang ein Foto der toten Mutter auf dem
Sterbebett verbarg.
Was es heißen könne, daß nach dem Ende unserer Zeit
eine unausdenkbare Ewigkeit beginnt, wie Unermeßlichkeit
musikalisch zu formulieren sei, darum kreisen
Bruckners Reflexionen, die vor keinem Grenzgedanken
zurückschrecken – so wie ihn auch Katastrophen oder
die menschenleere, unvorstellbare Weite des Nordmeers
und dessen letzte Inseln obsessiv beschäftigen.
Schließlich ist es der Gedanke an den Allesvernichter
Tod, der ihn zunehmend bedrängt und der zu einem
Thema der letzten beiden Symphonien wird. Wie die
Musik diese Abenteuer des Denkens und der Imagination,
die eine nicht stillzustellende Krisendynamik
erzeugen, strukturhomolog realisiert, soll hier gezeigt
werden.
Bruckner war alles andere als ein »Musikant Gottes«.
Die durch zahlreiche Erinnerungsberichte und Anekdoten
korrumpierte Vorstellung vom Menschen Bruckner
bedarf noch immer einer rigorosen Kritik. Er war
ein Krisenkomponist par excellence. Dies tritt umso
mehr hervor, je strikter mit den Quellen verfahren
wird. Kunst entsteht nicht aus der Ergebung in fromme
Kontemplation dogmatischer Inhalte, sondern auf
der Schwelle zum Unausdenkbaren, auf der es sich mit
allen Kräften des Ichs zu halten gilt.
Aktualisiert: 2019-03-15
> findR *

Die Studie setzte sich erstmals systematisch mit der
biographischen, stofflichen und poetologischen Spannung
von Dichter und Prediger bei Lenz auseinander.
Der Anspruch des Vaters, wie er Prediger werden zu
sollen, und Lenz’ Versuch, in der Folge Literatur und
Predigersein in verschiedenen Konstellationen zu vereinbaren,
schlägt sich nicht nur stofflich in seinem
Werk nieder, das von den frühen Straßburger bis zu den
späten Moskauer Jahren in den Blick kommt.
Indem die Studie Lenz’ Schaffen im Zusammenhang
von Rhetorik, Literatur und Homiletik im Ausgang des
18. Jahrhunderts untersucht, zeigt sie auch jene dialektischen
Beziehungen zwischen der Sphäre der Predigt
und der Literatur auf, die entscheidend für Lenz’ poetologisches
Problem sind, wie Literatur auf das Erkenntnisvermögen
wirken kann, ohne den Freiheitsspielraum
des Menschen, der seine Gottesebenbildlichkeit
erst begründet, einzuschränken.
Die »weltliche Theologie« erscheint bei Lenz in verschiedenen
Schriften, die Gegenstand der Studie sind,
im literarischen Gewand. Die »Meynungen und Stimmen
« etwa, der »Grundstein« von Lenz’ poetischer
Produktion, bringen als literarische Predigt Theologisches
und Ästhetisches zusammen. Lenz’ poetologische
Hauptschrift wiederum, die »Anmerkungen übers
Theater«, führt die Ästhetik auf ein theologisches Fundament
zurück: Lenz predigt den »Naturalismus«.
Die Spannung zwischen Prediger und Dichter trägt
schließlich auch zum Konflikt am Weimarer Hof bei
und kulminiert in der Erzählung »Der Landprediger«.
Wenig später markiert das Steintal einen entscheidenden
Wendepunkt in Lenz’ Leben.
Theologische Fragen werden dann auch in der Moskauer
Zeit virulent: die Möglichkeit der Transformation
des Menschen durch Umkehr zu Gott, die Aufgabe und
Verantwortung des Dichters und Predigers. Lenz’ letzte
umfassende literarische Schrift Ȇber Delikatesse der
Empfindung« kehrt die Vorstellung einer zuvor angestrebten,
paradoxen rhetorica contra rhetoricam um. Sie
begegnet einer entstellten Sprache mit dem Gegengift
einer noch entstellteren Sprache. Konstant bleibt über
Lenz’ Werk und Biographie hinweg aber der Skrupel,
den Leser zu bekehren oder hofmeistern zu wollen.
Dichter und Prediger können zur Veränderung des Geistes
nur einladen.
Da bislang kaum ein Text von Lenz historisch-kritisch
ediert ist, greift die Studie überwiegend auf den jeweils
in Frage stehenden Materialzusammenhang selbst zurück.
Bestimmte Materialien werden im Anhang der
Studie erstmals mit Faksimile und zeichengenauer
Umschrift kritisch ediert. Neben den bisher in unzuverlässiger
Form publizierten Schriften existieren
in Lenz’ Nachlass auch viele noch gar nicht edierte
Manuskripte. Diese Studie nimmt an verschiedenen
Stellen auf dieses bisher unveröffentlichte Material –
auch auf den Nachlass Oberlins – Bezug. Der Einbezug
dieser Bestände sowie die Revision der bisherigen
Lenz-Edition erweitern das Verständnis von Lenz’ Biographie
und Werk in entscheidender Weise und bildet
zugleich die Grundlage für die interpretatorische Arbeit
der Studie.
Aktualisiert: 2019-03-15
> findR *
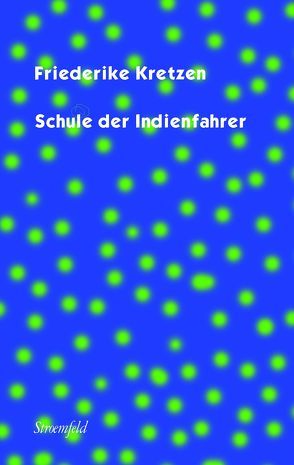
Ein Abend mit Engeln im Wald von Krofdorf, irgendwann
in den siebziger Jahren, es schneit, ein Film wird
gedreht.
So beginnt das Buch, das eine Schule ist. Wer in sie
eintritt, um den ist es geschehen. Denn die Schule der
Indienfahrer ist wie das Leben – verwirrend, ungewiss
und bis zuletzt gefährlich. Indien spielt dabei die Rolle
des Monds, jenem trügerischen Verdoppler der Liebe
und Sehnsucht. In seinem Licht mischen sich Zeiten,
Lieder, Erinnerungen, werden Tänze fortgesetzt, tote
Tiere leben auf, die Sterbenden sind da, wollen noch ein
bisschen bleiben, die Leichtsinnigen folgen ihren Liedern
und so fort. Wunderbar, sich in diesem Wirbel der
Zeiten, der Geschichten, der Träume und Täuschungen
auf ein Stück Himmelfahrt Richtung Osten mitnehmen
zu lassen. So bunt, so grausam, so schön, so entsetzlich.
Und immer wieder die Kinder, die von einst, die von
heute, die einem ans Herz gehen.
In 27 Lektionen begleiten wir die turbulente Lehre von
Véronique und Kamal, der alles filmt, von Abdul, der
mit den Freaks spricht, von Natascha, der Hüterin der
Feen, von Camille, die gerne ein Vampir gewesen wäre
und Helmudo, dem Ariel der Gruppe, dem irgendwann
im Leben das Zaubern vergangen ist.
Sie suchen ihre in Indien verschwundenen Freunde
Alexander und Günther, mit denen sie in Giessen in der
kleinsten Bäckerei der Welt das wilde Denken übten. So
lange ist das her. Nun sind Filme aufgetaucht, verschollen
geglaubte von Alexander, die in der Schweizer Botschaft
in Delhi gezeigt werden sollen. Sofort ist klar, da
müssen sie hin.
Eine weite Reise. Sie führt durch Gegenden, in denen
das Heimweh wohnt mit all seinen Gespenstern, den
alten Wächtern der Geschichte. Und was wie eine Reise
aussieht, ist die Zeit. In der sie noch immer vom Leben
zu lernen versuchen, von sich, von dem, was war und
das nicht aufgehört hat, zu ihnen zu sprechen. Was sie
finden, ist die Sehnsucht. Ihr folgen sie mit dem Gefühl
von einem ungeheuren Fehlen. Die Schule der Indienfahrer
ist eine Erfindung ihrer Schüler, damit es sie
eines
Tages gegeben haben wird.
Aktualisiert: 2019-03-15
> findR *
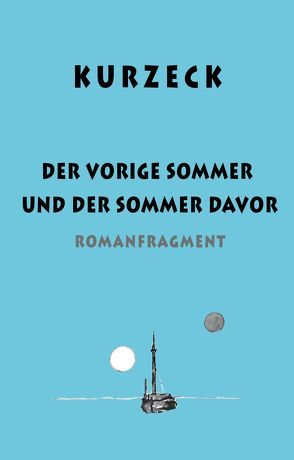
Es ist Herbst 1983, ein Morgen in der Jordanstraße in
Frankfurt-Bockenheim. Carina zieht sich für den Kinderladen
an, Sibylle in Jeans und dunkelblauem Pullover.
»Es klingelt. Keine Sprechanlage. Man drückt den Öffner
und fragt sich, wer kommt. Vierter Stock. Dachgeschoß.
Einzeln. Ein einzelner Mensch die Treppe herauf
und zur Tür herein. Mein Freund Jürgen. Müd sieht er
aus.«
Das »Sommerbuch« setzt da ein, wo Band 6 des Alten
Jahrhunderts, »Bis er kommt«, aufhören sollte.
Das Restaurant in Barjac hat Jürgen zurückgelassen,
gescheitert, eine Flucht. Und Pascale ist verschwunden.
Der Erzähler sitzt an seinem dritten Buch, ein
Buch über das Dorf seiner Kindheit (das 1987 als »Kein
Frühling« zum ersten Mal erscheinen sollte). Und dann
erzählt er uns den Sommer, in dem er schon im Juni
mit Sibylle und Carina nach Barjac trampte, erzählt von
dem Restaurant, dem Regenbogen, den er über die Tür
malte, und wie sie von Barjac per Anhalter über Arles
nach Saintes-Maries-de-la-Mer kamen. Erzählt von der
Camargue, den Pferden, dem Markt und den Geschäften,
den Schaufenstern und Bars in Saintes-Maries.
Von Carinas belgischer Freundin, von den Hippies und
den Zigeunern. Aber auch vom Sommer davor, auch in
Saintes-Maries, zusammen mit Jürgen und Pascale. Ein
Buch über den Süden und das Trampen, und dann den
Restsommer in Frankfurt, den griechischen Biergarten
in Bockenheim und den Ausflug ins Mainfränkische.
Peter Kurzeck schrieb an dem Text bereits Anfang der
2000er Jahre, geplant war das »Sommerbuch« als Nachfolgeband
zu »Als Gast« (2004). Er stellte das unvollendete
Typoskript aber zurück, als sich andere Erinnerungen
vordrängten.
Mit nachgelassenen Notizen zum Roman und einem
Nachwort der Herausgeber
Aktualisiert: 2019-03-15
> findR *
MEHR ANZEIGEN
Oben: Publikationen von Stroemfeld
Informationen über buch-findr.de: Sie sind auf der Suche nach frischen Ideen, innovativen Arbeitsmaterialien,
Informationen zu Musik und Medien oder spannenden Krimis? Vielleicht finden Sie bei Stroemfeld was Sei suchen.
Neben praxiserprobten Unterrichtsmaterialien und Arbeitsblättern finden Sie in unserem Verlags-Verzeichnis zahlreiche Ratgeber
und Romane von vielen Verlagen. Bücher machen Spaß, fördern die Fantasie, sind lehrreich oder vermitteln Wissen. Stroemfeld hat vielleicht das passende Buch für Sie.
Weitere Verlage neben Stroemfeld
Im Weiteren finden Sie Publikationen auf band-findr-de auch von folgenden Verlagen und Editionen:
Qualität bei Verlagen wie zum Beispiel bei Stroemfeld
Wie die oben genannten Verlage legt auch Stroemfeld besonderes Augenmerk auf die
inhaltliche Qualität der Veröffentlichungen.
Für die Nutzer von buch-findr.de:
Sie sind Leseratte oder Erstleser? Benötigen ein Sprachbuch oder möchten die Gedanken bei einem Roman schweifen lassen?
Sie sind musikinteressiert oder suchen ein Kinderbuch? Viele Verlage mit ihren breit aufgestellten Sortimenten bieten für alle Lese- und Hör-Gelegenheiten das richtige Werk. Sie finden neben