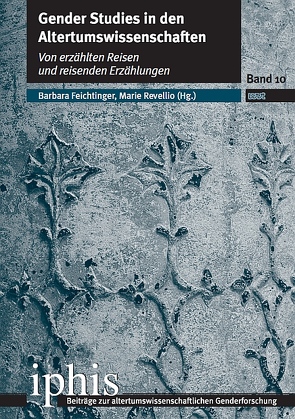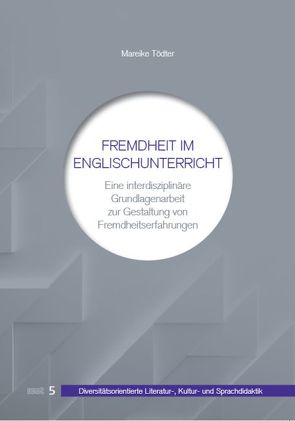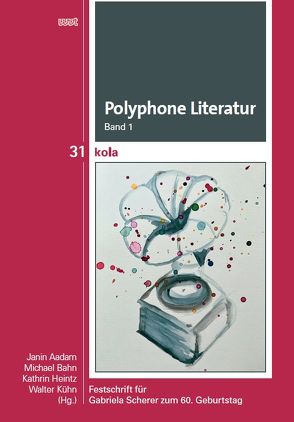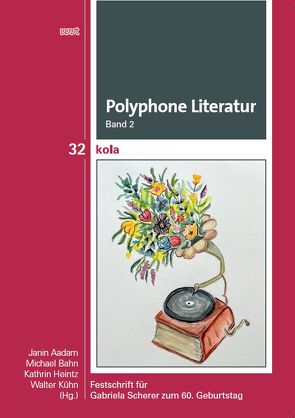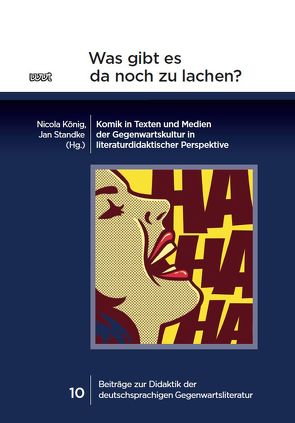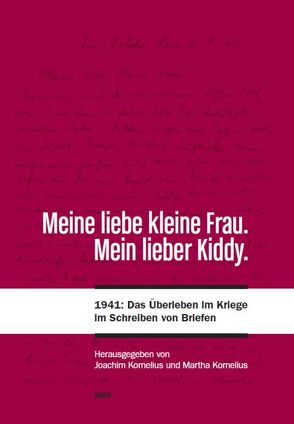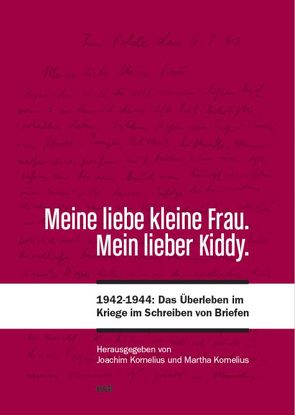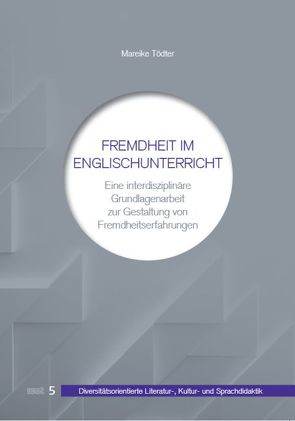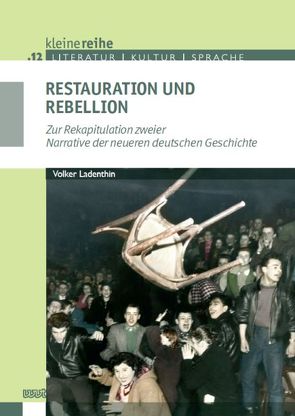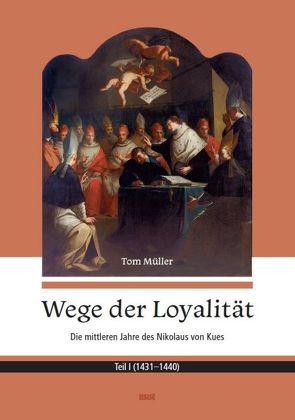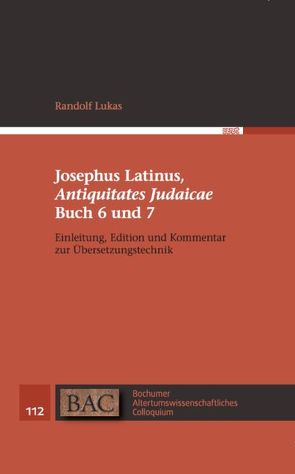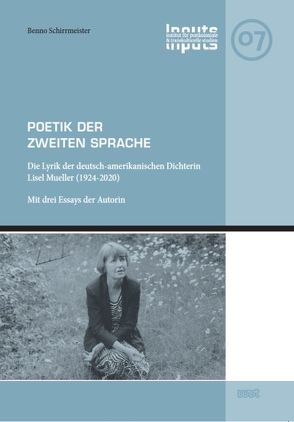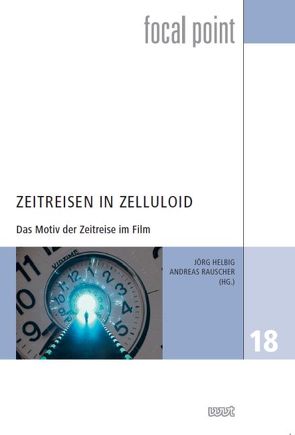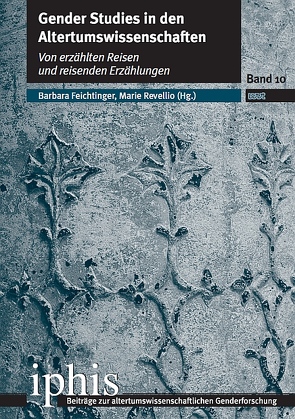
Die im vorliegenden Band enthaltenen neun Beiträge zur -Tagung 2018 in Konstanz spüren der literarisch-künstlerischen Ausgestaltung genderspezifischer Dimensionen von Reisebewegungen in der Antike nach. Die Beiträge sind multiparadigmatisch angeordnet, so werden neben Untersuchungen zur griechischen und lateinischen Literatur auch archäologische Perspektiven einbezogen sowie Ausblicke auf Theologie und Mediävistik hin eröffnet. Der zeitliche Horizont erstreckt sich von hellenistischen Siegesepigrammen bis hin zu volkssprachlichen Bearbeitungen der im Antikenroman des Mittelalters. Gemeinsam sind allen Beiträgen die Grundfragen des Bandes: Wie sind Genderstereotype und -spezifika des Reisens literarisch von den mehrheitlich männlichen Autoren ausgestaltet? Wie spiegeln sich darin die sich reproduzierenden gesellschaftlichen Verhältnisse jener Zeit? Wo und wie werden Freiräume von (antiken) Frauen literarisch erarbeitet? Die genderbezeichnende Motivik und ihre Funktionalität werden an automobilen Ptolemäerinnen und frühchristlichen Inschriften in Rom, im ovidischen Mythos und an Martials Epigrammen, in Tacitus‘ und spätantiken Philosophenbiographien, an werbewirksamen Pilgerreisen und im mittelalterlichen Epos analysiert.
BARBARA FEICHTINGER, MARIE REVELLIO
Einleitung ............................................................................................................... 1
ANNEMARIE AMBÜHL / PATRICK SCHOLLMEYER
Der Wagen der Berenike. Automobile Ptolemäerinnen in Text und Bild .............. 11
CHRISTINE WALDE
Arethusa rennt.
Mobile und immobile Frauen in Ovids und ................. 41
LISA CORDES
… . Zur literarischen Darstellung weiblichen Mitreisens ............ 81
JOACHIM FUGMANN
Mit Martial auf Reisen ......................... 101
MARIE REVELLIO
Agrippina die Ältere als reisende bei Tacitus ............................... 121
INGO SCHAAF
Reisen und Reisende in den frühchristlichen Inschriften aus Rom ........................ 145
FABIA NEUERBURG
Frauen auf dem Weg der Weisheit.
Frauen(figuren) und philosophische Reisen in den spätantiken Biographien ......... 167
BARBARA FEICHTINGER
Willkommen im Heiligen Land.
Zu Geschlechtsneutralität und Statusrelevanz von Hieronymus’ Pilgerwerbung ... 183
BENT GEBERT
. Bewegungswahrnehmung bei Vergil
und in den Eneasromanen des Mittelalters ............................................................. 225
Angaben zu den VerfasserInnen ............................................................................ 251
Aktualisiert: 2023-06-29
> findR *

Literatur kann die Vergangenheit aufleben lassen, indem sie zu einem durch Worte geformten ,Experimentierraum‘ wird. Das interaktive Potential von NS-Täterfiktionen, einem Subgenre der Gattung der Holocaust-Literatur, kann einen wichtigen erinnerungsstiftenden Beitrag zur individuellen Auseinandersetzung mit den NS-Tätern und Täterinnen leisten. Dieses Buch bietet eine vergleichende Analyse der Romane (1995) von Bernhard Schlink, (1995) von Marcel Beyer und (2019) von Martin Beyer, durch die das spezifische ,Interaktionspotential‘ dieser drei Texte herausgear-beitet wird. Durch die offene Erzählstruktur der Texte, die janusköpfige Täterfigurendarstel-lung, den Einsatz von intertextuellen Verweisen sowie Referenzen und Authentizitätsmarkern entfaltet sich ein besonderes appellatives Potential, durch das die Leserinnen und Leser in ein interaktives Leseerlebnis involviert werden, das eine kritische und ,explorative‘ Lesehaltung einfordert und Prozesse der Selbstpositionierung anstößt. Dadurch werden die Leserinnen und Leser in der Auseinandersetzung mit diesen Texten – ganz im Sinne Sartres – zur Einnahme einer autonomen und engagierten Lesehaltung angeregt.
Inhalt
0. Einleitung: Die textüberschreitende, interaktive Auseinandersetzung mit zeitgenössischen NS-Täterfiktionen durch ,Erinnerungshandeln‘ und ,Selbstpositionierung‘ 1
1. Holocaust-Erinnerung in Deutschland 16
1.1 Der Täterdiskurs in Deutschland: Eine zeitgeschichtliche Bestandsaufnahme 16
1.1.1 Der Täterdiskurs der unmittelbaren Nachkriegsjahre 21
1.1.2 Der Täterdiskurs von 1960 bis in die 1980er Jahre 28
1.1.3 Der Täterdiskurs ab 1990 36
1.2 Die ,Normalität‘ der NS-Täter? Psychosoziale Muster der NS-Täter 42
1.3 Entwicklung eines ,mehrdimensionalen‘ Täterbegriffs 69
1.4 Ausgangslage für die multikausal inspirierte Analyse der Täterfigurenkonzeption 83
2. Das Täterbild in der Literatur 86
2.1 Holocaust-Literatur 86
2.2 Die Blickwende zu den NS-Tätern und Täterinnen in der Literatur 101
2.3 Literaturwissenschaftlicher Forschungsstand 118
3. Das Interaktionspotential zeitgenössischer NS-Täterfiktionen:
Erzähltechnische und wirkungsästhetische Strategien 135
3.1 Appellfunktion der offenen Erzählstruktur 140
3.2 Inszenierung der Täterfigur 150
3.3 Dialogizität durch Intertextualität 158
3.4 Referenzen und Authentizitätsstrategien 161
4. Bernhard Schlink: (1995) 165
4.1 Appellfunktion der offenen Erzählstruktur 170
4.2 Inszenierung der NS-Täterin Hanna Schmitz 178
4.2.1 Analyse der janusköpfigen Täterfigurenkonzeption 180
4.2.2 Einordnung in die Tätertypologie 204
4.3 Dialogizität durch Intertextualität 219
4.4 Referenzen und Authentizitätsstrategien 244
5. Marcel Beyer: (1995) 251
5.1 Appellfunktion der offenen Erzählstruktur 256
5.2 Inszenierung des NS-Täters Hermann Karnau 260
5.2.1 Analyse der janusköpfigen Täterfigurenkonzeption 262
5.2.2 Einordnung in die Tätertypologie 291
5.3 Dialogizität durch Intertextualität 294
5.4 Referenzen und Authentizitätsstrategien 313
6. Martin Beyer: (2019) 329
6.1 Appellfunktion der offenen Erzählstruktur 336
6.2 Inszenierung des NS-Täters August Unterseher 343
6.2.1 Analyse der janusköpfigen Täterfigurenkonzeption 344
6.2.2 Einordnung in die Tätertypologie 371
6.3 Dialogizität durch Intertextualität 374
6.4 Referenzen und Authentizitätsstrategien 387
7. Fazit 400
8. Literaturverzeichnis 408
Aktualisiert: 2023-06-29
> findR *

Literatur kann die Vergangenheit aufleben lassen, indem sie zu einem durch Worte geformten ,Experimentierraum‘ wird. Das interaktive Potential von NS-Täterfiktionen, einem Subgenre der Gattung der Holocaust-Literatur, kann einen wichtigen erinnerungsstiftenden Beitrag zur individuellen Auseinandersetzung mit den NS-Tätern und Täterinnen leisten. Dieses Buch bietet eine vergleichende Analyse der Romane (1995) von Bernhard Schlink, (1995) von Marcel Beyer und (2019) von Martin Beyer, durch die das spezifische ,Interaktionspotential‘ dieser drei Texte herausgear-beitet wird. Durch die offene Erzählstruktur der Texte, die janusköpfige Täterfigurendarstel-lung, den Einsatz von intertextuellen Verweisen sowie Referenzen und Authentizitätsmarkern entfaltet sich ein besonderes appellatives Potential, durch das die Leserinnen und Leser in ein interaktives Leseerlebnis involviert werden, das eine kritische und ,explorative‘ Lesehaltung einfordert und Prozesse der Selbstpositionierung anstößt. Dadurch werden die Leserinnen und Leser in der Auseinandersetzung mit diesen Texten – ganz im Sinne Sartres – zur Einnahme einer autonomen und engagierten Lesehaltung angeregt.
Inhalt
0. Einleitung: Die textüberschreitende, interaktive Auseinandersetzung mit zeitgenössischen NS-Täterfiktionen durch ,Erinnerungshandeln‘ und ,Selbstpositionierung‘ 1
1. Holocaust-Erinnerung in Deutschland 16
1.1 Der Täterdiskurs in Deutschland: Eine zeitgeschichtliche Bestandsaufnahme 16
1.1.1 Der Täterdiskurs der unmittelbaren Nachkriegsjahre 21
1.1.2 Der Täterdiskurs von 1960 bis in die 1980er Jahre 28
1.1.3 Der Täterdiskurs ab 1990 36
1.2 Die ,Normalität‘ der NS-Täter? Psychosoziale Muster der NS-Täter 42
1.3 Entwicklung eines ,mehrdimensionalen‘ Täterbegriffs 69
1.4 Ausgangslage für die multikausal inspirierte Analyse der Täterfigurenkonzeption 83
2. Das Täterbild in der Literatur 86
2.1 Holocaust-Literatur 86
2.2 Die Blickwende zu den NS-Tätern und Täterinnen in der Literatur 101
2.3 Literaturwissenschaftlicher Forschungsstand 118
3. Das Interaktionspotential zeitgenössischer NS-Täterfiktionen:
Erzähltechnische und wirkungsästhetische Strategien 135
3.1 Appellfunktion der offenen Erzählstruktur 140
3.2 Inszenierung der Täterfigur 150
3.3 Dialogizität durch Intertextualität 158
3.4 Referenzen und Authentizitätsstrategien 161
4. Bernhard Schlink: (1995) 165
4.1 Appellfunktion der offenen Erzählstruktur 170
4.2 Inszenierung der NS-Täterin Hanna Schmitz 178
4.2.1 Analyse der janusköpfigen Täterfigurenkonzeption 180
4.2.2 Einordnung in die Tätertypologie 204
4.3 Dialogizität durch Intertextualität 219
4.4 Referenzen und Authentizitätsstrategien 244
5. Marcel Beyer: (1995) 251
5.1 Appellfunktion der offenen Erzählstruktur 256
5.2 Inszenierung des NS-Täters Hermann Karnau 260
5.2.1 Analyse der janusköpfigen Täterfigurenkonzeption 262
5.2.2 Einordnung in die Tätertypologie 291
5.3 Dialogizität durch Intertextualität 294
5.4 Referenzen und Authentizitätsstrategien 313
6. Martin Beyer: (2019) 329
6.1 Appellfunktion der offenen Erzählstruktur 336
6.2 Inszenierung des NS-Täters August Unterseher 343
6.2.1 Analyse der janusköpfigen Täterfigurenkonzeption 344
6.2.2 Einordnung in die Tätertypologie 371
6.3 Dialogizität durch Intertextualität 374
6.4 Referenzen und Authentizitätsstrategien 387
7. Fazit 400
8. Literaturverzeichnis 408
Aktualisiert: 2023-06-22
> findR *

Literatur kann die Vergangenheit aufleben lassen, indem sie zu einem durch Worte geformten ,Experimentierraum‘ wird. Das interaktive Potential von NS-Täterfiktionen, einem Subgenre der Gattung der Holocaust-Literatur, kann einen wichtigen erinnerungsstiftenden Beitrag zur individuellen Auseinandersetzung mit den NS-Tätern und Täterinnen leisten. Dieses Buch bietet eine vergleichende Analyse der Romane (1995) von Bernhard Schlink, (1995) von Marcel Beyer und (2019) von Martin Beyer, durch die das spezifische ,Interaktionspotential‘ dieser drei Texte herausgear-beitet wird. Durch die offene Erzählstruktur der Texte, die janusköpfige Täterfigurendarstel-lung, den Einsatz von intertextuellen Verweisen sowie Referenzen und Authentizitätsmarkern entfaltet sich ein besonderes appellatives Potential, durch das die Leserinnen und Leser in ein interaktives Leseerlebnis involviert werden, das eine kritische und ,explorative‘ Lesehaltung einfordert und Prozesse der Selbstpositionierung anstößt. Dadurch werden die Leserinnen und Leser in der Auseinandersetzung mit diesen Texten – ganz im Sinne Sartres – zur Einnahme einer autonomen und engagierten Lesehaltung angeregt.
Inhalt
0. Einleitung: Die textüberschreitende, interaktive Auseinandersetzung mit zeitgenössischen NS-Täterfiktionen durch ,Erinnerungshandeln‘ und ,Selbstpositionierung‘ 1
1. Holocaust-Erinnerung in Deutschland 16
1.1 Der Täterdiskurs in Deutschland: Eine zeitgeschichtliche Bestandsaufnahme 16
1.1.1 Der Täterdiskurs der unmittelbaren Nachkriegsjahre 21
1.1.2 Der Täterdiskurs von 1960 bis in die 1980er Jahre 28
1.1.3 Der Täterdiskurs ab 1990 36
1.2 Die ,Normalität‘ der NS-Täter? Psychosoziale Muster der NS-Täter 42
1.3 Entwicklung eines ,mehrdimensionalen‘ Täterbegriffs 69
1.4 Ausgangslage für die multikausal inspirierte Analyse der Täterfigurenkonzeption 83
2. Das Täterbild in der Literatur 86
2.1 Holocaust-Literatur 86
2.2 Die Blickwende zu den NS-Tätern und Täterinnen in der Literatur 101
2.3 Literaturwissenschaftlicher Forschungsstand 118
3. Das Interaktionspotential zeitgenössischer NS-Täterfiktionen:
Erzähltechnische und wirkungsästhetische Strategien 135
3.1 Appellfunktion der offenen Erzählstruktur 140
3.2 Inszenierung der Täterfigur 150
3.3 Dialogizität durch Intertextualität 158
3.4 Referenzen und Authentizitätsstrategien 161
4. Bernhard Schlink: (1995) 165
4.1 Appellfunktion der offenen Erzählstruktur 170
4.2 Inszenierung der NS-Täterin Hanna Schmitz 178
4.2.1 Analyse der janusköpfigen Täterfigurenkonzeption 180
4.2.2 Einordnung in die Tätertypologie 204
4.3 Dialogizität durch Intertextualität 219
4.4 Referenzen und Authentizitätsstrategien 244
5. Marcel Beyer: (1995) 251
5.1 Appellfunktion der offenen Erzählstruktur 256
5.2 Inszenierung des NS-Täters Hermann Karnau 260
5.2.1 Analyse der janusköpfigen Täterfigurenkonzeption 262
5.2.2 Einordnung in die Tätertypologie 291
5.3 Dialogizität durch Intertextualität 294
5.4 Referenzen und Authentizitätsstrategien 313
6. Martin Beyer: (2019) 329
6.1 Appellfunktion der offenen Erzählstruktur 336
6.2 Inszenierung des NS-Täters August Unterseher 343
6.2.1 Analyse der janusköpfigen Täterfigurenkonzeption 344
6.2.2 Einordnung in die Tätertypologie 371
6.3 Dialogizität durch Intertextualität 374
6.4 Referenzen und Authentizitätsstrategien 387
7. Fazit 400
8. Literaturverzeichnis 408
Aktualisiert: 2023-06-22
> findR *
Aktualisiert: 2023-06-20
> findR *
Aktualisiert: 2023-06-20
> findR *
Aktualisiert: 2023-06-20
> findR *
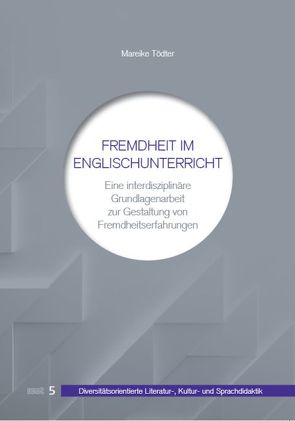
Bereits der Begriff des „Fremdsprachenunterrichts“ suggeriert, dass Fremdheit ein konstitutives Konzept im Sprachunterricht darstellt. Aber was ist das Fremde beim Sprachenlernen überhaupt? Und mit welchen Zielen ist ein Umgang damit verknüpft? Mit diesen zentralen Fragen befasst sich die vorliegende Forschungsarbeit und entwirft unter Rückgriff auf philosophische, soziologische und fachdidaktische Theorien ein Verständnis von Fremdheit, das an vorhandene Ideen der Sprachdidaktik anknüpft und diese weiterentwickelt, um die Gefahr von Stereotypisierungen zu vermeiden. Im zweiten Teil des Buches werden die theoretischen Konzepte zu Fremdheit schließlich in konkrete Prinzipien für die Unterrichtspraxis übersetzt. Auf Basis von Erkenntnissen aus psychologischen Studien, sprachdidaktischer Theorie und Empirie sowie der Expertise von Lehrkräften schlägt die Studie ein Modell vor, wie Fremdheit im Englischunterricht integriert und inszeniert werden kann, ohne dass Fremdheit dabei einer bestimmten Gruppe zugeschrieben wird.
INHALT
1 Einleitung 1
2 Ausgangslage: Fremdheit als umkämpfter Begriff und potenziell spaltendes Phänomen im 21. Jahrhundert 7
TEIL I: EINE BESTIMMUNG VON FREMDHEIT UND DEM UMGANG MIT FREMDEM IM ENGLISCHUNTERRICHT 13
3 Mit Fokus auf das Fremde – die Suche nach einem Begriffsverständnis für den 'Fremdsprachenunterricht' 15
3.1 Eine soziologische, kulturwissenschaftliche und philosophische Annäherung an die Begriffe 'Fremdheit' und 'Fremde*r' 15
3.1.1 Fremdheit als Fremdheitszuschreibung 16
3.1.2 Fremdheit als bestimmtes Beziehungsverhältnis 18
3.1.3 Überlegungen zu der Figur des Fremden: Rolle und Funktion 20
3.1.4 Fremdheit als Fremdheitserfahrung 25
3.2 Die Begegnung mit dem 'Fremden' im 'Fremdsprachenunterricht' – Grundlegende Überlegungen zu Beginn 28
3.3 Das Fremde im Englischunterricht anders gedacht – Überblick über den Stand der Theoretisierung des Fremden in der Englischdidaktik 34
4 Erfahrungen als Zugriffspunkt für Fremdheit: Ausdifferenzierung und Begründung des Konzepts und eines damit verfolgten didaktischen Ziels 42
4.1 Begründung der Bestimmung von Fremdheit als Erfahrung – Fremdheitserfahrungen als Chance im Englischunterricht 42
4.2 Welcher Umgang mit Fremdheit – Herleitung einer begründeten Zielbestimmung für den Englischunterricht 48
4.2.1 Normative Grundlagen aus der Philosophie und der Politischen Theorie 48
4.2.2 Umgang mit Fremdheit in der Sprachdidaktik – Annahmen und Erkenntnisse im Lichte der normativen Grundlagen 67
4.3 Fremdheitserfahrungen als Anlass für Aushandlungsprozesse – Herleitung einer Zielbestimmung, ihre Begründung und mögliche Anschlusspunkte 79
5 Zwischenstand: Fremdheitserfahrungen im Englischunterricht und die sich für Teil II der Forschungsarbeit ergebende Fragestellung 93
TEIL II: DIE INSZENIERUNG VON FREMDHEIT IM ENGLISCHUNTERRICHT 103
6 Vorgehensweise bei der Beantwortung der dritten Forschungsfrage 105
7 Definition von Inszenierungsprinzipien 111
8 Baustein A: Exploration der fachspezifischen Erkenntnisse über Inszenierungsprinzipien von Fremdheitserfahrungen im Englischunterricht 117
8.1 Untersuchung konzeptioneller Ansätze in der Sprachdidaktik 117
8.1.1 Analyse von 'Hans Hunfeld (2004): Skeptische Hermeneutik' 121
8.1.2 Analyse von 'Nicola Mitterer (2016): Responsive Literaturdidaktik' 132
8.1.3 Analyse von 'Stephan Breidbach (2007): Eine Reflexive Didaktik für den bilingualen Sachfachunterricht' 144
8.1.4 Analyse von 'Thorsten Merse (2017): Queere Perspektiven auf den Englischunterricht' 163
8.1.5 Analyse von 'Jochen Plikat (2017) – Fremdsprachliche Diskursbewusstheit' 178
8.2 Untersuchung empirischer Studien in der Sprachdidaktik 188
8.2.1 Wie Fremdheitserfahrungen inszeniert werden können 189
8.2.2 Wie Schüler*innen unterschiedlich mit Irritationen umgehen 199
8.2.3 Wie Aushandlungsprozesse inszeniert werden können 202
9 Baustein B: Exploration der Rahmenbedingungen einer Inszenierung von Fremdheitserfahrungen 215
9.1 Analyse der individuellen Ebene – Psychologische Erkenntnisse zur Verarbeitung von Dissonanzen und zum Umgang mit Stereotypen 215
9.1.1 Wann Fremdheitserfahrungen (nicht) entstehen 216
9.1.2 Wie Menschen (unterschiedlich) mit Irritationen umgehen 236
9.1.3 Wie Aushandlungsprozesse in der Gruppe Fremdheitserfahrungen und deren Versprachlichung beeinflussen können 242
9.1.4 Bewertung und Einordnung der aus psychologischen Studien generierten Inszenierungsprinzipien 245
9.2 Analyse der institutionellen Ebene – Umgang mit Fremdheitserfahrungen im schulischen Kontext 252
10 Baustein C: Exploration des Erfahrungswissens von Expert*innen der Unterrichtspraxis 262
10.1 Lehrkräfte als Expert*innen der Praxis und von Unterrichtsplanung 262
10.1.1 Expert*inneninterviews als Erhebungsform 263
10.1.2 Die Expertise von Lehrkräften 264
10.2 Die Datenerhebung 266
10.2.1 Erstellung und Einsatz des Leitfadens 267
10.2.2 Datenerhebung und Zugang zum Feld 269
10.3 Auswertung der Interviews 270
10.3.1 Auswertungsmethode(n) 270
10.3.2 Einschätzung der Expertisegrade 274
10.3.3 Ergebnisse der thematischen Analyse 275
10.3.4 Diskussion der Ergebnisse 304
10.3.4.1 Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse 304
10.3.4.2 Formulierung der Ergebnisse in Inszenierungsprinzipien 307
10.3.4.3 Limitationen und Stärken der Studie 311
11 Modellbildung auf Grundlage der vorherigen Untersuchungen 313
11.1 Die Meta-Prinzipien festlegen als Antwort auf die beiden Forschungsunterfragen 314
11.2 Die Meta-Prinzipien durch pragmatische und spezifische Prinzipien konkretisieren und ausdifferenzieren 320
11.2.1 Meta-Prinzip: Komplexe Perspektivierungen bei den Schüler*innen fördern und die Schüler*innen beim Aushalten von daraus entstehenden Konflikten unterstützen 321
11.2.2 Meta-Prinzip: Die Aushandlungen im Unterricht bilden ein eigenständiges Verstehensgespräch 332
11.2.3 Meta-Prinzip: Die schüler*innenseitigen Erfahrungen des Gegenstandes und dadurch auch die individuellen Hintergründe der Schüler*innen leiten das Unterrichtsgespräch 340
11.2.4 Meta-Prinzip: Die Aufmerksamkeit der Schüler*innen für die Wahrnehmung des Widersprüchlichen und des Irritierenden schulen 347
11.3 Darstellung des entwickelten Modells 353
11.4 Überblick über nicht in das Modell übernommene Prinzipien 355
12 Fazit und Ausblick 357
13 Bibliographie 364
14 Anhang 392
Aktualisiert: 2023-05-18
> findR *
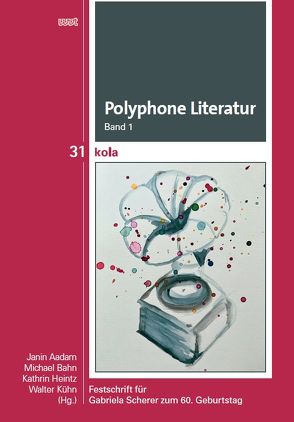
Produktion oder Rezeption von Literatur gleichsam mehrere Stimmen miteinander in Dialog treten, steht im Mittelpunkt des Forschungsinteresses von Gabriela Scherer. Als Literaturwissenschaftlerin und Literaturdidaktikerin nimmt sie unterschiedliche Perspektiven ein. Ihrem 60. Geburtstag ist die vorliegende Festschrift gewidmet.
Polyphonie ist eine Form von Polyvalenz, die eines der zentralen Merkmale von Literatur darstellt. Sie resultiert aus unterschiedlichen formalen und ästhetischen Eigenheiten, aber auch aus den Erzählinhalten und medialen Konzeptionen literarischer Werke. Ein literarischer Text spricht mit verschiedenen Stimmen, die wiederum in eine polyphone Interpretation überführt werden können. In multimodalen Werken wie Bilderbüchern oder Graphic Novels evoziert das gemeinsame Erzählen von Text und Bild mit je eigenen Mitteln Polyphonie, die in den Wahrnehmungsfokus von Rezipient*innen rückt und spürbar macht, dass jeder Rezeptionsprozess eine aktive Interpretationsleistung fordert. Dies zeigt sich insbesondere auch dort, wo die Vielstimmigkeit medialer Adaptionen literarischer Werke (z. B. bei Theaterinszenierungen oder Vertonungen) im Produktions- und Rezeptionsprozess eine wesentliche Rolle spielt. Nicht zuletzt begegnet uns die Stimmenvielfalt in Kontexten der alltäglichen wie medialen Kommunikation.
Mehrstimmig sind auch die Beiträge beider Bände, die belegen, wie facettenreich und in höchstem Maße anschlussfähig für alle Disziplinen der Begriff der Polyphonie ist.
Inhalt
Vorwort 1
Frank Barsch
Die meisten Menschen haben einen Schnupfen. Verstehen, Erzählen, Interpretieren – ein polyphoner Essay 7
Literatur des 19. Jahrhunderts
Walter Kühn
Grüße an Vortreffliche – Karoline von Günderrodes lyrisches Herrscher-, Dichter- und Liebeslob (1799-1805) 17
Lothar Bluhm
„der Esel schrie, der Hund bellte, die Katze miaute, und der Hahn krähte“ – Polyphonie in den am Beispiel von KHM 27 33
Walter Grünzweig
Feminism, Workies and Popular Novels: Charles Sealsfield’s New York City at the Beginning of the Jacksonian Era 55
Literatur des 20. Jahrhunderts
Hans Lösener
Briefgespenster. Kafka und die unheimliche Wahrhaftigkeit der Schrift 67
Björn Bühner
„Betrug und List! Das ist mir ein Chronist!“ Zur Funktion der Polyphonie in Heimito von Doderers 81
Wynfrid Kriegleder
Eine Love-Story in den Zeiten des Weltkriegs. Grete Hartwig-Manschingers Roman (1948) 91
Steffen Volz
Gewalt und Gewalterfahrungen im Werk Anna Seghers’ 103
Bettina Bannasch
Nicht für das Leben, sondern für die Schule lernen wir. Narrative Verfahren der Inversion und Polyphonie in Ilse Aichingers Roman 117
Ben Dammers
Die Polyphonie syndiegetischer Zeichen in S von J. J. Abrams und Doug Dorst 129
Literaturadaptionen und Inszenierungen
Hiroko Nishiguchi
Ohne Vorlage keine Nachbildung. Englische Grimm-Ausgaben im Spiegel japanischer Übersetzungen der 151
Michael Bahn
Theodor Storms . polyphon 171
Janin Aadam
Polyphonie in Literatur und Film. Mehrstimmiges Erzählen in Fontanes und Fassbinders Verfilmung 187
Ralph Olsen
Heterophone Formen des chorischen Sprechens im zeitgenössischen Theater 199
Literatur- und kunstdidaktische Überlegungen
Michael Staiger
Was machen die Medien mit der (Buch-)Literatur? Formen der (Inter-)Medialisierung im Roman und ihr literatur-didaktisches Potenzial 215
Melanie Wigbers
Ein Gespräch zwischen den Texten. Intertextualität als didaktische Chance am Beispiel ausgewählter Erzählungen Christa Wolfs 233
Stephan Merten
Polyphones Unterrichten – ein innovatives Konzept für den Deutschunterricht? 245
Tina Stolt
Wie gut kennen Kunststudent*innen aus Chabarowsk (Sibirien) und Landau (Pfalz) Joseph Beuys? Ein Versuch… 261
Aktualisiert: 2023-04-27
> findR *
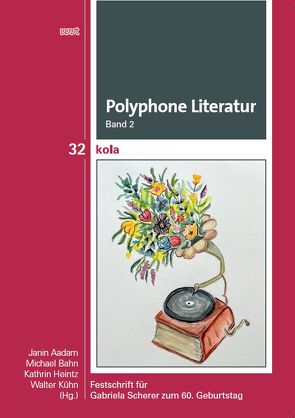
Produktion oder Rezeption von Literatur gleichsam mehrere Stimmen miteinander in Dialog treten, steht im Mittelpunkt des Forschungsinteresses von Gabriela Scherer. Als Literaturwissenschaftlerin und Literaturdidaktikerin nimmt sie unterschiedliche Perspektiven ein. Ihrem 60. Geburtstag ist die vorliegende Festschrift gewidmet.
Polyphonie ist eine Form von Polyvalenz, die eines der zentralen Merkmale von Literatur darstellt. Sie resultiert aus unterschiedlichen formalen und ästhetischen Eigenheiten, aber auch aus den Erzählinhalten und medialen Konzeptionen literarischer Werke. Ein literarischer Text spricht mit verschiedenen Stimmen, die wiederum in eine polyphone Interpretation überführt werden können. In multimodalen Werken wie Bilderbüchern oder Graphic Novels evoziert das gemeinsame Erzählen von Text und Bild mit je eigenen Mitteln Polyphonie, die in den Wahrnehmungsfokus von Rezipient*innen rückt und spürbar macht, dass jeder Rezeptionsprozess eine aktive Interpretationsleistung fordert. Dies zeigt sich insbesondere auch dort, wo die Vielstimmigkeit medialer Adaptionen literarischer Werke (z. B. bei Theaterinszenierungen oder Vertonungen) im Produktions- und Rezeptionsprozess eine wesentliche Rolle spielt. Nicht zuletzt begegnet uns die Stimmenvielfalt in Kontexten der alltäglichen wie medialen Kommunikation.
Mehrstimmig sind auch die Beiträge beider Bände, die belegen, wie facettenreich und in höchstem Maße anschlussfähig für alle Disziplinen der Begriff der Polyphonie ist.
Inhalt
Tina Stolt
…, Fotografie, 2021 271
Interpretatorische Überlegungen zur Analyse von (Bildern in) Bild-Text-Gefügen
Gina Weinkauff
. Überlegungen zur Analyse erzählender Bilderbücher 275
Bettina Uhlig
Madame Butterfly und die Hexe. Zur Darstellung von Frauenfiguren in den Bilderbüchern von Susanne Janssen 293
Gabriele Lieber
Dem Bild auf der Spur. Zur Vielfalt künstlerischer Gestaltungsmittel im Bilderbuch von Verena Hochleitner 303
Didaktische Zugänge zu Bild-Text-Gefügen
Klarissa Schröder
Kindliche Bildpräferenz und literar-ästhetisches Lernpotenzial. Eine erste Klasse erkundet konventionell und ästhetisch komplex gestaltete Schneewittchen-Bilderbücher 317
Maike Jokisch-Casas und Jessica Vogt
Die Stimmen der Geschichte – Literarhistorisches Lernen mit der Comic-Biographie 337
Johanna Duckstein
Sich verlieren und finden. Kinder rezipieren das Bilderbuch 351
Hilal Erkan und Verena Riffel
„Wie kann man begreifen, wer man ist, wenn man nicht versteht, woher man kommt?“ Autobiografisches Lernen anhand von Nora Krugs Graphic Memoir 369
Christiane Hänny und Kathrin Heintz
– ein synästhetisch und mehrsinnlich erzählendes Bilderbuch und sein Potenzial im Deutschunterricht der Grundschule 385
Alexandra Ritter und Michael Ritter
Die Welt im Wandel. Zukunftskonstruktionen im (Sach-)Bilderbuch 405
Christian Müller
Vom Hören und Sehen von Onomatopoetika. Die Polyphonie des Wassers in Sprache und Bild 423
Multimodalität in pragmatischen Texten, Alltagssprache und -kommunikation
Svenja Hermes und Katharina Turgay
Kultur und Sprache im Schulbuch. Eine qualitative Untersuchung 441
Katharina Turgay
Multimodalität bei digitalen Minimal-Narrationen 459
Gökhan Özkayin
Polyphonie und Evidentialität. Eine interkategoriale Betrachtung des Türkeitürkischen Suffix -mXş 471
Andreas Osterroth
Internet-Memes als polyphone Texte – Vielstimmigkeit als Konstitutionsmerkmal 487
Björn Hayer und Jan Georg Schneider
Der einsame Weltenretter. Semiotische Analysen zu Wahlwerbespots der FDP 501
Aktualisiert: 2023-04-27
> findR *
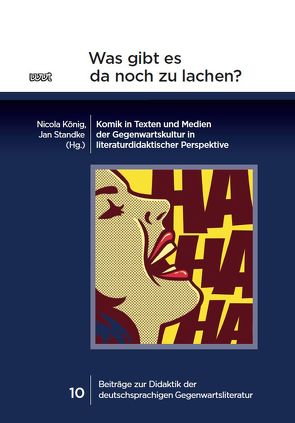
Das Komische ist seit jeher in unterschiedlicher Erscheinung und Komplexität in den verschiedensten medialen Genres anzutreffen und weist vor allem in literarischen Texten eine große Bandbreite an Realisierungsformen auf. Komik stellt dabei auch eine besondere Qualität der Gegenwartskultur dar. Eine Antwort auf die Frage, worüber sich in zeitgenössischen Texten noch lachen lässt, erfordert es, die Formen, die Funktion und die Bedingungen der Produktion von Komik zu berücksichtigen. Um sich dem Komischen anzunähern, müssen also jeweils sowohl das Objekt – was ist komisch und worüber lachen wir – als auch das Subjekt – wer reagiert wie auf das Komische – mitgedacht werden. Komik ist demnach ohne ihre Wirkung nicht denkbar. Was jedoch eine Gesellschaft und im engeren Sinne Autor*innen bzw. Leser*innen als komisch empfinden und worüber sie lachen, ist aufgrund des Wandels von Normen und Konventionen Veränderungen unterworfen. Die Beiträge des vorliegenden Bandes setzen am aktuellen Forschungstand an und fragen nach Inszenierungs- und Repräsentationsformen der Komik in gegenwartsliterarischen Texten sowie anderen Medien und diskutieren literaturdidaktische Perspektiven für den Deutschunterricht.
Die Herausgeber
PD Dr. Nicola König ist Privatdozentin für Neuere deutsche Literatur und ihre Didaktik am Institut für Neuere deutsche Philologie der Philipps-Universität Marburg und an der Hessischen Lehrkräfteakademie im Bereich Bildungssprache tätig.
Prof. Dr. Jan Standke ist Inhaber des Lehrstuhls für Didaktik der deutschen Literatur an der Technischen Universität Braunschweig.
INHALTSVERZEICHNIS
Was gibt es da noch zu lachen? Komik in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, der Literaturdidaktik und im Literaturunterricht 1
NICOLA KÖNIG & JAN STANDKE
KOMIK UND KINDERLITERATUR
Ein Nachhall der Lachkultur der Renaissance. Versuch über schwankhaft-karnevaleske Kinderliteratur 13
HANS-HEINO EWERS
Darf man über eine „alte, einäugige Pfaffenhur“ lachen? Komik in Clemens J. Setz’ Bearbeitung der 13. Historie aus dem Schwankroman 27
KARIMA LANIUS
Komik kompliziert. Literaturdidaktische Wege und Abwege für das Lesen empfehlenswerter Kinderbücher 37
SABINE ZELGER
Vom zum oder warum Gedichte von Nils Mohl Lust auf Lyrik machen 57
ANJA SIEGER
Ein ‚Exerzitium der praktischen Kritik‘. Komik in den Kinderbilderbüchern von Marc-Uwe Kling und Astrid Henn 75
THOMAS BOYKEN
Komik am Abgrund. Tragikomik als Epochensignatur in aktuellen Kinderromanen Andreas Steinhöfels, Finn-Ole Heinrichs und Kirsten Boies 91
ANDREAS WICKE & NILS LEHNERT
Komik als Instrument der Enttabuisierung des Todes in der Kinder- und Jugendliteratur. Eine beispielhafte Analyse von (Finn-Ole Heinrich/Rán Flygenring) und (Patrick Ness/Siobhan Dowd) 107
LENA STASKEWITSCH
„Papa ist der Chef, Mama ist der Boss und wir zwei sind die, die alles besser wissen.“ Komische Familienbilder in aktuellen Comics für Kinder. Potentiale für den Literaturunterricht der Primarstufe 121
SUSANNE DROGI
KOMIK UND JUGENDLITERATUR
Flüchtiges Lachen. Möglichkeiten des dominanzkritischen Erzählens von Flucht und Ankunft durch komische Verfahrensweisen 139
MARTINA KOFER
Komik inklusiv(e).
Tobias Steinfelds Förderschulroman als komikgestützte Anleitung zu einer inklusiven Haltung 157
INES HEISER
Das Komische als Entlastungs- und Bewältigungsstrategie in Texten der Jugendliteratur. Anmerkungen zu Mikael Engströms und Erna Sassens 169
PIA-MAREN MOHR & FRANZISKA PLETTENBERG
Versuch über die Leichtigkeit. Komik als poetische Bewältigungsstrategie im Umgang mit der Schwere des Aufwachsens in den Romanen von Stefanie Höfler, Mark Lowery und Manja Präkels 185
NICOLA KÖNIG
Können wir den Schluss nochmal machen? Zur Komik in Kinder- und Jugenddramen 201
ANKE CHRISTENSEN
KOMIK IN UNTERSCHIEDLICHEN MEDIEN DER GEGENWARTSKULTUR
Komik in den Hörspielen und deren Potenziale für die Anbahnung literarästhetischer Lernprozesse 221
SEBASTIAN BERNHARDT
Grauen und Lachen. Das Groteske als ästhetische Präferenz der Jugendkultur und Thema für den Deutschunterricht 235
ANNE UHRMACHER
Von „Kakanien“ zur „Alpen-Türkei“. Satirisches zum Österreich-Bild im Wandel der Zeit 257
GEORG HUEMER
„Humor ist, wenn man trotzdem lacht?“ Memes zwischen Meinungsfreiheit, Fragen der Moral und Manipulation 275
SABINE ANSELM & EVA HAMMER-BERNHARD
Wahrnehmen von Missverhältnissen. Inkongruenzkomik in Fernsehserien zur Förderung literarischen Lernens 295
MAGDALENA KIßLING
Über die Autor*innen 315
Aktualisiert: 2023-04-27
> findR *
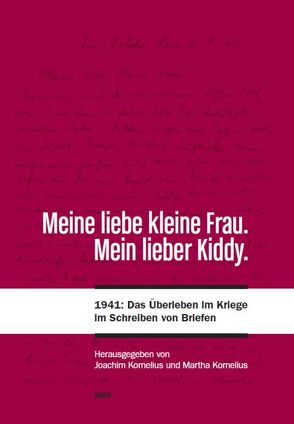
1941: Das Überleben im Kriege im Schreiben von Briefen“ ist eine Sammlung von Privatbriefen eines jungen Ehepaares aus dem Jahr 1941.
Die Briefe vermitteln authentische Einblicke in eine aus den Fugen geratene Welt. Mit Liebesbriefen suchen Hella und Heinz gegen das aufziehende Chaos anzuschreiben, sie schreiben, um zusammenzubleiben. Sie haben sich versprochen, wann immer sie können, zu schreiben. Die Textfunktion dieser Liebesbriefe liegt darin, sich und den Ehepartner zu erhalten und über ein konstantes Schreiben mental ein Zusammensein aufzubauen und eine Nähe aufrechtzuerhalten. Es ist der Versuch, eine virtuelle Realität zu erschaffen, in der sich ihre alte, untergehende Welt spiegelt. Diese Kunstwelt konstituiert sich über ein anhaltendes schreibendes Sprechen und erhält sich auch über eine zusätzliche taktile Dimension, wenn Heinz von Hella Hunderte von Feldpost-Päckchen, teils nur mit bis zu 100 Gramm Inhalt, erhält, die Tausende von Kilometern auf die Reise gehen, um ihn mit angeforderten, schwer zu beschaffenden, da rationierten Basisartikeln des Lebens zu versorgen: so mit Rasierwasser, Fettcreme, Kniewärmern, Socken, Zeitschriften oder Schreibpapier – und immer wieder mit Zigaretten.
Es handelt sich also um historische, authentische, unbehandelte Texte, es sind Liebesbriefe gefasst in einem .
Aktualisiert: 2023-04-03
> findR *
Im Kriegsjahr 1941 haben Hella und Heinz über eine große Zahl von Briefen, Briefkarten und Päckchensendungen eine anhaltende, in Kriegszeiten vergleichsweise stabile private Kommunikation aufgebaut, die sie in den folgenden Jahren fortsetzen. Mit der Organisation der Briefe, der Beschaffung und dem Versand der zahlreichen, von Heinz an der Front, im Lazarett und im Ersatzbataillon erbetenen Bedarfsartikel und Lebensmittel ist vor allem Hella befasst. Sie sichert die Korrespondenz über die Feldpost als neue gemeinsame Lebensroutine der getrennten Ehepartner neben ihrer beruflichen Tätigkeit im Konfektionsgeschäft ihres Vaters. Die Liebesbriefe haben sich erhalten, sie vermitteln authentische Einblicke in die Wirren des Krieges in einer untergehenden Zeit.
Aktualisiert: 2023-04-03
> findR *
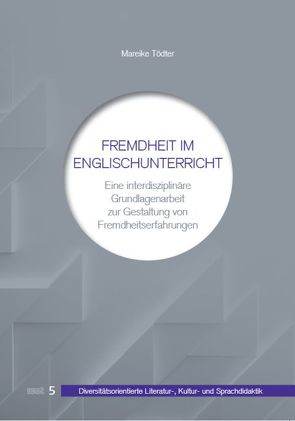
Bereits der Begriff des „Fremdsprachenunterrichts“ suggeriert, dass Fremdheit ein konstitutives Konzept im Sprachunterricht darstellt. Aber was ist das Fremde beim Sprachenlernen überhaupt? Und mit welchen Zielen ist ein Umgang damit verknüpft? Mit diesen zentralen Fragen befasst sich die vorliegende Forschungsarbeit und entwirft unter Rückgriff auf philosophische, soziologische und fachdidaktische Theorien ein Verständnis von Fremdheit, das an vorhandene Ideen der Sprachdidaktik anknüpft und diese weiterentwickelt, um die Gefahr von Stereotypisierungen zu vermeiden. Im zweiten Teil des Buches werden die theoretischen Konzepte zu Fremdheit schließlich in konkrete Prinzipien für die Unterrichtspraxis übersetzt. Auf Basis von Erkenntnissen aus psychologischen Studien, sprachdidaktischer Theorie und Empirie sowie der Expertise von Lehrkräften schlägt die Studie ein Modell vor, wie Fremdheit im Englischunterricht integriert und inszeniert werden kann, ohne dass Fremdheit dabei einer bestimmten Gruppe zugeschrieben wird.
INHALT
1 Einleitung 1
2 Ausgangslage: Fremdheit als umkämpfter Begriff und potenziell spaltendes Phänomen im 21. Jahrhundert 7
TEIL I: EINE BESTIMMUNG VON FREMDHEIT UND DEM UMGANG MIT FREMDEM IM ENGLISCHUNTERRICHT 13
3 Mit Fokus auf das Fremde – die Suche nach einem Begriffsverständnis für den 'Fremdsprachenunterricht' 15
3.1 Eine soziologische, kulturwissenschaftliche und philosophische Annäherung an die Begriffe 'Fremdheit' und 'Fremde*r' 15
3.1.1 Fremdheit als Fremdheitszuschreibung 16
3.1.2 Fremdheit als bestimmtes Beziehungsverhältnis 18
3.1.3 Überlegungen zu der Figur des Fremden: Rolle und Funktion 20
3.1.4 Fremdheit als Fremdheitserfahrung 25
3.2 Die Begegnung mit dem 'Fremden' im 'Fremdsprachenunterricht' – Grundlegende Überlegungen zu Beginn 28
3.3 Das Fremde im Englischunterricht anders gedacht – Überblick über den Stand der Theoretisierung des Fremden in der Englischdidaktik 34
4 Erfahrungen als Zugriffspunkt für Fremdheit: Ausdifferenzierung und Begründung des Konzepts und eines damit verfolgten didaktischen Ziels 42
4.1 Begründung der Bestimmung von Fremdheit als Erfahrung – Fremdheitserfahrungen als Chance im Englischunterricht 42
4.2 Welcher Umgang mit Fremdheit – Herleitung einer begründeten Zielbestimmung für den Englischunterricht 48
4.2.1 Normative Grundlagen aus der Philosophie und der Politischen Theorie 48
4.2.2 Umgang mit Fremdheit in der Sprachdidaktik – Annahmen und Erkenntnisse im Lichte der normativen Grundlagen 67
4.3 Fremdheitserfahrungen als Anlass für Aushandlungsprozesse – Herleitung einer Zielbestimmung, ihre Begründung und mögliche Anschlusspunkte 79
5 Zwischenstand: Fremdheitserfahrungen im Englischunterricht und die sich für Teil II der Forschungsarbeit ergebende Fragestellung 93
TEIL II: DIE INSZENIERUNG VON FREMDHEIT IM ENGLISCHUNTERRICHT 103
6 Vorgehensweise bei der Beantwortung der dritten Forschungsfrage 105
7 Definition von Inszenierungsprinzipien 111
8 Baustein A: Exploration der fachspezifischen Erkenntnisse über Inszenierungsprinzipien von Fremdheitserfahrungen im Englischunterricht 117
8.1 Untersuchung konzeptioneller Ansätze in der Sprachdidaktik 117
8.1.1 Analyse von 'Hans Hunfeld (2004): Skeptische Hermeneutik' 121
8.1.2 Analyse von 'Nicola Mitterer (2016): Responsive Literaturdidaktik' 132
8.1.3 Analyse von 'Stephan Breidbach (2007): Eine Reflexive Didaktik für den bilingualen Sachfachunterricht' 144
8.1.4 Analyse von 'Thorsten Merse (2017): Queere Perspektiven auf den Englischunterricht' 163
8.1.5 Analyse von 'Jochen Plikat (2017) – Fremdsprachliche Diskursbewusstheit' 178
8.2 Untersuchung empirischer Studien in der Sprachdidaktik 188
8.2.1 Wie Fremdheitserfahrungen inszeniert werden können 189
8.2.2 Wie Schüler*innen unterschiedlich mit Irritationen umgehen 199
8.2.3 Wie Aushandlungsprozesse inszeniert werden können 202
9 Baustein B: Exploration der Rahmenbedingungen einer Inszenierung von Fremdheitserfahrungen 215
9.1 Analyse der individuellen Ebene – Psychologische Erkenntnisse zur Verarbeitung von Dissonanzen und zum Umgang mit Stereotypen 215
9.1.1 Wann Fremdheitserfahrungen (nicht) entstehen 216
9.1.2 Wie Menschen (unterschiedlich) mit Irritationen umgehen 236
9.1.3 Wie Aushandlungsprozesse in der Gruppe Fremdheitserfahrungen und deren Versprachlichung beeinflussen können 242
9.1.4 Bewertung und Einordnung der aus psychologischen Studien generierten Inszenierungsprinzipien 245
9.2 Analyse der institutionellen Ebene – Umgang mit Fremdheitserfahrungen im schulischen Kontext 252
10 Baustein C: Exploration des Erfahrungswissens von Expert*innen der Unterrichtspraxis 262
10.1 Lehrkräfte als Expert*innen der Praxis und von Unterrichtsplanung 262
10.1.1 Expert*inneninterviews als Erhebungsform 263
10.1.2 Die Expertise von Lehrkräften 264
10.2 Die Datenerhebung 266
10.2.1 Erstellung und Einsatz des Leitfadens 267
10.2.2 Datenerhebung und Zugang zum Feld 269
10.3 Auswertung der Interviews 270
10.3.1 Auswertungsmethode(n) 270
10.3.2 Einschätzung der Expertisegrade 274
10.3.3 Ergebnisse der thematischen Analyse 275
10.3.4 Diskussion der Ergebnisse 304
10.3.4.1 Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse 304
10.3.4.2 Formulierung der Ergebnisse in Inszenierungsprinzipien 307
10.3.4.3 Limitationen und Stärken der Studie 311
11 Modellbildung auf Grundlage der vorherigen Untersuchungen 313
11.1 Die Meta-Prinzipien festlegen als Antwort auf die beiden Forschungsunterfragen 314
11.2 Die Meta-Prinzipien durch pragmatische und spezifische Prinzipien konkretisieren und ausdifferenzieren 320
11.2.1 Meta-Prinzip: Komplexe Perspektivierungen bei den Schüler*innen fördern und die Schüler*innen beim Aushalten von daraus entstehenden Konflikten unterstützen 321
11.2.2 Meta-Prinzip: Die Aushandlungen im Unterricht bilden ein eigenständiges Verstehensgespräch 332
11.2.3 Meta-Prinzip: Die schüler*innenseitigen Erfahrungen des Gegenstandes und dadurch auch die individuellen Hintergründe der Schüler*innen leiten das Unterrichtsgespräch 340
11.2.4 Meta-Prinzip: Die Aufmerksamkeit der Schüler*innen für die Wahrnehmung des Widersprüchlichen und des Irritierenden schulen 347
11.3 Darstellung des entwickelten Modells 353
11.4 Überblick über nicht in das Modell übernommene Prinzipien 355
12 Fazit und Ausblick 357
13 Bibliographie 364
14 Anhang 392
Aktualisiert: 2023-03-28
> findR *
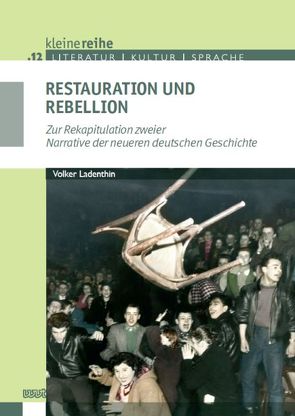
“Pop Revolution From the Underground”. Eine Langspielplatte mit diesem Titel, gepresst in knallbuntem Vinyl, rotierte 1969 auf vielen Schallplattenspielern in westdeutschen Partykellern. Einer Marketing-Abteilung war es gelungen, das gesamte Narrativ jener Jahre in fünf Worten aufs Cover zu bringen: Aufbegehren gegen die Jahre der Restauration, gefeiert als psychedelisches Happening im Untergrund. Nur ein Werbe-Gag?
Zu den großen Narrativen der deutschen Geschichte gehört, dass nach 1945 die Elterngeneration der westdeutschen Restauration über die jüngste Vergangenheit geschwiegen habe. Erst mit der Studentenrebellion habe ab 1968 eine politisch bedeutsame Aufarbeitung der deutschen Vergangenheit begonnen.
Die beiden Teile des vorliegenden Bandes analysieren die Narrative der Restauration und Rebellion und werten dabei bisher wenig beachtetes Quellenmaterial aus. Die Geschichte und ihre Narrative erscheinen so in neuem Licht.
INHALT
Vorwort 1
1. Fünf Worte 1
2. Schimmernde Bilder 2
3. Große Geschichtserzählungen 5
4. Die DNA der deutschen Geschichte 8
5. Bruch oder Kontinuum? 10
6. Einige technische Hinweise 12
KAPITEL 1: DAS NARRATIV DER RESTAURATION. ODER: HAT DIE ÄLTERE GENERATION GESCHWIEGEN? 14
1. Ein Indiz 14
2. Der Bezugstext 15
3. Das Narrativ 16
4. Zur Methode 17
5. Memoiren und Erinnerungen 25
6. Der Blick nach vorn 26
7. Sachbücher 27
8. Die keineswegs schöne Belletristik 30
9. Die nicht nur amüsante Unterhaltungsliteratur 33
10. Was in der Luft lag: Blick auf den Schlager 40
11. Kinder- und Jugendliteratur 45
12. Kabarett 47
13. Vergangenheit im Film 48
14. Das Fernsehen als moralische Anstalt 48
15. Die indirekte Rede 49
16. Das komplementäre Narrativ: Die Jugend hört weg 51
17. Die nicht-schweigende Mehrheit 55
18. Das System des Nicht-Schweigens 61
KAPITEL 2: DAS NARRATIV DER REBELLION. ODER: 1968 – SCHÖNER SCHEIN ODER STRUKTURWANDEL? 63
1. Irritationen 63
2. Die Musikrevolution? 70
2.1 Das Fortleben der 1950er in den 1960ern 70
2.2 Die progressive Popmusik? 76
3. Kritische Comics und ihre Gegner 84
4. Der schöne Schein der Neuen Literatur 93
5. Die Ästhetik der Revolution 102
6. Die unpolitische Kunst der Selbstinszenierung 108
7. Mode oder Strukturwandel? 111
Zitierte Literatur 114
Aktualisiert: 2023-04-20
> findR *
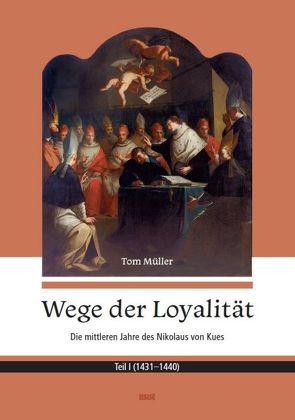
Heutzutage wird Nikolaus von Kues (1401–1464) in erster Linie als Philosoph geachtet. Seine Zeitgenossen hingegen kannten ihn als passionierten Büchersammler, Kleriker, Juristen oder als engagierten, wenngleich nicht unumstrittenen Kirchenpolitiker und -diplomaten. Diesem Blickwinkel auf den cusanischen Lebensweg folgend wird in der vorliegenden Teilbiographie, welche das vierte Lebensjahrzehnt abdeckt, das Wirken des Zeitzeugen Nikolaus von Kues u.a. auf dem Basler Konzil, in Konstantinopel oder auf den deutschen Reichstagen vor dem historischen Hintergrund der 1430er Jahre dargestellt. In dieser Zeit entstanden zudem seine ersten politischen und theologisch-philosophischen Werke, deren Entstehungskontexte und Inhalte vorgestellt werden.
Inhalt
1. Einleitung 1
2. Das Jahr 1431 10
3. Das Konzil von Basel und der Trierer Prozess (1432–1436) 27
4. Cusanus als Konzilsvater (1432–1437) 51
5. Die cusanischen Konzilsschriften 92
6. Cusanus als Anhänger der Konzilsminderheit 118
7. Die Konstantinopelreise und das Unionskonzil mit den Griechen 131
8. Wieder in Deutschland (1438–1440) 188
9. Noch einmal zur Entstehungszeit von De docta ignorantia 212
Quellen- und Literaturverzeichnis 221
Anmerkungen 245
Auswahlregister Personen und Orte 325
Aktualisiert: 2023-03-28
> findR *
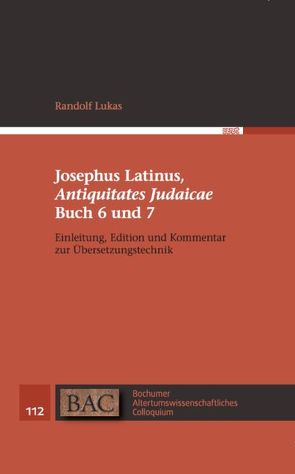
Ursprünglich an das gebildete, griechischsprachige Publikum seiner Zeit gerichtet, erfreuten sich die Werke des jüdischen Historikers Flavius Josephus (geb. 37/38 n. Chr.; gest. nach 100 n. Chr.) im europäischen Mittelalter größter Beliebtheit unter christlichen Lesern, was vor allem ihrer inhaltlichen Nähe zum Alten und Neuen Testament geschuldet war. Allerdings verdankte Josephus seine späte Popularität nicht mehr dem griechischen Originaltext, sondern dessen spätantiken Übersetzungen ins Lateinische. In lateinischer Sprache wurde Josephus zum meistgelesenen Historiker des Mittelalters und war bis in die Frühe Neuzeit neben der Bibel die Hauptquelle für die Geschichte des jüdischen Volkes.
Eine Schlüsselrolle spielte hierbei die lateinische Übersetzung der zwanzigbändigen „Geschichte des Judentums“ (), die in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts im süditalienischen Kloster Vivarium auf Veranlassung des Gelehrten Cassiodor angefertigt wurde. Der vorliegende Band bietet neben einer ausführlichen Diskussion der handschriftlichen Überlieferung sowie einem Kommentar zur Übersetzungstechnik erstmalig eine kritische Edition der Bücher sechs und sieben, die von der Herrschaft der Könige Saul und David erzählen und somit eine für die Geschichte des jüdischen Volkes zentrale Epoche abdecken.
INHALT
TEIL 1: PROLEGOMENA
I. EINLEITUNG XV
I.1 XV
I.2 Zum Stand der Forschung XX
II. AUSWAHL DER HANDSCHRIFTEN XXV
II.1 Ziel und Methodik XXV
II.2 Vorarbeiten XXV
III. DIE KOLLATIONIERTEN HANDSCHRIFTEN XXVIII
IV. AUSGEWÄHLTE DRUCKE (1470-1524) XLVII
V. DIE ÜBERLIEFERUNG: BEWERTUNG UND GRUPPIERUNG DER HANDSCHRIFTEN LI
V.1 Der Archetyp (ω corruptum) LI
V.2 Cimelio 1 (A): die älteste Josephus-Handschrift LVIII
V.3 Die Spaltung der Überlieferung in eine italienische und eine französisch/mitteleuropäische Gruppe LX
V.4 Die γ-Familie LXII
V.5 Die δ-Familie LXXXV
V.6 Der nördliche Solitär Cf LXXXVII
V.7 Die Spaltung der italienischen Zeugen in α.1 und α.2 LXXXIX
V.8 Zur "nördlichen kontaminierten Gruppe" Blatts C
V.9 Das Stemma CI
V.10 Exempla varia CII
V.11 Vergleich mit Boysens Klassifizierung CVIII
V.12 Zusammenfassung CIX
VI. ZUR QUALITÄT UND ÜBERSETZUNGSTECHNIK DER LATEINISCHEN CXI
VI.1 Vorbemerkungen CXI
VI.2 : Wo es gelingt CXII
VI.3 : Wo und warum es misslingt CXIV
VI.4 Zur Sprache des Übersetzers CXLII
VI.5 Zusammenfassung CL
VII. LITERATUR CLI
VIII. INHALTSÜBERSICHT DER BÜCHER 6 UND 7 CLX
IX. ZUR EDITION CLXI
IX.1 Orthographie CLXI
IX.2 Kapiteleinteilung CLXIII
IX.3 Der kritische Apparat CLXIV
IX.4 Conspectus Siglorum CLXV
IX.5 Abkürzungen im Apparat CLXV
TEIL 2: KRITISCHER TEXT UND APPARAT
Buch 6 1
Buch 7 56
Indices 109
Aktualisiert: 2023-03-28
> findR *
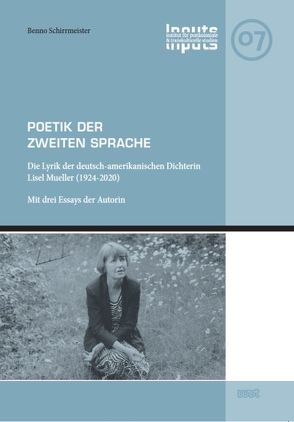
Lisel Mueller, als Elisabeth Neumann am 8. Februar 1924 in Hamburg geboren, am 21. Februar 2020 in Chicago gestorben, ist die einzige in Deutschland sozialisierte amerikanische Dichterin, die für ihre Lyrik mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet wurde. Ihr zwischen 1954 und 2000 entstandenes Werk besticht durch seine thematische Bandbreite und die Vielfalt politischer Subtexte.
Diese erste literaturwissenschaftliche Monografie zu Mueller versucht, das literar- und zeithistorische Beziehungsgeflecht zu rekonstruieren, in dem sich dieses Oeuvre bewegt. Dabei wird gezeigt, wie Mueller ihre Exophonie als privilegierten Zugang zu Sprache überhaupt deutet, der ihr erst das Dichten ermöglicht und selbst zu dessen Gegenstand wird. Gemeinsamkeiten dieser Poetik der Zweiten Sprache mit dem durch Sprachwechsel geprägten Dichten anderer infolge des NS-Terrors geflüchteter Autor*innen wie Rose Ausländer, Monique Bosco, Arthur Gregor, Michael Hamburger, Lotte Kramer, Felix Pollak und ruth weiss werden untersucht. Im kontrastiven Vergleich analysiert diese Arbeit schließlich den spezifischen Ansatz von Muellers Märchendichtung, die sich partiell wie eine poetische Gegenrede zu Anne Sextons Grimm (1971) lesen lässt. Muellers im Anhang wiedergegebene Essays „Two Strains: Some Thoughts About English Words“, „Learning to Play By Ear“ und „Return – a memoir“ reflektieren ihr Verhältnis zur englischen und zur deutschen Sprache und die Bedeutung ihres Lebenslaufs fürs Schreiben.
INHALTSVERZEICHNIS
I. – theoretische Vorüberlegungen 1
I.1 Nach Dichtung fragen. Gattungsdiskussion und Ausschlusspraxis 1
I.2 Die Zweite Sprache als Privileg 13
I.3 Umgang mit dem Unbewussten 17
I.4 Verortungen 20
II – auf dem Schrottplatz der Sprache 29
II.1 Dichten, wenn alles gesagt ist 29
II.2 Wo war soll werden 32
II.3 Mueller meets Hofmannsthal 36
II.4 Dürftigkeit gestalten 39
II.5 Was bedeutet Sekundarität? 40
II.6 Sekundär aus Prinzip 45
II.7 Poetiken des Sekundären 47
II.8 Dichten nach dem Tod 50
II.9 Zweitsprache als Rezeptionsrisiko 56
II.10 Eine kleine Schrottplatzkunde 62
II.11 Der Müll der Alten Welt 79
II.12 Das Lied vom Anti-Selbst 89
II.13 Das Eigene ist sekundär 99
III. Überleben 107
III.1 Flucht ins Glück: Biografische Möglichkeiten 107
III.1.1 Bilder der Überfahrt 107
III.1.2 Untote Vergangenheit 108
III.1.3 Der Autor ist tot – es lebe die Autorin! 110
III.1.4 Keine Bekenntnisse 115
III.1.5 Fluide Geschlechtlichkeit, irreale Realität 122
III.2 Skizze eines Lebenslaufs 124
III.2.1 Hamburg 124
III.2.2 Aufbruch 131
III.2.3 Sprache der Liebe 133
III.2.4 Und so weiter 139
III.2.5 Knots tying threads to everywhere 147
III.2.6 Dichten lehren 149
III.2.7 Das Land, das Heimat hätte sein sollen 153
III.2.8 Anders sehen 159
III.3 Zusammen klingen 164
III.3.1 Vom Klang zum Wort – Verdichtungen 164
III.3.2 Vom Wort zum Klang – Vertonungen 165
IV. Exil als Heimat 177
IV.1 Die Grenzen des Exils 177
IV.2 Entgrenzung des Exils 189
IV.3 „...among these poets“: Jenseits der Strömungen 196
IV.4 Britische Gegensätze 204
V. Auch ich war im Märchenwald 217
V.1 Herkunft und Hinrichtung 217
V.1.1 Männer, Mythen, Mütter, Märchen 217
V.1.2 Ursuppe mit Einlage: Muellers Märchenlektüren 225
V.1.3 Sexton: Nazis im Knusperhäuschen 229
V.2 Märchen dichten 232
V.2.1 That Story: Anne Sextons 234
V.2.2 Do not enter: Lisel Muellers „Voices from the Forest“ 249
VI. „Begin again“, the letter ends: Fazit und Ausblick 283
Bibliographie 293
Anhang: Drei Essays von Lisel Mueller 345
I. Two Strains: Some Thoughts About English Words (1979), LTPBE: 46-55 345
II. Learning to Play By Ear (1980), LTPBE: 33-37 352
III. Return – a memoir (1986), LTPBE: 38-45 355
Aktualisiert: 2023-03-30
> findR *
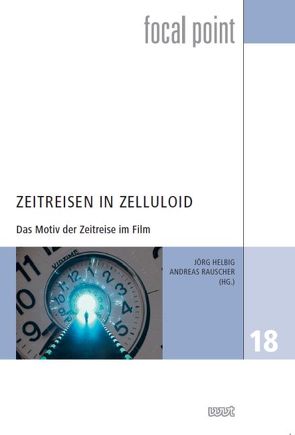
It's about time… Filme über Zeitreisen haben Konjunktur, und der vorliegende Band eröffnet einen differenzierten und aktuellen Blick auf die vielen Spielarten von Zeitreisen im Film. Die breite Themenpalette reicht von einer Neusichtung bekannter Genreklassiker wie THE TIME MACHINE, LA JETÉE und BACK TO THE FUTURE, über eine Re-Kontextualisierung individueller Filme wie MIDNIGHT IN PARIS, GROUNDHOG DAY und PREDESTINATION, bis hin zu den Multiversen der Franchise-Kultur und zu transmedialen Verknüpfungen zwischen Filmen und Videospielen. Die Zugänge zum Motiv der Zeitreise sind vielfältig: Klassiker des Steampunk wie TIME AFTER TIME und romantische Komödien wie KATE & LEOPOLD greifen ebenso darauf zurück wie die actiongeladenen Blockbuster der TERMINATOR-Reihe und die zeitphilosophischen Reflexionen in Christopher Nolans TENET.
Das Kino und die moderne Form der Zeitreise, in Gestalt von H.G. Wells' stilprägendem Roman "The Time Machine", betraten nahezu gleichzeitig die kulturelle Bühne und haben sich über die Jahrzehnte hinweg immer wieder gegenseitig inspiriert: von der Idee des Kinos als Zeitmaschine, über filmische Erzählexperimente, raffinierte Genrevariationen und philosophische Paradoxien. Gerade in den letzten Jahren wurde das Repertoire der Passagen durch die Zeit um innovative Formen erweitert, die sich in den komplizierten Puzzlestrukturen von Zeitschleifenfilme oder im Palindromischen Erzählen niederschlagen, aber auch in der Erweiterung filmwissenschaftlicher Perspektiven durch dynamische Netzwerke, die sich aus dem Diskurs zwischen Film und anderen Medien wie Serien und Videospielen ergeben haben. Umso relevanter erscheint vor diesem Hintergrund die vorliegende Bestandsaufnahme.
Inhalt
JÖRG HELBIG, ANDREAS RAUSCHER
Einleitung 1
DAS KINO ALS ZEITMASCHINE
MATTHIAS HURST
Zurück in die Vergangenheit. Regressive Reisen durch die Zeit 11
ZEITREISEFILME – KLASSIKER UND KURIOSA
HANS J. WULFF
Zeiten, Reisen und Fiktionen. Das motivische Feld der Zeitreise-Filme 37
ARNO RUßEGGER
THE TIME MACHINE. Erinnerungen an einen Klassiker des Science-Fiction-Genres im Wandel der Filmgeschichte 49
MARCUS STIGLEGGER
Flucht in die Zukunft. Filmische Zeitreisen in der Steampunk-Ära 63
ZEITSCHLEIFEN
JÖRG HELBIG
"Was, wenn es kein morgen gibt?" GROUNDHOG DAY und das Genre des Zeitschleifenfilms 77
TOBIAS HELBIG
Play, Die, Repeat. Zeitschleifen in Videospielen / Videospiele als Zeitschleifen 95
DIE VERGANGENHEIT – NOSTALGIE UND DESILLUSIONIERUNG
ANGELA KREWANI
Nostalgie und Selbsterkenntnis. Woody Allens MIDNIGHT IN PARIS 111
SUSANNE BACH
Retrotopia? BACK TO THE FUTURE und die verlorene Unschuld der 1950er Jahre 123
SUSANNE REICHL
"Die Liebe ist ein Sprung." Postfeministische Beziehungswirren in Zeitreise-Romcoms 141
ZEITREISE UND ZEITSTILLSTAND
KLAUDIJA SABO
Die eingefrorene Zeit – Bilder der Erinnerung in Chris Markers LA JETÉE und Terry Gilliams TWELVE MONKEYS 161
ZEITUMKEHR UND PALINDROME
SABRINA GÄRTNER
Richtung Zukunft durch die Vergangenheit. Palindromisches Erzählen im Film 173
DÉSIRÉE KRIESCH
"Let's look at time differently." Zeitumkehr, Palindrome und das Bootstrap-Paradoxon in Christopher Nolans TENET 185
KAUSALE SCHLEIFEN
SIMON SPIEGEL
Die immobile Vierfaltigkeit. Zu THE TERMINATOR und TERMINATOR 2: JUDGMENT DAY 203
MARTIN HENNIG
Geschlecht als Schicksal? Gender in Zeitreisenarrativen am Beispiel von PREDESTINATION 217
ZEITREISEN IN DEN MARVEL- UND STAR TREK-MULTIVERSEN
HANNS CHRISTIAN SCHMIDT
Via Zeitreise durchs Multiversum – Metachronotopische Glättungsstrategien im seriellen Blockbuster-Franchise 235
ANDREAS RAUSCHER
Days of Franchise Past. Zeitreisen im STAR TREK-Universum 249
FILMOGRAFIE 264
DIE AUTOR:INNEN 275
Aktualisiert: 2023-03-28
> findR *

Der dem Tragiker Euripides zugeschriebene der mittlerweile als frühhellenistische Tragödie gelesen werden kann, erzählt von den Geschehnissen der sogenannten Dolonie, des 10. Buches der homerischen Ilias, aber im Gegensatz zu dieser nicht aus der griechischen, sondern aus der trojanischen Perspektive. Durch die Art und Weise, wie der Dichter seinen Text gestaltet, wird deutlich, dass er sich von Beginn an mit der literarischen Tradition – vor allem mit Homer und der Gattung der Tragödie – auseinandersetzt und dabei seine Innovationen thematisiert, so dass die Poiesis, das ‚Gemachtsein‘, der Tragödie auf der Metaebene des Textes zum zentralen Thema wird.
Der Auftritt der poetologisch bedeutsamen Muse am Ende des Dramas ist eine gattungsspezifische Innovation, die sich deutlich von allen anderen Neuerungen in diesem Text abhebt. Die Rede der Muse, der Trägerin einer textinhärenten Poetik, erweist sich als durchsetzt mit meta- und autopoetischen Reflexionsmomenten, die für das Verständnis der ganzen Tragödie von Bedeutung sind. Im Zentrum dieser Studie steht somit die ‚neue Muse‘ nicht nur als eine handelnde Figur im Text, sondern vor allem auch im Sinne des innovativen Schaffens des Dichters.
INHALT
1. Einleitung 13
2. νέων κληδόνα μύθων – Eine neu(artig)e Erzählung 25
2.1 Tradition und Innovation 25
2.2 Neue Helden?! 31
2.2.1 Hektor und die Wache 31
2.2.2 Dolon und Rhesos 38
2.3 Vom Epos zur Tragödie 52
2.3.1 Die Tragödie der Nachtigall 52
2.3.2 Athenes Eingriff. Oder: Die Macht des Mythos 59
2.3.3 Die Leiden des Wagenlenkers 68
3. ὁρᾶν πάρεστι – Metapoetik in der Musenrede 75
3.1 Die „neue“ Muse 75
3.2 Die Klage der Muse 85
3.2.1 ἰάλεμος αὐθιγενής 93
3.2.2 Vom Klagegesang zum Ruf nach Rache 96
3.2.3 ἀριστότοκος vs. δυσαριστοτόκεια 99
3.3 Die Geburt der Tragödie 102
3.3.1 Die Schuld des Thamyris 102
3.3.2 Die Bestrafung des Thamyris 113
3.3.3 Kindsaussetzung / Vergleich mit Thetis 119
3.4 Die Schuld Athenes 124
3.5 Eine Zukunft für Rhesos 131
3.6 Das letzte Wort der Muse 140
4. φῶς γὰρ ἡμέρας τόδε – Das Ende der Tragödie 143
Literatur 149
Index locorum 165
Aktualisiert: 2023-03-28
> findR *
MEHR ANZEIGEN
Oben: Publikationen von WVT Wissenschaftlicher Verlag Trier
Informationen über buch-findr.de: Sie sind auf der Suche nach frischen Ideen, innovativen Arbeitsmaterialien,
Informationen zu Musik und Medien oder spannenden Krimis? Vielleicht finden Sie bei WVT Wissenschaftlicher Verlag Trier was Sei suchen.
Neben praxiserprobten Unterrichtsmaterialien und Arbeitsblättern finden Sie in unserem Verlags-Verzeichnis zahlreiche Ratgeber
und Romane von vielen Verlagen. Bücher machen Spaß, fördern die Fantasie, sind lehrreich oder vermitteln Wissen. WVT Wissenschaftlicher Verlag Trier hat vielleicht das passende Buch für Sie.
Weitere Verlage neben WVT Wissenschaftlicher Verlag Trier
Im Weiteren finden Sie Publikationen auf band-findr-de auch von folgenden Verlagen und Editionen:
Qualität bei Verlagen wie zum Beispiel bei WVT Wissenschaftlicher Verlag Trier
Wie die oben genannten Verlage legt auch WVT Wissenschaftlicher Verlag Trier besonderes Augenmerk auf die
inhaltliche Qualität der Veröffentlichungen.
Für die Nutzer von buch-findr.de:
Sie sind Leseratte oder Erstleser? Benötigen ein Sprachbuch oder möchten die Gedanken bei einem Roman schweifen lassen?
Sie sind musikinteressiert oder suchen ein Kinderbuch? Viele Verlage mit ihren breit aufgestellten Sortimenten bieten für alle Lese- und Hör-Gelegenheiten das richtige Werk. Sie finden neben