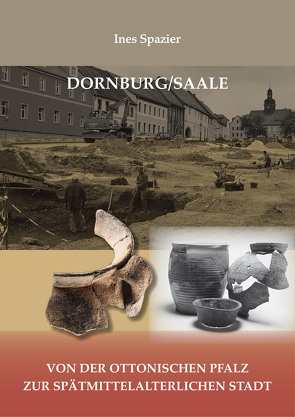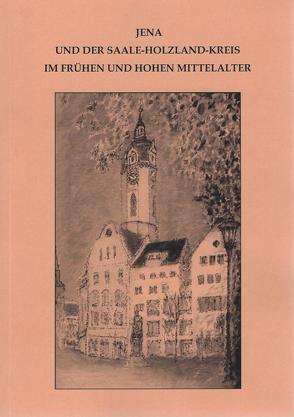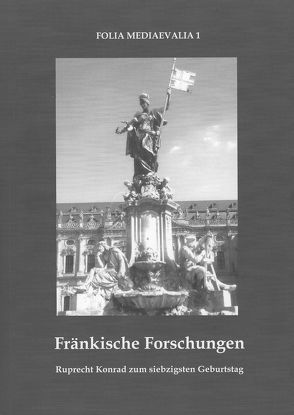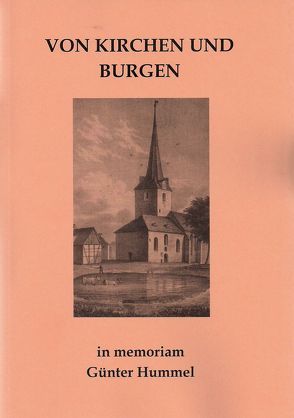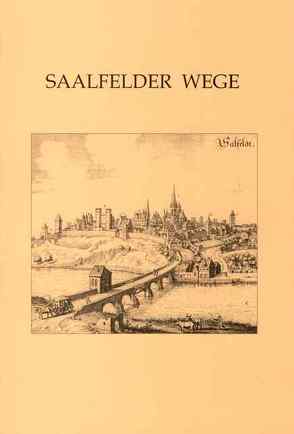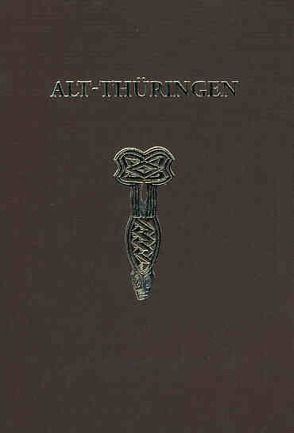Für die regelmäßig im Renaissanceschloß Ponitz stattfindenden Kolloquien wurden seit 2001 stets bestimmte Themen ausgewählt. Sie reichen von geographischen Schwerpunkten in ostthüringischen Landschaften bis hin zu Studien zu frühen Städten, Burgen oder Klöstern. Die für den 6. und 7. November 2020 unter Schirmherrschaft des Landrates des Altenburger Landes Uwe Melzer geplante Tagung „Neue archäologische und kulturgeschichtliche Forschungen zum frühen und hohen Mittelalter zwischen Saale und Zwickauer Mulde“ sollte dagegen eine allgemeine Berichtskonferenz werden. Sie mußte jedoch – wie die meisten Veranstaltungen in diesem Jahr – bedauerlicherweise coronabedingt ausfallen. Der weitgehende Zusammenbruch des wissenschaftlichen Tagungs- und Vortragsgeschehens seit März 2020 machte es aus Sicht der Herausgeber aber umso wichtiger, Forschungsergebnisse dennoch – nun in schriftlicher Form – zu präsentieren.
Dies ist mit dem vorliegenden Band 11 der Beiträge zur Frühgeschichte und zum Mittelalter Ostthüringens gelungen. 15 Aufsätze aus den Bereichen Archäologie/Baugeschichte, Geschichte/Namenkunde sowie Forschungsgeschichte/Denkmalpflege, vorrangig in Ostthüringen und Westsachsen zu verorten, dokumentieren das aktuelle Forschungsgeschehen. Dabei fanden fünf der 16 für 2020 angekündigten Vorträge keinen Eingang in den Tagungsband: Die weiteren Untersuchungen von Holger Rode zum Kloster Posa bei Zeitz – der erste Teil in BFO 10 publiziert – sollen in einer Veröffentlichung des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt vorgelegt werden. Die interdisziplinären Untersuchungen Pierre Fütterers im Gebiet der Weißen Elster sowie die Forschungen zu Steinkreuzen von Stefan Altensleben wurden jeweils in abgewandelter Form auf der Tagung 2022 vorgestellt. Der von Martin Müller geplante historische Vortrag wuchs während der Verschriftlichung exponentiell an und wurde vom Autor vorläufig zurückgezogen. Volker Schimpff hat mit seinem im vorliegenden Band abgedruckten Beitrag zur Magdeburger „Kaiserpfalz“/„Nordkirche“ seinen Vortrag zu Personalproblemen Ottos des Großen bei der Errichtung der sorbenländischen Bistümer ersetzt. Neu hinzugekommen sind außerdem ein weiterer namenkundlicher Aufsatz Karlheinz Hengsts zu den Herren von Crimmitschau sowie ein Beitrag der kommunalen Denkmalpflege und Stadtarchäologie Jena über die Burg Burgau von Matthias Rupp. Jörg Wickes Untersuchungen in der Zwickauer Altstadt werden durch archäobotanische Analysen von Christoph Herbig ergänzt. Bei den Beiträgen von Rainer Müller und Bernd Kunzmann gab es zudem leichte Verschiebungen in der Schwerpunktsetzung.
Vorwort
Übersichtskarte
Struktur und Belegungsgeschichte des völkerwanderungszeitlichen Gräberfeldes von Zwochau, Lkr. Nordsachsen
Zwei merowingische Münzen und die Untere Sachsenburg – eine probabilistische Ortsbestimmung des Waffengangs zwischen Radulf und Sigibert III. im Jahre 641
Zu Siedlungsprozessen auf der mittleren Ilm-Saale-Platte vom frühen bis zum späten Mittelalter
Neues zum Stand der Stadtarchäologie Chemnitz
Mit Blick auf die Marienkirche: Die archäologischen Untersuchungen in Zwickau im Jahr 2019
Erste archäobotanische Großrestuntersuchungen in mittelalterlichen Befunden der Zwickauer Altstadt (Aktivität Z-94), Lkr. Zwickau
Die Burg Burgau an der Saale (Stadt Jena)
Zwischen Tradition und Innovation – Die Klosterkirche Thalbürgel und die Architektur der Reform des 12. Jahrhunderts
Mittelalterliche Topographie und mittelalterliche Großbauten. Die „Kaiserpfalz“/ „Nordkirche“ in Magdeburg zwischen Domplatz und Elbniederung?
Arnold von Quedlinburg und die Mildenfurther Stifterchronik. Zu Textstruktur und Datierung der ältesten erzählenden Quelle des Vogtlands
Die Herrschaftsgebiete Meerane und Mosel sowie Ponitz und Tettau südöstlich vom einstigen Kloster Schmölln – Zur frühen herrschaftlichen Erschließung des Gebietes von Schmölln über Meerane und Mosel bis an die Mulde bei Zwickau vor dem großen Landesausbau
Herkunft, Territorium und Wirken der Herren von Crimmitschau im 12. Jahrhundert
Namenkundliche Rückschlüsse auf das Geleitwesen entlang des „Erfurter Weges“ im Vogtland und in Ostthüringen
Ostthüringer „Vogelherde“ – Burgstellen und mögliche Gerichts- und Versammlungsplätze
Aus der Amtsstube in die Baugrube – Friedrich Wagner (1792–1859), einer der ersten Bodendenkmalpfleger im Altenburger Land
Abkürzungen
Aktualisiert: 2023-05-11
> findR *

Für die regelmäßig im Renaissanceschloß Ponitz stattfindenden Kolloquien wurden seit 2001 stets bestimmte Themen ausgewählt. Sie reichen von geographischen Schwerpunkten in ostthüringischen Landschaften bis hin zu Studien zu frühen Städten, Burgen oder Klöstern. Die für den 6. und 7. November 2020 unter Schirmherrschaft des Landrates des Altenburger Landes Uwe Melzer geplante Tagung „Neue archäologische und kulturgeschichtliche Forschungen zum frühen und hohen Mittelalter zwischen Saale und Zwickauer Mulde“ sollte dagegen eine allgemeine Berichtskonferenz werden. Sie mußte jedoch – wie die meisten Veranstaltungen in diesem Jahr – bedauerlicherweise coronabedingt ausfallen. Der weitgehende Zusammenbruch des wissenschaftlichen Tagungs- und Vortragsgeschehens seit März 2020 machte es aus Sicht der Herausgeber aber umso wichtiger, Forschungsergebnisse dennoch – nun in schriftlicher Form – zu präsentieren.
Dies ist mit dem vorliegenden Band 11 der Beiträge zur Frühgeschichte und zum Mittelalter Ostthüringens gelungen. 15 Aufsätze aus den Bereichen Archäologie/Baugeschichte, Geschichte/Namenkunde sowie Forschungsgeschichte/Denkmalpflege, vorrangig in Ostthüringen und Westsachsen zu verorten, dokumentieren das aktuelle Forschungsgeschehen. Dabei fanden fünf der 16 für 2020 angekündigten Vorträge keinen Eingang in den Tagungsband: Die weiteren Untersuchungen von Holger Rode zum Kloster Posa bei Zeitz – der erste Teil in BFO 10 publiziert – sollen in einer Veröffentlichung des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt vorgelegt werden. Die interdisziplinären Untersuchungen Pierre Fütterers im Gebiet der Weißen Elster sowie die Forschungen zu Steinkreuzen von Stefan Altensleben wurden jeweils in abgewandelter Form auf der Tagung 2022 vorgestellt. Der von Martin Müller geplante historische Vortrag wuchs während der Verschriftlichung exponentiell an und wurde vom Autor vorläufig zurückgezogen. Volker Schimpff hat mit seinem im vorliegenden Band abgedruckten Beitrag zur Magdeburger „Kaiserpfalz“/„Nordkirche“ seinen Vortrag zu Personalproblemen Ottos des Großen bei der Errichtung der sorbenländischen Bistümer ersetzt. Neu hinzugekommen sind außerdem ein weiterer namenkundlicher Aufsatz Karlheinz Hengsts zu den Herren von Crimmitschau sowie ein Beitrag der kommunalen Denkmalpflege und Stadtarchäologie Jena über die Burg Burgau von Matthias Rupp. Jörg Wickes Untersuchungen in der Zwickauer Altstadt werden durch archäobotanische Analysen von Christoph Herbig ergänzt. Bei den Beiträgen von Rainer Müller und Bernd Kunzmann gab es zudem leichte Verschiebungen in der Schwerpunktsetzung.
Vorwort
Übersichtskarte
Struktur und Belegungsgeschichte des völkerwanderungszeitlichen Gräberfeldes von Zwochau, Lkr. Nordsachsen
Zwei merowingische Münzen und die Untere Sachsenburg – eine probabilistische Ortsbestimmung des Waffengangs zwischen Radulf und Sigibert III. im Jahre 641
Zu Siedlungsprozessen auf der mittleren Ilm-Saale-Platte vom frühen bis zum späten Mittelalter
Neues zum Stand der Stadtarchäologie Chemnitz
Mit Blick auf die Marienkirche: Die archäologischen Untersuchungen in Zwickau im Jahr 2019
Erste archäobotanische Großrestuntersuchungen in mittelalterlichen Befunden der Zwickauer Altstadt (Aktivität Z-94), Lkr. Zwickau
Die Burg Burgau an der Saale (Stadt Jena)
Zwischen Tradition und Innovation – Die Klosterkirche Thalbürgel und die Architektur der Reform des 12. Jahrhunderts
Mittelalterliche Topographie und mittelalterliche Großbauten. Die „Kaiserpfalz“/ „Nordkirche“ in Magdeburg zwischen Domplatz und Elbniederung?
Arnold von Quedlinburg und die Mildenfurther Stifterchronik. Zu Textstruktur und Datierung der ältesten erzählenden Quelle des Vogtlands
Die Herrschaftsgebiete Meerane und Mosel sowie Ponitz und Tettau südöstlich vom einstigen Kloster Schmölln – Zur frühen herrschaftlichen Erschließung des Gebietes von Schmölln über Meerane und Mosel bis an die Mulde bei Zwickau vor dem großen Landesausbau
Herkunft, Territorium und Wirken der Herren von Crimmitschau im 12. Jahrhundert
Namenkundliche Rückschlüsse auf das Geleitwesen entlang des „Erfurter Weges“ im Vogtland und in Ostthüringen
Ostthüringer „Vogelherde“ – Burgstellen und mögliche Gerichts- und Versammlungsplätze
Aus der Amtsstube in die Baugrube – Friedrich Wagner (1792–1859), einer der ersten Bodendenkmalpfleger im Altenburger Land
Abkürzungen
Aktualisiert: 2023-05-03
> findR *
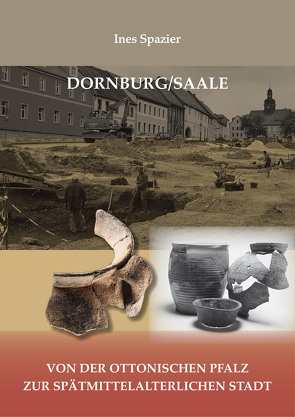
Die an der Saale liegende Kleinstadt Dornburg ist ein geschichtsträchtiger Ort, der 937 erstmals urkundlich erwähnt wird und in dem sich die ottonischen Könige und Kaiser im 10./11. Jh. mehrfach aufhielten. Von der Forschung wurde die Frage zur Lage der ottonischen
Pfalz innerhalb der Gemarkung Dornburg kontrovers diskutiert. Mit dem Alten Schloss/Marktplatz und der Flur gab es zwei mögliche Standorte.
Die in den letzten zwei Jahrzehnten durchgeführten Ausgrabungen in Dornburg, Saale-Holzland-Kreis, konnten zur Klärung beitragen. Neben den Forschungen am Alten Schloss (2001–2004) waren die zwischen 2010 und 2016 dokumentierten Untersuchungen in der Flur und auf dem Dornburger Marktplatz aufschlussreich. Dieses veranlasste die Autorin die Ergebnisse bei beiden letztgenannten Grabungen zusammen zu stellen und die äußerst umfangreichen Fundbestände sukzessive aufzuarbeiten sowie restaurieren, zeichnen und fotografieren zu lassen
Vorwort der Herausgeber
Vorbemerkungen der Autorin
Einleitung
Topografie und geschichtliche Daten
• Topografisch-historische Angaben
• Geschichtliche Daten zu Dornburg
Die archäologischen Untersuchungen im ottonischen Pfalzgelände
• Historische Voraussetzungen
• Zur Lage des Pfalzgeländes – ein Forschungsstand
• Anlass der Grabung und Grabungsorganisation
Die Untersuchungen im Vorburggelände der Pfalz
• Die Wohn- und Wirtschaftsgebäude
• Das Wirtschaftszentrum
• Die Gräben
• Parzellengrenzen
Das Fundmaterial vom Pfalzgelände
• Die Keramik
• Kleinfunde
Datierung und Struktur der ottonischen Pfalz Dornburg
• Datierung der Pfalz Dornburg
• Ottonische Pfalzen im Vergleich
• Struktur und Gliederung der Dornburger Pfalz
Betrachtungen zum frühmittelalterlichen Burgbezirk Dornburg
• Schriftliche Quellen
• Archäologische Quellen
Die Untersuchungen auf dem Dornburger Markt
• Anlass der Grabung und Grabungsorganisation
• Die Siedlung der Späthallstatt- bis Frühlatènezeit
• Die mittelalterliche Bebauung des Marktplatzes
• Die Stadtbefestigung
• Bebauung und Struktur des spätmittelalterlichen Marktplatzes
Das Fundmaterial vom Markt
• Das hallstatt- bis frühlatènezeitliche Fundmaterial
• Das spätmittelalterliche keramische Fundspektrum
• Spätmittelalterliche Kleinfunde
Die Keramikentwicklung vom 9./10. bis zum späten 15. Jh. in Dornburg
Die Entwicklung von der Alten zur Neuen Stadt – eine Zusammenfassung
Katalog
• Grabung
• Grabung Marktplatz
Quellen- und Literaturverzeichnis
Tafeln und Tafelnachweis
Aktualisiert: 2022-10-06
> findR *

Mittelalterliche Klöster waren geistliche und geistige Mittelpunkte, darüber hinaus übten sie auch weltliche Herrschaft aus oder unterstützten sie, waren wichtig für Landesausbau und städtische Entwicklung, stellten wichtige Bauaufgaben dar (deren Ergebnisse vielfach noch erhalten sind) und bewirkten das Entstehen von Kunstwerken. Entsprechend vielfältig sind die wissenschaftlichen Disziplinen, die sich mit ihnen beschäftigen, und die methodischen Ansätze zu ihrer Erforschung. Im Rahmen der regelmäßig auf Schloß Ponitz bei Altenburg stattfindenden interdisziplinären Tagungen zur Frühgeschichte und zum Mittelalter Ostthüringens widmete sich das am 23. und 24. November 2018 durchgeführte Kolloquium „Glaube, Kunst und Herrschaft. Mittelalterliche Klöster zwischen Saale und Mulde“ dieser Thematik. Nach den vielen Reformationsthemen der letzten Jahre sollten nun das frühe und hohe Mittelalter sowie das beginnende Spätmittelalter im Fokus der Beiträge stehen.
In diesem Band finden sich fast alle Vorträge der Tagung wieder, zum Teil wie die von Andreas Hummel und Karlheinz Hengst in noch erweiterter Form. Der ausgefallene Vortrag von Ines Spazier über Frauenklöster in Thüringen ist erfreulicherweise ebenfalls enthalten, andererseits enthält er leider nicht die Beiträge von Katrin Sturm und Matthias Eifler zu den in der Universitätsbibliothek Leipzig befindlichen Handschriftenbeständen der Klöster Pegau und Buch und des Stiftes Lauterberg bei Halle sowie von Philipp Jahn über neue Forschungsergebnisse zur salischen Klosterkirche Goseck. Dafür konnten weitere Beiträge gewonnen werden, die mit den gehaltenen Vorträgen in enger Beziehung stehen: Das betrifft ebenso den Vortrag von Hans-Jürgen Beier (auf der Ponitzer Tagung 2016) und einen Grabungsbericht von Ines Spazier wie die Aufsätze von Pierre Fütterer und von Stefanie Handke zum Augustinerchorherrenstift Altenburg. Mit der Studie von Hans Schmigalla zur Grenze zwischen den Abteien Saalfeld und Paulinzella wird auch der Südwesten Ostthüringens erreicht. Schließlich runden drei Rezensionen von aktuellen Publikationen über Stifte und Klöster zwischen Saale und Mulde den Band ab.
Aufgrund der langen Zeit zwischen Tagung und Drucklegung darf es nicht verwundern, dass – ähnlich Band 8 – nicht alle 2011 gehaltenen oder angekündigten Beiträge den Weg in diesen Band gefunden haben. Neu eingeworbene Artikel schaffen indes einen guten Ausgleich. Mit ihnen rücken neben den 2011 thematisierten Burgen von Gera, Kapellendorf, Blankenberg, Wysburg sowie vogtländischen und beiderseits der Zwickauer Mulde gelegenen Burgen auch Schloß Burgk, Elsterberg und Triptis in den Fokus der Betrachtungen. Ein zusätzlicher Beitrag zu Burgen an der mittleren Saale und allgemeinere Darstellungen, u. a. zu Burgen aus namenkundlicher Sicht, aus Perspektive der Wegeforschung oder deren künstlerische Rezeption in der Zeit der Romantik runden den Band ab.
Die Herausgeber, die Volker Schimpff für redaktionelle Hinweise danken, sehen in diesem Band nicht nur eine wichtige Ergänzung zu den in den letzten Jahrzehnten erschienenen Publikationen zum Thema „Aktuelle Forschungen zu Burgen Thüringens“, sondern hoffen auch einen wichtigen Baustein für die mitteldeutsche, vor allem die thüringische Burgenforschung bieten zu können und sie über die Region hinaus bekannt zu machen.
Überblicksdarstellungen
Vorwort
• Burgen und Burgherren im Mittelalter zwischen Saale und Elbe
• Ottonische Pfalzen und frühmittelalterliche Befestigungen entlang der mittleren Saale
• Zu Burg und Herrschaft des lokalen Adels im Prozess des mittelalterlichen Landesausbaus in der Germania Slavica Thuringiae - dargestellt anhand des Gebietes östlich der Saale
• Vom Dienstlehen zum Reichslehen. Reichsministerialische Herrschaftsbildung im Pleißenland am Beispiel der Herren von Schellenberg
• Zur Burgenforschung im Vogtland
• Burgen an der Zwickauer Mulde im westlichen Erzgebirge. Anmerkungen zum Stand ihrer Erforschung
• Burgenromantik zwischen mittlerer Zwickauer Mulde und mittlerer Weißer Elster
• Mittelalterliche Turmhügelburgen in Brandenburg und Thüringen - ein Vergleich
• Von Rittern, Grafen und Bastionen – Forschungsstand zur Burgruine Elsterberg in Westsachsen
• Die Wettiner in Triptis – Die Ersterwähnung des Ortes im Jahr 1212 in Zusammenhang mit Markgraf Dietrich dem Bedrängten und seiner Schwester Adela von Böhmen
• „Gera hus und stat“ – Wo stand die Burg der Vögte von Gera?
• Burgen und die Kontrolle von Verkehrswegen. Überlegungen zur Funktion (früh-) mittelalterlicher Befestigungen am Beispiel der curtis Saalfeld
• Die Geschichte der Wysburg bei Weisbach
• Aktuelle Forschungen zur Wysburg
• Schloß Burgk– die Wiederentdeckung einer spätmittelalterlichen Burg
• Archäologische und historische Entwicklung der Burg Blankenberg in Thüringen an der oberen Saale im hohen und späten Mittelalter
• Die Wasserburg Kapellendorf als Wehrbau im Erfurter Landgebiet
• Der Vogtländische Altertumsforschende Verein zu Hohenleuben e. V. (VAVH)
Abkürzungen
Autorenadressen
Aktualisiert: 2022-07-07
> findR *
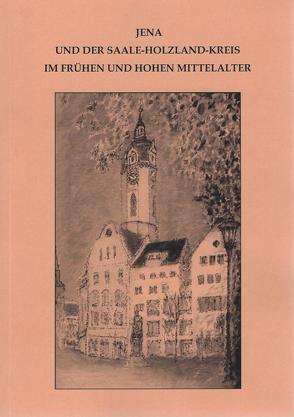
Seit 2001 finden auf Schloss Ponitz südlich von Altenburg, an der sächsisch-thüringischen Landesgrenze, Tagungen zur Frühgeschichte und zum Mittelalter Ostthüringens statt, die sich mit der Archäologie, Geschichte, Bau- und Kunstgeschichte sowie Namenkunde einzelner Regionen, dazwischen auch immer wieder mit thematischen Schwerpunkten („Kirche und geistiges Leben“ 2003, veröffentlicht 2005; „Auf dem Wege zur mittelalterlichen Stadt“ 2009, veröffentlicht 2014; „Burg und Herrschaft“ 2011, noch unveröffentlicht) beschäftigten. 2001 waren es „Tegkwitz und das Altenburger Land“ (veröffentlicht 2003), 2005 „Der Orlagau“ (veröffentlicht 2007) und 2007 „Gera und das nördliche Vogtland“ (veröffentlicht 2010). Die Publikation erfolgte immer in der Reihe „Beiträge zur Frühgeschichte und zum Mittelalter Ostthüringens“ (BFO). Danach kamen der zweijährige Tagungsrhythmus und die zeitnahe Vorlage ins Stocken. Das konnte dadurch ausgeglichen werden, daß sich eine Festschrift für Gerhard Werner mit dem regionalen Schwerpunkt „Saalfelder Wege“ (2012) und die Gedenkschrift für Günter Hummel mit dem thematischen Schwerpunkt „Von Kirchen und Burgen“ (2016) in derselben Reihe nahtlos in die bisher vorgelegten Bände einfügten.
Seit 2014 wird die Zweijahresfolge der Tagungen wieder aufgenommen. Auf Initiative von Peter Sachenbacher wurde zunächst eingeladen, die regionale ‚Lücke‘ um Jena und den Saale-Holzland-Kreis (das sind die Altkreise Eisenberg, Stadtroda und Jena-Land) zu schließen. Von den 25 im Tagungsprogramm angekündigten Vorträgen sind neun im vorliegenden Band vertreten, drei wurden in den thematisch besser passenden Band „Burg und Herrschaft“ verschoben, fünf sind, weil eine Publikation der Tagung nicht mehr erwartet wurde, zwischenzeitlich 2015 und 2016 in der Zeitschrift für Thüringische Geschichte, 2016 in den Beiträgen zur Frühgeschichte und zum Mittelalter Ostthüringens und 2017 in den Beiträgen zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas gedruckt worden. Dass mehrere Vorträge nicht gehalten oder nicht eingereicht wurden, ist für die Tagungsdokumentation zu bedauern. Der Verlust wird aber durch fünf nachgereichte Beiträge zum Saale-Holzland-Kreis und seiner unmittelbaren Nachbarschaft hervorragend ausgeglichen.
Inhaltsverzeichnis:
Vorbemerkung der Herausgeber
Karlheinz Hengst:
• Geografische Namen in der weiteren Umgebung von Jena aus germanischer Zeit
Barbara Aehnlich:
• Von Käsenapf und Ritterspiel – eine Einführung in die Flurnamenlandschaft des Saale-Holzland-Kreises
Volker Schimpff:
• Zu Flurnamen mit Kratz
Daniel Scherf:
• Studien zum hohen und späten Mittelalter zwischen Saale und Ilm – Das Reihengräberfeld von Zöllnitz
Judith Blödorn:
• Das karolingerzeitliche Gräberfeld von Kleinjena-Lauscheberg – Eine außergewöhnliche Nekropole am Zusammenfluss von Saale und Unstrut
Bernd Bahn, Pierre Fütterer:
• Die Wege der Lobdeburger
Pierre Fütterer:
• Mittelalterliche Wege um Jena
Matthias Rupp:
• Zur vor- und frühstädtischen Entwicklung Jenas aus archäologischer Sicht
Christina Müller:
• Leutra bei Jena – Vorstadt, Nachbarort oder Vorgängersiedlung der Stadt? (Zusammenfassung)
Dörte Hansen:
• Wein, Mühlen und mehr – Der Jenaer Brückenhof im 15. und frühen 16. Jahrhundert
Ines Spazier:
• Der mittelalterliche Marktplatz von Dornburg, Saale Holzland-Kreis
Volker Schimpff:
• Burg und Kirche – Burgbezirk und Kirchbezirk. Beobachtungen zur hochmittelalterlichen Herrschaftsbildung im Raum Orlamünde. Zusammenfassung
Hans Schmigalla:
• Mulnhusun, Mulnaim, Altsaalfeld und Graba – ein Beitrag zur frühen Namens- und Siedlungsgeschichte Saalfelds und seiner Umgebung
Ines Spazier:
• Nachgeburtsbestattungen in Thüringen
Matthias Hardt:
• Der Limes sorabicus im Vergleich früh- und hochmittelalterlicher Grenzentwicklungen
Hans-Jürgen Beier:
• Alban Zöllner – Begründer der Bodendenkmalpflege im südlichen Altenburger Land
Aktualisiert: 2020-07-07
> findR *

Inhaltsverzeichnis:
Katharina Flügel, Volker Schimpff, Hans-Jürgen Beier:
Frank-Dietrich Jacob (1944 – 2007)
Volker Schimpff:
Schriftenverzeichnis Frank Dietrich Jacob (Nachtrag)
Hermann Wirth:
Museologische Vielfalt und vielfältige Zuständigkeiten
Katharina Scherf, Leonie Hemminger:
Grundlegende Aspekte der Museumsfinanzierung in Deutschland
Michał Mencfel:
Ein falscher Basilisk auf dem Tableau der Identitäten und Unterschiede oder die Dilemmata eines Sammlers im 18. Jahrhundert. Der Fall Johann Christian Kundmanns aus Breslau (1684-1751)
Marlies Raffler:
Das Museum im Spiegel der Nation
Oliver Bagarić:
Museum und nationale Identitäten: Eine Geschichte des Landesmuseums Sarajevo
Silvio Reichel:
Die Lutherbildnisausstellung in Halle 1931
Steffen Förster:
Die Meißner Schluppe – Von der Musealisierung eines Elbfahrzeugs
Jürgen Knauss:
Darstellung zeitgeschichtlicher Alltags- und Wohnkultur sowie Landwirtschaftsgeschichte der SBZ- und DDR-Zeit im Deutschen Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain
Wieland Führ:
Bilder aus französischer Kriegsgefangenschaft um 1946/47
Rezensionen
Autoren
Aktualisiert: 2020-01-29
> findR *
11 Beiträge zur Geschichte Oberfrankens und seiner Nachbargebiete vom frühen Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert
Aktualisiert: 2020-01-29
> findR *
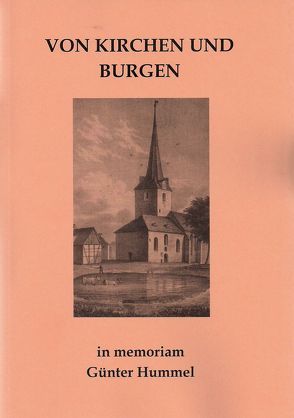
Im März 2013 ist plötzlich und viel zu früh Günter Hummel einundsechzigjährig verstorben. Mit seiner großen Kenntnis vor allem der kirchlichen Kunst im westsächsischen und ostthüringischen Raum hat er sich in den vergangenen Jahrzehnten hohe Anerkennung erworben. Als Autodidakt außerhalb des amtlichen Wissenschaftsbetriebes stehend, war es ihm möglich, ohne Ablenkung durch zeitbedingte Strömungen, Moden und Schlagworte zu forschen und seine Erkenntnisse zur Kunstgeschichte, insbesondere zur spätgotischen Bildschnitzerei, aber auch zur Volkskunde und Heimatgeschichte vorzulegen. Das gab ihm einen gewichtigen Platz in der wissenschaftlichen Gemeinschaft und reißt durch seinen Tod eine schwer zu füllende Lücke.
Die nachfolgenden Beiträge spiegeln sein persönliches und wissenschaftliches Umfeld wider. Sie sollen daher in erster Linie als Fortsetzung der Erforschung der thüringischen und sächsischen Sakral- und Burgenlandschaft verstanden werden. Ähnlich seinen Interessen verteilen sich auch die Themenschwerpunkte dieser Gedenkschrift auf die Gebiete Kunstgeschichte, Archäologie, Bauforschung und Geschichte. Sie sind in einem Band der "Beiträge zur Frühgeschichte und zum Mittelalter Ostthüringens" versammelt, einer Reihe, in der Günter Hummel in jedem Buch mit einem Aufsatz vertreten ist. Mögen sie dazu beitragen, dass er nicht nur als Vater und Lehrer, als guter Freund und Weggefährte und als wissensstarker, freundlicher und gänzlich unkomplizierter Kollege vermisst, sondern dass er auch in weiteren Fachkreisen nicht vergessen wird. (Vorwort)
Aktualisiert: 2020-01-29
> findR *

In einer sich vor allem immer weiter ausdifferenzierenden Wissenschaftslandschaft ist der Polyhistor, der Quellen gewinnt und bewahrt, der forscht und lehrt, der akademisch und bildungsverpflichtet publiziert, der in Archäologie und Kunstgeschichte tätig ist, der sich in der akademischen Lehre ebenso engagiert wie in der musealen Präsentation und zudem einen Wissenschaftsverlag betreibt, inzwischen eine echte Rarität.
Hans-Jürgen Beier ist Hochschullehrer, Direktor eines vielgelobten mitteldeutschen Ortsmuseums und Inhaber eines archäologischen Fachverlages. Die in diesem Buch versammelten dreiunddreißig Aufsätze gleichen einer Widerspiegelung dieser respektheischenden Breite, denn sie entstammen der Ur- und Frühgeschichte, besonders der Jungsteinzeitforschung, der Mittelalterarchäologie, der Geschichte und Archäologie der Neu- und der Neuesten Zeit sowie der Museologie und Denkmalpflege und würdigen in dieser Vielfalt Hans-Jürgen Beier anlässlich seines 60. Geburtstages.
Aktualisiert: 2019-01-03
> findR *
Diese Festschrift ist dem langjährigen Direktor der Saalfelder Museen gewidmet. Freunde und Kollegen lieferten Beiträge, die sich direkt oder indirekt mit Fragen der Saalfelder Geschichte befassen.
Aktualisiert: 2020-01-29
> findR *

Mit dem vorliegenden Jahrgang erhält die Zeitschrift für Museologie und museale Quellenkunde Jahrbuchcharakter. Mit Heft 11 der Zeitschrift halten Sie das Jahrbuch 2011 in der Hand. Diese Umbenennung des Untertitels signalisiert keinen Bruch. Im Gegenteil. Die Erhebung in den Rang eines wissenschaftlichen Jahrbuchs ergibt sich aus dem eigenständigen Profil, das die Zeitschrift als zweijährlich erscheinendes Periodikum in ihrer Bedeutung für unsere Museen und die Entwicklung der Museumskunde als einer jungen Wissenschaft in Mitteldeutschland gewonnen hat.
In diesem Jahr haben wir die neue Ausstellung auf der Albrechtsburg Meißen eröffnet. Vom Meißner Burgberg aus können wir auf ein Jahrtausend sächsischer Geschichte zurückblicken, die ihren Ausdruck in der Literatur und Kunst, Wirtschaft und Wissenschaft und nicht zuletzt auch im Alltagsleben der Menschen gefunden hat. Als Kernland des mitteldeutschen Kulturraumes hat der sächsische Staat die kulturelle Entwicklung in ganz Mitteleuropa über Jahrhunderte hin maßgeblich mitgeprägt.
Die Verfassung des Freistaates Sachsen von 1992 knüpft in ihrer Präambel an die Geschichte der Mark Meißen, des sächsischen Staates und des niederschlesischen Gebietes an. Sie erinnert aber an gleicher Stelle an die leidvollen Erfahrungen nationalsozialistischer und kommunistischer Gewaltherrschaft. Viele Leserinnen und Leser haben jene Museen und Ausstellungen noch in Erinnerung, in denen der totalitäre Staat seine Maske vor der Geschichte fallen gelassen hat.
(Auszug Geleitwort)
Inhaltsverzeichnis:
Matthias Rößler:
• Geleitwort
Volker Schimpff:
• Regionalmuseum und Geschichte
Frank-Dietrich Jacob:
• Quellenkundliche Probleme der mittelalterlichen Stadtgeschichtsforschung
Bernadette Biedermann:
• National-, Landes- und Universalmuseen – Versuch einer museologischen Begriffsbestimmung
Diana Stört:
• Deponieren und Exponieren im Sammlungsraum. Johann Wilhelm Ludwig Gleims Sammlungen als Zentrum der geselligen Kommunikation
Volker Schimpff:
• Musealität in Zeiten des Umbruchs
Bernhard Schink, Insa Grosskraumbach:
• Die Empfehlungen des Wissenschaftsrats zu wissenschaftlichen Sammlungen als Forschungsinfrastrukturen
Anette Sprengel:
• Kulturgutschutz in Deutschland – Sachstand und Perspektiven
Michael Loschelder, Katharina Johanna Müller:
• Dauerleihgaben an Museen und deren Vertragsgestaltung
Alexander Löwe:
• Die Wahrnehmbarkeit von technischen Bodenfunden. Bemerkungen zu Sammlungs- und Restaurierungskonzepten für eine vernachlässigte Objektgruppe, dargestellt an Funden aus dem ehemaligen Luftnachrichtenzeugamt in Berlin-Teltow
Hans-Jürgen Beier:
• Archäologische Funde oder Industrieschrott – Baudenkmal oder Abriss?
REZENSIONEN / ANNOTATIONEN
Katharina Flügel: Bild und Sprache – Das Problem der Bildbeschreibung und die Möglichkeit, mit Worten sehen zu lernen
Wolfgang Hilgers: Einführung in die Museumsethik (Marlies Raffler)
Die Magie der Geschichte (Ines Keske)
Olaf Hartung: Kleine deutsche Museumsgeschichte (Marlies Raffler)
Zukunft seit 1560, 1-3 (Volker Schimpff)
Christian Dittrich u. a.: Johann Heinrich von Heucher und Carl Heinrich von Heineken; Christien Melzer: Von der Kunstkammer zum Kupferstich-Kabinett (Hendrik Bärnighausen)
anatomie – Gotha geht unter die Haut (Gottfried Zirnstein)
Weises Geschenk (Michał Mencfel)
Jan Scheunemann: Geschichtspolitik und regionale Museumsarbeit in der SBZ/DDR 1945-1971 (Wolf Karge)
Peter Leimgruber, Hartmut John: Museumsshop-Management (Hans-Jürgen Beier)
Völker, Reiche und Namen im frühen Mittelalter; Fluchtpunkt Geschichte (Volker Schimpff)
Thomas Holzner: Die Decreta Tassilonis (Volker Schimpff)
Ulrike Kalbaum: Romanische Türstürze und Tympana in Südwest-deutschland (Volker Schimpff)
Heiko Brandl: Die Skulpturen des 13. Jahrhunderts im Magdeburger Dom (Volker Schimpff)
Die mittelalterliche jüdische Kultur in Erfurt 1 (Lothar Lambacher)
Die Korrespondenz der Herzogin Elisabeth von Sachsen (Martin Treu)
Julia Pätzold: Leipziger gelehrte Schöffenspruchsammlung (Manfred Wilde)
Geschlossene Häuser, 1-3 (Volker Schimpff)
Falk Weckner: Strafrecht und Strafrechtspflege in Deutsch-Ostafrika (Volker Schimpff)
Jürgen Kraus, Thomas Müller: Die deutschen Kolonial- und Schutztruppen (Volker Schimpff)
Eckart Henning, Dietrich Herfurth: Handbuch der Phaleristik; Jörg Nimmergut: Bibliographie zur deutschen Phaleristik (Volker Schimpff)
Jane Redlin: Säkulare Totenrituale (Ulrike Neurath-Sippel)
Autoren
Aktualisiert: 2020-01-29
> findR *

In der Festschrift finden sich über 40 wissenschaftliche Beiträge von Freunden und Weggefährten des Jubilars, die die enorme Zeitspanne vom Paläolithikum bis in die frühe Neuzeit abdecken.
Am 20. März 2012 vollendet Thomas Weber sein 60. Lebensjahr. Ein solches Jubiläum ist auch in der Wissenschaft ein willkommener Anlass, zurück und nach vorn zu blicken, um einen Überblick über den zurückgelegten Weg zu erlangen und damit eine solide Grundlage für die Ausrichtung der weiteren Arbeit zu schaffen. In dem großen Kreis von Freunden, Kollegen und Schülern, die den wissenschaftlichen Weg von Thomas Weber in den letzten Jahrzehnten mit ihm gemeinsam beschritten oder ihn begleitet haben, ist darum die Idee entstand, dies gemeinsam zu tun und das Ergebnis in einer Festschrift vorzulegen. Die Herausgeber dieses Bandes haben diese Idee aufgegriffen, Beiträge eingeworben und mit dem Verlag Beier und Beran einen Partner gefunden, der die praktische Umsetzung des Vorhabens (einschließlich der damit verbundenen finanziellen Lasten und Risiken) übernommen hat.
Das fachliche Wirken von Thomas Weber hatte seine Wurzeln stets in der praktischen
Bodendenkmalpflege, für die er seit vielen Jahren in verschiedenen Funktionen tätig war und
ist. Schon daraus ergibt sich eine große thematische Breite seiner Arbeiten und ein sehr weiter Kreis an Kollegen und Partnern. Vor allem im Bereich der Altsteinzeitforschung und auf
methodischem Gebiet hat er immer wieder Akzente gesetzt, die weit darüber hinausreichen
und sicher noch lange ihre Wirkung entfalten werden. Außerdem war und ist Thomas Weber
in vielen Gremien, Vereinen und Organisationen unseres Faches engagiert.
Inhaltsverzeichnis
Tabula Gratulatora
Laudatio
Vorwort
Schriftenverzeichnis Thomas Weber
Karel Valoch
• Das Altpaläolithikum in Böhmen und Mähren
Clemens Pasda
• Wipper, Tiere, Bilzingsleben. Anmerkungen zur archäologischen Taphonomie von Holz im älteren Paläolithikum
Armin Rudolph, Thomas Laurat, Wolfgang Bernhardt
• Bifaziale Geräte des Altpaläolithikums von Wallendorf
Hans-Peter Hinze
• Paläolithische Funde aus den Elbeschottern bei Brambach, Stadtkreis Dessau-Roßlau
Stefan Ertmer
• Die Grabungen in der Parkkiesgrube Hundisburg, Ldkr. Börde, Sachsen-Anhalt
Ulrich Hauer
• Altfunde eiszeitlicher Großsäugerreste aus dem unteren Bebertal im Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
Ralf-Jürgen Prilloff, Hans-Jürgen Döhle
• Neue pleistozäne Funde vom Steppenwisent und Moschusochsen aus dem Magdeburger Elbtal
Ulrich Simon, Luc Moreau
• Ein Aufnahmesystem zur merkmalanalytischen Erfassung jungpaläolithischer Kerntechnologie
Cajus G. Diedrich
• Der spätmesolithische Fundplatz Pöllnitz bei Saalfeld (Thüringen, Mitteldeutschland)
Barbara Fritsch, Johannes Müller
• Großsteingräber in Sachsen-Anhalt
Mario Schmidt
• Eine neolithische Bestattungslandschaft: Die Dölauer Heide als Sepulkralraum
Jörg Wicke, Andreas Neubert, Horst Bruchhaus
• Amphoren und Becher – Ein „anthropologischer Blick“ auf schnurkeramische Gefäßbeigaben
Klaus-Peter Wechler mit Beiträgen von Thomas Hunold und Hans-Volker Karl
• Ein frühbronzezeitliches Grab mit Bogenschützenausstattung aus Heldrungen, Kyffhäuserkreis
Mario Küßner
• Ein außergewöhnlicher Flintdolch von Hardisleben (Lkr. Sömmerda, Freistaat Thüringen)
Jonas Beran, Andreas Kurzhals
• Der frühbronzezeitliche Werkplatz Dyrotz 34
Karin Wagner
• Eine Diskriminanzanalyse und ihre Folgen für die weitere Auswertung der jungbronzezeitlichen Siedlung in der Wismarer Straße, Bezirk Steglitz/Zehlendorf, Land Berlin
Eberhard Bönisch, Małgorzata Daszkiewicz, Gerwulf Schneider
• Gefäßausstattung eines jüngstbronzezeitlichen Kammergrabes der Lausitzer Kultur mit Briquetage. Interpretation unter Einbeziehung von Keramikanalysen
Hartmut Bock, Thomas Janikulla, Lothar Mittag
• Ein kaiserzeitlicher Begräbnis- und Siedlungsplatz bei Dahrendorf im Altmarkkreis Salzwedel
Matthias Becker:
• Ein gutes Händchen
Wolf-Rüdiger Teegen, Ralf-Jürgen Prilloff
• Zur Differentialdiagnose von Lochdefekten an den Rippen ur- und frühgeschichtlicher Pferde aus Thüringen
Felix Biermann, Thomas Schwämmlein, Mathias Seidel
• Die „Gruber Burg“ bei Bachfeld in Südthüringen – eine frühmittelalterliche Fluchtburg?
Rainer Kuhn, Claudia Hartung
• Das Bruchstück einer römischen Marmorbüste vom Magdeburger Domplatz. Bemerkungen zu einem Altfund
Brigitta Kunz
• Die Befestigung des Steilufers der Pfalzen Magdeburg und Duisburg im 10. Jahrhundert
Volker Schimpff
• Ottonische ‚Stadt’planung. Kirchenkreuz in Paderborn? Doppelkathedrale in Magdeburg?
Michael Krecher
• Hohlglasfunde des 13./14. Jahrhunderts aus dem suburbium zu Magdeburg
Rosemarie Leineweber
• Gestrandet – zerschellt – gekentert. Archäologische Zeugnisse der historischen Schifffahrt bei Magdeburg
Bernd W. Bahn, Wernfried Fieber
• Eine Altstraße durch Mitteldeutschland. Zum Verlauf der verschwundenen Fernstraße Lüneburg-Leipzig-Böhmen
Maurizio Paul
• Vom romanischen Wehrturm zur Bastion Cleve. Bauarchäologische Untersuchung am wiederentdeckten Festungswerk der Magdeburger Altstadt
Mechthild Klamm, Caroline Schulz
• Die Identifizierung einer Bestattung des 17. Jhs. aus dem Zeitzer Dom, Zeitz, Burgenlandkreis
Aktualisiert: 2020-01-29
> findR *
In den letzten 25 Jahren wurden zahlreiche Kirchen in Thüringen gesichert und saniert. Dabei waren archäologische und bauhistorische Untersuchungen auszuführen. In diesem Tagungsband werden herausragende Ergebnisse der Thüringer Kirchenarchäologie präsentiert.
Aktualisiert: 2020-01-29
> findR *

Der Schwerpunkt des aktuellen Bandes der CURIOSITAS spiegelt die wissenschaftlichen Erkenntnisse jener Autorinnen und Autoren wider, die 2013 in einer
Ringvorlesung zur Theoretischen Museologie an der Karl-Franzens-Universität Graz vorgetragen wurden. Die von Bernadette Biedermann, Marlies Raffler und Nikolaus Reisinger organisierte Lehrveranstaltung zum Thema "Tücke des Objekts. Sammeln, Bewahren, Erforschen und Exponieren als Forschungsproblem der Museologie" wurde im Sommersemester 2013 am Institut für Geschichte der Karl-Franzens-Universität Graz in Kooperation mit den Universitätsmuseen, den Instituten für Volkskunde und Kulturanthropologie sowie Kunstgeschichte sowie dem Technischen Museum Wien, dem Kunsthistorischen Museum Wien und dem Universalmuseum Joanneum in Graz abgehalten.
Dass sich das Lehrveranstaltungsangebot nicht nur auf Historische Museologie beschränkt, sondern auch inter- und transdisziplinär ausgelegt ist und damit einer relevanten Forderung nach Inter- und Transdisziplinarität in der Lehre nachkommt, ist an der Strukturierung und Konzeption dieser Ringvorlesung deutlich nachvollziehbar. Sie setzte es sich zum Ziel, eine konkrete Problemstellung zum "musealen Objekt" transdisziplinär zu beleuchten - wobei hier erfreulicherweise Fachleute sowohl aus der Theorie als auch aus der Praxis zu Wort kommen konnten - mit der Intention, Inhalte so zu vermitteln und nachvollziehbar zu machen, dass Studierende dazu motiviert werden, sich in weiterer Folge mit museologischen Themata auseinander zu setzen.
Mit der Publikation der Beiträge jedoch soll auch bereits in einschlägigen Bereichen an musealen Sammlungen Befassten und Interessierten ein kompakter "Leitfaden" in die Hand gegeben werden.
Inhaltsverzeichnis:
Bernadette Biedermann, Marlies Raffler, Nikolaus Reisinger:
• Geleitwort
Lena Weber:
• Klostermuseum im deutschsprachigen Raum. Museumstyp und Phänomen
Bernadette Biedermann, Marlies Raffler:
• Die Tücke des Umgangs mit Objekten im Museum als Aspekt der Theoretischen Museologie
Nikolaus Reisinger:
• Musealisierung als Theorem der Museologie. Zur Musealisierung von Großobjekten und Landschaften am Beispiel der Eisenbahn
Helmut Lackner:
• Sammeln und Entsammeln im kulturhistorischen Museum
Kurt Zernig:
• Gepresst in alle Ewigkeit. Botanische Sammlungen als Quellenarchiv – Valentin Delić: Geschichte der musealen Konservierung und Restaurierung – Beispiele aus der aktuellen Museumsarbeit mit Hinblick auf die zunehmende Bedeutung von Präventiver Konservierung und kunsttechnologischer Forschung
Bernadette Biedermann, Nikolaus Reisinger:
• Die Stadt als Lebensraum und museale Inszenierung zwischen Erinnerung, Assoziation und Wahrnehmung. Am Beispiel der Grazer Altstadt
Susanne König-Lein:
• Abbild oder Illusion? Darstellungen und Inszenierungen von Kunstkammern
Martin Luik:
• Herzog Carl Eugen von Württemberg und das Projekt eines Römermuseums in Köngen 1784
Bianca Bernstein:
• Leipziger Innungspokale vom 17. bis zum 19. Jahrhundert
RENSIONEN / ANNOTATIONEN
Volker Schimpff: Bestandskataloge als Landesgeschichte
Marcus Andreas Habel: Ein Jahrhundert Zukunft der Museen (Volker Schimpff)
Das Exponat als historisches Zeugnis (Volker Schimpff)
Das partizipative Museum (Jürgen Schmid)
Die Stadt und ihr Gedächtnis (Jürgen Schmid)
Ulrike Grimm: Favorite (Anette Loesch)
Diana Stört: Johann Wilhelm Ludwig Gleim und die gesellige Sammlungspraxis im 18. Jahrhundert (Marlies Raffler)
Bénédicte Savoy: Kunstraub (Marlies Raffler)
Inszenierte Wissenschaft (Marlies Raffler)
Christian Ring: Gustav Pauli und die Hamburger Kunsthalle 1-2 (Ulrich Bischoff)
Ulfert Tschirner: Museum, Photographie und Reproduktion (Bernadette Biedermann)
Sabine Muschler: Künstler als Museumsgründer (Bernadette Biedermann)
Manfred K. H. Eggert: Retrospektive (Rosemarie Müller)
Eckart Henning: Hennings HiWi-Test (Georg Vogeler)
Eckart Henning: Repetitorium Heraldicum (Georg Scheibelreiter)
Manfred Mehl: Münz- und Geldgeschichte des Erzbistums Magdeburg im Mittelalter (Volker Schimpff)
Heinrich Meyer zu Ermgassen: Der Buchschmuck des Codex Eberhardi (Volker Schimpff)
Bernd-Ulrich Hergemöller, Nicolai Clarus: Glossar zur Geschichte der mittelalterlichen Stadt (Volker Schimpff)
Dietmar Stübler: Revolution in Italien (Aline Sierp)
Heiko Brandl, Christian Forster: Der Dom zu Magdeburg 1-2; Der Magdeburger Dom im europäischen Kontext (Volker Schimpff)
Norbert Schneider: Historienmalerei (Rainer Michaelis)
Ferdinand Ahuis: Das Porträt eines Reformators (Martin Treu)
Hendrik Bärnighausen: Carl Scheppig (1803-1885) (Andreas Teltow)
Michael Berger: Eisernes Kreuz – Doppeladler – Davidstern (Martin van Creveld)
Autoren
Aktualisiert: 2020-01-29
> findR *

Die beiden ersten Jahrzehnte eines gesamtdeutschen Museumswesens werden wohl durch ihre Ambivalenz in die Museumsgeschichtsschreibung eingehen. Auf der einen Seite haben ungeheure Anstrengungen nicht zuletzt finanzieller Art zahlreiche Museen in den neuen Bundesländern nach vorne gebracht, andererseits sind wichtige Einrichtungen (kultur-)politischer Räson oder finanziellen Nöten zum Opfer gefallen. Bis heute bestimmen letztere den Alltag zahlreicher Kulturinstitutionen. Schließungen sind an der Tagesordnung. Sie gehen einher mit Verlust von Arbeitsplätzen und Verlust von Lebensqualität. Nichts desto trotz wird die Bedeutung dieser Einrichtungen, zu denen nicht zuletzt die Museen gehören, hervorgehoben, wird auf das nicht zu unterschätzende Potential hingewiesen, das gerade diese besitzen, um Menschen unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen und gesellschaftlicher Schichten zusammenzuführen, wird auf die Unverzichtbarkeit der Museen als Stätten kultureller Bildung, auf ihre Bedeutung als Bewahrer unseres kulturellen Erbes rekurriert. In diesem Zusammenhang ist man nicht müde, auf die gestiegenen Anforderungen hinzuweisen, denen sich die Museen stellen
müssen, um dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgaben gerecht zu werden.
Kurzum, an das Niveau der Museumsarbeit sind die höchsten Ansprüche zu stellen. Um es zu garantieren, bedarf es geradezu einer doppelten Sicherung: einer äußeren und einer inneren. Erstere meint die materiellen und personellen Voraussetzungen, letztere Kreativität und innovatives Engagement eines jeden einzelnen Mitarbeiters. An der Stabilität dieser Sicherung dürfen hier ruhig etliche Zweifel geäußert werden. Auch die seit 2006 vorliegenden "Standards für Museen" können sie nicht ausräumen.
Inhaltsverzeichnis:
K. Flügel:
Editorial - Veranstaltungshinweis „The Best in Heritage“
I. Keske & E. Hochmuth:
Alma mater et Museologie non grata. Über die Akademisierung einer jungen Wissenschaft
M. Mencfel:
Wunder der Natur und Kult des Wanderns. Fußreisen der gelehrten Naturaliensammler in der frühen Neuzeit
S. Biedermann:
Karl Lacher und die museologische Ausstellungsgestaltung kunstgewerblicher Sammlungen
J. Scheunemann:
Th. Müntzer im Museum. Zu den Anfängen der regionalen Musealisierung des Bauernkrieges in der DDR
M. Schulze-Jorian:
Experimentelle Schlösserverwaltung – das Beispiel Sachsen
REZENSIONEN / ANNATOTIONEN
J. R. von Bieberstein: Museologie, Archive und DDR-Marxismus-Leninismus
Claus Deimel, Sebastian Lentz, Bernhard Streck (Hg.): Auf der Suche nach Vielfalt (V. Schimpff)
Bund der Vertriebenen (Hg.): Erinnerung und Begegnung (T. Alber)
Joachim Baur (Hg.): Museumsanalyse (V. Schimpff)
Thomas Thiemeyer: Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln (H. Berger)
Hartmut John, Hans-Helmut Schild, Katrin Hieke (Hg.): Museen und Tourismus (H.-J. Beier)
Hans-Rudolf Meier, Ingrid Scheurmann (Hg.): DENKmalWERTE (Hans-Jürgen Beier)
Die Kunstdenkmäler von Bayern. Stadt Bamberg. Jakobsberg und Altenburg; Michelsberg und Abtsberg (V. Schimpff)
Berthold Schmidt, Jan Bemmann: Körperbestattungen der jüngeren Römischen Kaiserzeit und der Völkerwanderungszeit Mitteldeutschlands (V. Schimpff)
Ludwig Wamser (Hg.): Karfunkelstein und Seide. Neue Schätze aus Bayerns Frühzeit (V. Schimpff)
Simon Paulus: Die Architektur der Synagoge im Mittelalter (S. Ostritz)
Evamaria Engel, Frank-Dietrich Jacob: Städtisches Leben im Mittelalter; Katrin Keller, Gabriele Viertel, Gerald Diesener (Hg.): Stadt, Handwerk, Armut (V. Schimpff)
Helmut Bräuer: Stadtchronistik und städtische Gesellschaft (Manfred Wilde)
Thomas Kübler, Jörg Oberste (Hg.): Die Stadtbücher Altendresdens 1412-1528 (U. Meißner)
Erich Wasem: Durch den Orient als freier Mensch (V. Schimpff)
Autorenverzeichnis
Aktualisiert: 2020-01-29
> findR *
MEHR ANZEIGEN
Bücher von Schimpff, Volker
Sie suchen ein Buch oder Publikation vonSchimpff, Volker ? Bei Buch findr finden Sie alle Bücher Schimpff, Volker.
Entdecken Sie neue Bücher oder Klassiker für Sie selbst oder zum Verschenken. Buch findr hat zahlreiche Bücher
von Schimpff, Volker im Sortiment. Nehmen Sie sich Zeit zum Stöbern und finden Sie das passende Buch oder die
Publiketion für Ihr Lesevergnügen oder Ihr Interessensgebiet. Stöbern Sie durch unser Angebot und finden Sie aus
unserer großen Auswahl das Buch, das Ihnen zusagt. Bei Buch findr finden Sie Romane, Ratgeber, wissenschaftliche und
populärwissenschaftliche Bücher uvm. Bestellen Sie Ihr Buch zu Ihrem Thema einfach online und lassen Sie es sich
bequem nach Hause schicken. Wir wünschen Ihnen schöne und entspannte Lesemomente mit Ihrem Buch
von Schimpff, Volker .
Schimpff, Volker - Große Auswahl an Publikationen bei Buch findr
Bei uns finden Sie Bücher aller beliebter Autoren, Neuerscheinungen, Bestseller genauso wie alte Schätze. Bücher
von Schimpff, Volker die Ihre Fantasie anregen und Bücher, die Sie weiterbilden und Ihnen wissenschaftliche Fakten
vermitteln. Ganz nach Ihrem Geschmack ist das passende Buch für Sie dabei. Finden Sie eine große Auswahl Bücher
verschiedenster Genres, Verlage, Schlagworte Genre bei Buchfindr:
Unser Repertoire umfasst Bücher von
- Schimpfhauser, Eva
- Schimpfhauser, Eva Maria
- Schimpfhauser, Johannes
- Schimpfhauser, Marco
- Schimpfky, Peter
- Schimpfle, Dietrich
- Schimpfle, Robert
- Schimpflinger, Sascha
- Schimpfössl, Elisabeth
- Schimpke, Jacqueline
Sie haben viele Möglichkeiten bei Buch findr die passenden Bücher für Ihr Lesevergnügen zu entdecken. Nutzen Sie
unsere Suchfunktionen, um zu stöbern und für Sie interessante Bücher in den unterschiedlichen Genres und Kategorien
zu finden. Neben Büchern von Schimpff, Volker und Büchern aus verschiedenen Kategorien finden Sie schnell und
einfach auch eine Auflistung thematisch passender Publikationen. Probieren Sie es aus, legen Sie jetzt los! Ihrem
Lesevergnügen steht nichts im Wege. Nutzen Sie die Vorteile Ihre Bücher online zu kaufen und bekommen Sie die
bestellten Bücher schnell und bequem zugestellt. Nehmen Sie sich die Zeit, online die Bücher Ihrer Wahl anzulesen,
Buchempfehlungen und Rezensionen zu studieren, Informationen zu Autoren zu lesen. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
das Team von Buchfindr.