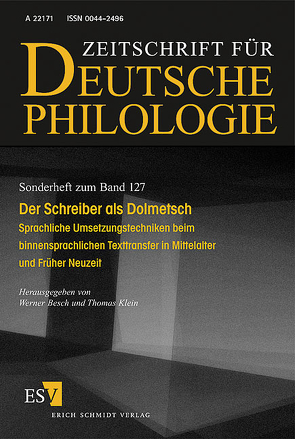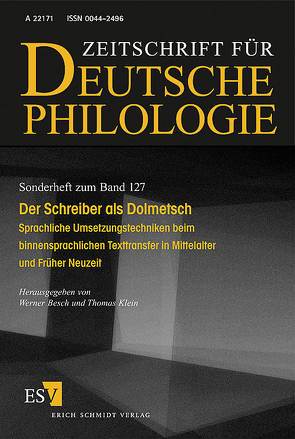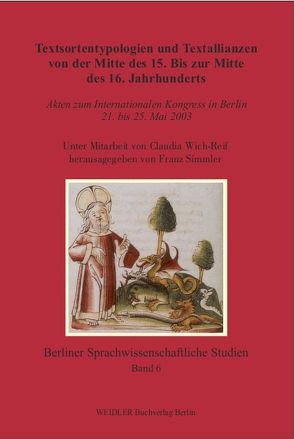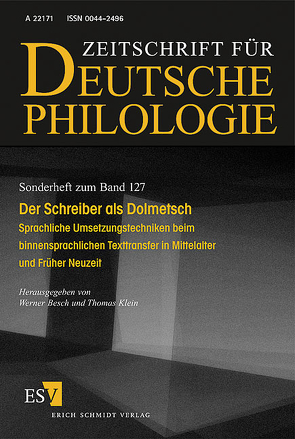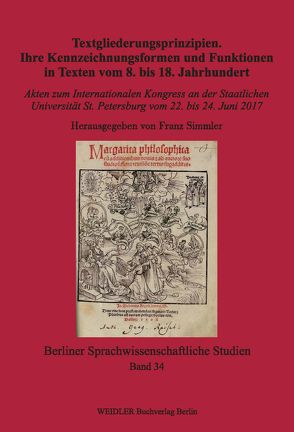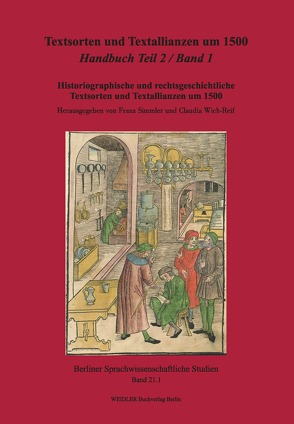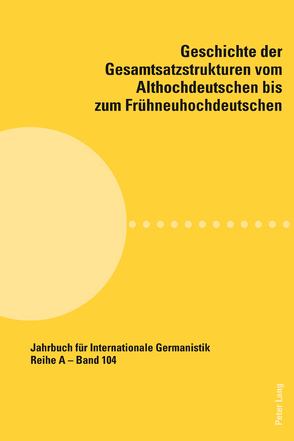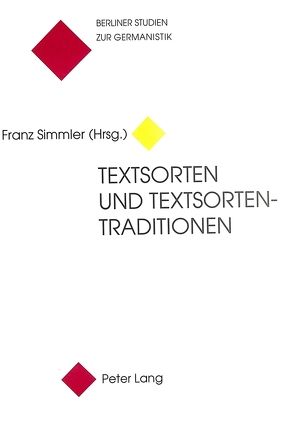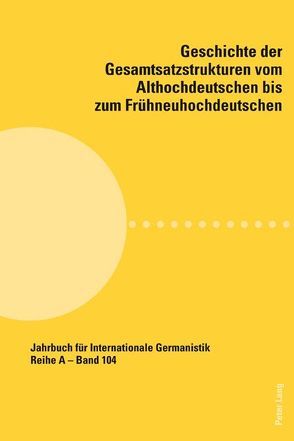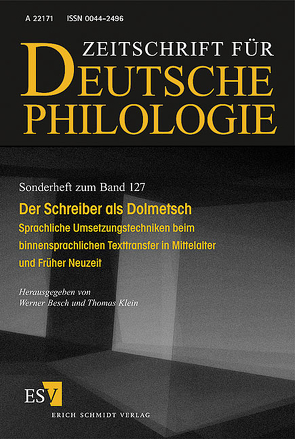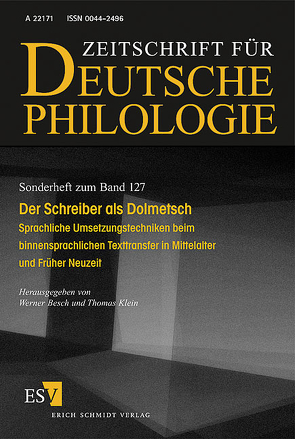
Vor der Etablierung einer überregionalen hochdeutschen Schrift- und Standardsprache seit dem 16. Jahrhundert war Textreproduktion als Abschrift oder Nachdruck in der Regel mit einer sprachlichen Anpassung verbunden, da die Vorlage einem anderen Schreibdialekt und/oder einen veralteten Sprachstand aufwies und daher nicht (mehr) problemlos verständlich war. Wie sind die mittelalterlichen Schreiber, wie die Drucker der beginnenden Frühen Neuzeit bei dieser sprachlichen Anpassung vorgegangen? Dieser Frage wird in den Beiträgen des Sonderhefts an althochdeutschen, mittelhochdeutschen und frühneuhochdeutschen Beispielen aus sehr unterschiedlichen Textsorten nachgegangen. Bei allen Unterschieden tritt dabei ein tendenziell einheitliches Verhalten der Schreiber und Drucker zu Tage: Sie waren bemüht, die Inhaltsseite des Textes möglichst unverändert zu lassen und auch die ausdrucksseitige Anpassung auf das Nötigste zu beschränken.
Die Beiträge des Sonderhefts decken den Zeitraum von der althochdeutschen Zeit bis ins 17. Jahrhundert und ein breites Spektrum von Textsorten ab. Die Ergebnisse und methodischen Zugriffe sind sowohl für Sprachhistoriker als auch für Mediävisten von Interesse.
Aktualisiert: 2023-06-24
Autor:
Paul Bennett,
Rolf Bergmann,
Werner Besch,
Martin Durrell,
Astrid Ensslin,
Walter Haas,
Walter Hoffmann,
Thomas Klein,
Robert Peters,
Bernhard Schnell,
Franz Simmler,
Stefanie Stricker,
Peter Wiesinger
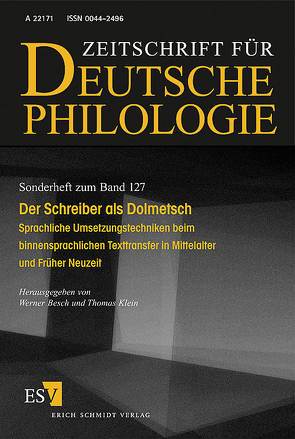
Vor der Etablierung einer überregionalen hochdeutschen Schrift- und Standardsprache seit dem 16. Jahrhundert war Textreproduktion als Abschrift oder Nachdruck in der Regel mit einer sprachlichen Anpassung verbunden, da die Vorlage einem anderen Schreibdialekt und/oder einen veralteten Sprachstand aufwies und daher nicht (mehr) problemlos verständlich war. Wie sind die mittelalterlichen Schreiber, wie die Drucker der beginnenden Frühen Neuzeit bei dieser sprachlichen Anpassung vorgegangen? Dieser Frage wird in den Beiträgen des Sonderhefts an althochdeutschen, mittelhochdeutschen und frühneuhochdeutschen Beispielen aus sehr unterschiedlichen Textsorten nachgegangen. Bei allen Unterschieden tritt dabei ein tendenziell einheitliches Verhalten der Schreiber und Drucker zu Tage: Sie waren bemüht, die Inhaltsseite des Textes möglichst unverändert zu lassen und auch die ausdrucksseitige Anpassung auf das Nötigste zu beschränken.
Die Beiträge des Sonderhefts decken den Zeitraum von der althochdeutschen Zeit bis ins 17. Jahrhundert und ein breites Spektrum von Textsorten ab. Die Ergebnisse und methodischen Zugriffe sind sowohl für Sprachhistoriker als auch für Mediävisten von Interesse.
Aktualisiert: 2023-06-24
Autor:
Paul Bennett,
Rolf Bergmann,
Werner Besch,
Martin Durrell,
Astrid Ensslin,
Walter Haas,
Walter Hoffmann,
Thomas Klein,
Robert Peters,
Bernhard Schnell,
Franz Simmler,
Stefanie Stricker,
Peter Wiesinger
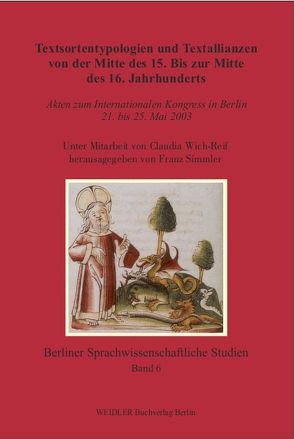
Vorwort. Von FRANZ SIMMLER
I. Literarische Textsorten
DANIELLE BUSCHINGER: Die Prosa im 15. Jahrhundert im deutschen Sprachraum. Christine de Pizan „deutsch“
EVELYN SCHERABON FIRCHOW: Gottfrieds von Straßburg „Tristan und Isolde“: Handschriftenallianzen, Ende oder Neuanfang?
ALBRECHT CLASSEN: Die deutschen Liederbücher des 15. und 16. Jahrhunderts. Kritische Sichtung eines spätmittelalterlichen Sammlungstypus
SIEGRID SCHMIDT: Narren des Mittelalters in Textallianzen
ALFRED NOE: Die Wiedergeburt der Tragödie im Opernlibretto. Von der italienischen Gattungsdiskussion des 16. Jahrhunderts zu einer neuen Textsorte
II. Historiographische und juristische Textsorten
ILPO TAPANI PIIRAINEN: Rechtshandschriften der Frühen Neuzeit aus dem Archiv von Leutschau/Levoca
JÖRG MEIER UND ARNE ZIEGLER: Textsorten und Textallianzen in städtischen Kanzleien
JÓZEF WIKTOROWICZ: Die Textsorte „Testament“ in der Krakauer Kanzleisprache
KRYSTYNA WALIGÓRA: Keynem ledigen knechte geben wir unsere czeche – Zu den syntaktischen Strukturen in den Krakauer Zunftsatzungen des Behem-Codex
HELENA HASILOVÁ: Das Stadtbuch von Dux
GISELA BRANDT: Textsorten weiblicher Chronistik. Beobachtungen an den chronikalischen Aufzeichnungen von Agnes Sampach (-1406/07), Elisabeth Kempf (um 1470), Ursula Pfaffinger (1494-1509) und Caritas Pirckheimer (1524-1527)
GABRIELE VON OLBERG-HAVERKATE: Überlegungen zur Edition der „Sächsischen Weltchronik“
URSULA SCHULZE: Textallianzen in Ulrich Tenglers „Layenspiegel“
PETER WIESINGER: Österreichische Adelsbriefe des 16. bis 18. Jahrhunderts als Textsorte
PAUL RÖSSLER: Graphematische Variation in österreichischen Adelsbriefen des 16. Jahrhunderts
THOMAS BROOKS: Spuren von Mündlichkeit? Überlegungen zur Verortung von Briefen der Frühen Neuzeit zwischen Sprechsprache und Schriftlichkeit
III. Religiöse Textsorten
FRANZ SIMMLER: Grundlagen einer Typologie religiöser Textsorten vom 2. Viertel des 15. bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts: Die Textsorten „(Geoffenbarte) Erzählung“, „(Geoffenbarter) Bericht“, „Historienbibel“ und „Biblia pauperum“
CLAUDIA WICH-REIF: Briefliteratur in der Bibel (1466 bis Septembertestament) – Der Brief des Paulus an die Laodicener und seine Gesamtsatzstrukturen
OLIVIER TACHE: Vollsätze und Perioden in Bibelübersetzungen und Flugschriften der Zürcher Reformation
ULRICH MÖLLMANN: Kohärenzaktualisierung. Zur „Benediktinerregel mit Auslegung“ der Handschrift München, BSB Cgm 639
ERWIN KOLLER: Blaue Enten – Zur Textallianz zwischen Predigt und Exempel (am Beispiel Geilers)
ALBRECHT GREULE: Gesangbuch und Kirchenlied im Textsortenspektrum des Frühneuhochdeutschen
IV. Verschiedene Textsorten
MONIKA RÖSSING-HAGER: Ortholph Fuchspergers „Dialectica“ – ein Repräsentant frühneuzeitlicher artes-Literatur
MECHTHILD HABERMANN: Textallianzen in lateinischen und deutschen Frühdrucken naturkundlich-medizinischen Inhalts
KARIN KRANICH-HOFBAUER: Die Suche nach der Ordnung im Chaos. Textallianzen in der Grazer Handschrift 1609
GALINA BAEVA: Handlungsanweisungen in mittelalterlichen Kochrezepten
SUSANNE LANG: Briefe aus dem Kloster: Zur Korrespondenz der Äbtissin Anna Paumann (1552-1571)
GERSON ROBERTO NEUMANN: Hans Stadens „Warhafftig Historia und Beschreibung eyner Landschafft der wilden nacketen grimmigen Menschenfresser-Leuthen in der Newenwelt America gelegen“. Ein informierender Text?
Aktualisiert: 2023-05-31
> findR *
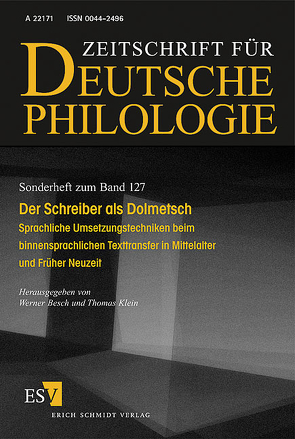
Vor der Etablierung einer überregionalen hochdeutschen Schrift- und Standardsprache seit dem 16. Jahrhundert war Textreproduktion als Abschrift oder Nachdruck in der Regel mit einer sprachlichen Anpassung verbunden, da die Vorlage einem anderen Schreibdialekt und/oder einen veralteten Sprachstand aufwies und daher nicht (mehr) problemlos verständlich war. Wie sind die mittelalterlichen Schreiber, wie die Drucker der beginnenden Frühen Neuzeit bei dieser sprachlichen Anpassung vorgegangen? Dieser Frage wird in den Beiträgen des Sonderhefts an althochdeutschen, mittelhochdeutschen und frühneuhochdeutschen Beispielen aus sehr unterschiedlichen Textsorten nachgegangen. Bei allen Unterschieden tritt dabei ein tendenziell einheitliches Verhalten der Schreiber und Drucker zu Tage: Sie waren bemüht, die Inhaltsseite des Textes möglichst unverändert zu lassen und auch die ausdrucksseitige Anpassung auf das Nötigste zu beschränken.
Die Beiträge des Sonderhefts decken den Zeitraum von der althochdeutschen Zeit bis ins 17. Jahrhundert und ein breites Spektrum von Textsorten ab. Die Ergebnisse und methodischen Zugriffe sind sowohl für Sprachhistoriker als auch für Mediävisten von Interesse.
Aktualisiert: 2023-05-24
Autor:
Paul Bennett,
Rolf Bergmann,
Werner Besch,
Martin Durrell,
Astrid Ensslin,
Walter Haas,
Walter Hoffmann,
Thomas Klein,
Robert Peters,
Bernhard Schnell,
Franz Simmler,
Stefanie Stricker,
Peter Wiesinger
Der vorliegende Band enthält 25 Beiträge zu den Textgliederungsprinzipien in Textsorten und Textallianzen vom Althochdeutschen bis zum Neuhochdeutschen. Behandelt werden Marginalien in Bibeln und Bibelkommentaren, sprachliche Register in der Tatianbilingue und in Otfrids Evangelienbuch, Exklamative im Mittelhochdeutschen, Kapitelüberschriften in literarischen Texten, Summarien in Bibeltraditionen, der Tristan-Roman, die Livländische Reimchronik, Regelkommentare, Gebete und Gebetbücher, Stammbücher, Sonette, periodische Zeitungen einschließlich der Gunsterweisungsberichte, Briefwechsel, ein Kochbuch und ein Reiseratgeber sowie computerunterstützte Analysen typographischer Mittel in erbaulichen Textsorten und Zeitungen.
Aktualisiert: 2020-01-20
> findR *
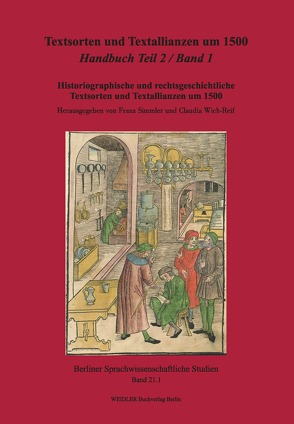
Der erste Teilband umfasst historiographische und rechtsgeschichtliche Textsorten und Textallianzen mit Beiträgen zu Universal- und Stadtchroniken, zu Kanzleisprachen, zu Urkunden und Briefen, zur Schriftlichkeit von Klosterfrauen und zu ländlichen, den Adel betreffenden und städtischen Rechtsquellen.
In allen Artikeln wird auf die originale handschriftliche bzw. gedruckte Überlieferung und nicht nur auf mehr oder weniger stark normalisierende Editionen, die für einen Großteil der behandelten Textexemplare nicht vorhanden sind, zurückgegriffen. Aufgenommen sind die benutzten handschriftlichen und/oder gedruckten Quellen einschließlich der besitzenden Bibliothek und Signatur. Dargestellt sind die aus den Überlieferungen ermittelten externen Merkmale der Kommunikation, in die die Textexemplare eingebunden sind, und die internen Merkmale, vor allem die Kennzeichnungen von Beginn und Ende der Textexemplare und die makrostrukturellen, syntaktischen und lexikalischen Merkmale, die zur Aufstellung einer Typologie von Textsorten und Textallianzen führen.
Der zweite Teilband enthält einen Forschungsüberblick über die Klassifizierungen in Rechtsgeschichte, Archivwissenschaft, Geschichte, Literaturwissenschaft und Sprachwissenschaft zu den Überlieferungsformen in der Rechts-, Verwaltungs- und Geschäftspraxis und behandelt die Textsortengruppen der Ordnungen für das Heilige Römische Reich deutscher Nation, für die Territorien und für Stadt und Dorf.
In allen Artikeln wird auf die originale handschriftliche bzw. gedruckte Überlieferung und nicht nur auf mehr oder weniger stark normalisierende Editionen, die für einen Großteil der behandelten Textexemplare nicht vorhanden sind, zurückgegriffen. Aufgenommen sind die benutzten handschriftlichen und/oder gedruckten Quellen einschließlich der besitzenden Bibliothek und Signatur. Dargestellt sind die aus den Überlieferungen ermittelten externen Merkmale der Kommunikationen, in die die Textexemplare eingebunden sind, und die internen Merkmale, vor allem die Kennzeichnungen von Beginn und Ende der Textexemplare und die makrostrukturellen, syntaktischen und lexikalischen Merkmale, die zur Aufstellung einer Typologie von Textsorten und Textallianzen führen.
Aktualisiert: 2020-01-20
> findR *
Gesamtsätze, ihre Strukturen und Funktionen wurden in der historischen Syntax des Deutschen bisher vernachlässigt. Ihre Behandlung ist das Ziel der neun Beiträge dieses Sammelbandes. Alle Arbeiten sind empirisch orientiert und berücksichtigen bisher noch nicht ausgewertete Materialien vom Althochdeutschen bis zur Gegenwartssprache. Theoretisch geklärt werden die Termini Gesamtsatz, Ganzsatz und Periode, das Verhältnis von Vers und Satz in der Bibelsprache und die Möglichkeiten der Ermittlung von Satzgrenzen bei Überlieferungen, in denen in der Gegenwartssprache bekannte Normen der Begrenzung nicht existieren. Neu ist die Verbindung von Syntax und Textlinguistik, indem die Relevanz der Gesamtsätze bei der Konstitution einzelner Textsorten wie Prosaroman, Erzählung, Zunftsatzung, Biographie, Bericht, Vision, Vita Christi und Ordensregel herausgearbeitet wird.
Aktualisiert: 2020-09-01
> findR *
Der vorliegende Sammelband enthält 19 (zum Teil erweiterte) Vorträge, die im Rahmen des internationalen Kongresses „Zur syntaktischen Variabilität in Synchronie und Diachronie gehalten wurden.
Einzelne Beiträge behandeln syntaktische Phänomene der Sprachstufen Alt-, Mittel-, Frühneuhochdeutsch und Neuhochdeutsch, weitere sind sprachstufenübergreifend, auf bestimmte Autoren (Nachtgall, Lessing, Goethe) und Texte (Otfrids Evangelienbuch) bzw. Textsorten (Ordensregel, Heldenepos, Gerichtsprotokolle) und Kommunikationsformen (Privatbriefe) oder Medien (Stats= und Gelehrte[n] Zeitung des Hamburgischen unpartheyischen Correspondenten) bezogen
Aktualisiert: 2020-01-20
> findR *
Gattung und Textsorte werden oft synonym verwandt – fälschlicherweise, wie die Untersuchung sowohl theoretisch als auch empirisch nachzuweisen sucht. Einer ausführlichen theoretischen Auseinandersetzung mit verschiedenen Gattungs- und Textsortenkonzeptionen folgt die Darlegung des eigenen, dem Strukturalismus verpflichteten Ansatzes. Dieser ist mit Blick auf das empirische Anliegen gewählt: die textsortenlinguistische Analyse, Beschreibung und Differenzierung literarischer Kurzprosagattungen aus der Zeit der Romantik. Acht Gattungen – Anekdote, Schwank, Kalendergeschichte, Sage, Legende, Märchen, Fabel und Parabel –, repräsentiert durch 116 Textexemplare, werden anhand eines eigens entwickelten Analyseinstrumentariums analysiert und klassifiziert. Die Untersuchungsergebnisse werden zu Schlußfolgerungen über grundlegende Eigenschaften der korrespondierenden Gattungsbegriffe genutzt.
Aktualisiert: 2023-04-15
> findR *
Vom 28. Juni bis 2. Juli 2000 fand im Jagdschloß Glienicke. International Meeting Center (Königstraße 36 B, 14109 Berlin) ein Internationales Symposion zum Thema „Entwicklungsetappen in der Geschichte der deutschen Sprache“ statt. Die Themenfixierung geht auf ein Teilprojekt „Geschichte der deutschen Sprache“ zurück, das im Rahmen der Partnerschaft zwischen der Freien Universität Berlin und der Universität St. Petersburg bearbeitet wird. Im Symposion wird den am Projekt beteiligten jüngeren Wissenschaftler(inne)n beider Universitäten die Gelegenheit gegeben, ihre Forschungsergebnisse zur Diskussion zu stellen und im Anschluß zu publizieren. Die gehaltenen Vorträge sind, zum Teil erweitert, hier abgedruckt. Innerhalb des Rahmenthemas ergaben sich zwei Themenschwerpunkte, nach denen die Beiträge alphabetisch geordnet sind: syntaktische und lexikalisch-semantische Entwicklungsetappen und textsortengebundene Entwicklungsetappen.
Aktualisiert: 2020-01-20
> findR *

Vorwort. Von YVON DESPORTES, FRANZ SIMMLER und CLAUDIA WICH-REIF
I. Sprachperiode des Althochdeutschen
YVON DESPORTES: So im althochdeutschen „Isidor“
REGINA FROSCHAUER: Wiederaufnahme durch Derivation im Althochdeutschen
ROSEMARIE LÜHR: Die Wiederaufnahme durch den Artikel im Althochdeutschen: Zur Akzentuierung von Definita
ANDREAS NIEVERGELT: Rekurrenz in den althochdeutschen Glossen
NATALIA PIMENOVA: Zum Einfluss der rückverweisenden Wörter und der Fokussierung auf die Verschiebung des finiten Verbs in der Isidorübersetzung
FRANZ SIMMLER: Formen der Wiederaufnahme in der lateinisch-althochdeutschen „Tatianbilingue“
MICHAEL SOLF: Status und Zugänglichkeit von Diskursreferenten im Althochdeutschen am Beispiel der „Tatianbilingue“ Cod. Sang. 56
II. Vom Althochdeutschen bis zum (Früh-)Neuhochdeutschen
JÜRG FLEISCHER: Die Syntax von Pronominaladverbien in der Sprachgeschichte des Deutschen: eine vorläufige Bestandsaufnahme
CLAUDIA WICH-REIF: Wiederaufnahme mittels da(r)-Bildungen und alternative Ausdrucksmöglichkeiten im Alt-, Mittel- und Frühneuhochdeutschen
III. Die Sprachperiode des Frühneuhochdeutschen
MAXI KRAUSE: Verweis mittels HERAB, HINAB, HIERAB und DARAB bei Othmar Nachtgall
MICHEL LÈFEVRE: Kontrastive Untersuchung zu (d-)selb(ig)- und anderen Einheiten des Wiederaufgreifens im 17. Jahrhundert. Ein systemischer Ansatz
DELPHINE PASQUES: Funktionen von selb-/selbig- in anaphorischen Nominalgruppen (untersucht in Mandevilles Reisen, 1480)
THÉRESE ROBIN: Er im „Wigalois“ von Wirnt von Grafenberg
ODILE SCHNEIDER-MIZONY: Indirekte Anapher und nominale Ketten in einer Reisebeschreibung des 16. Jahrhunderts
KRYSTYNA WALIGÓRA: Formen der Wiederaufnahme in juristischen Textsorten im Krakau des 15. Jahrhunderts
PETER WIESINGER: Formen der Wiederaufnahme am Beispiel eines österreichischen Adeligenbriefes des 17. Jahrhunderts
ARNE ZIEGLER: Referenzstrukturen in frühneuhochdeutscher Gebrauchsprosa
Aktualisiert: 2020-01-20
> findR *

Vorwort. Von Michel Lefèvre und Franz Simmler
I. Althochdeutsche Sprachperiode
RUDOLF SCHÜTZEICHEL: Der Sprache auf der Spur
THÉRESE ROBIN: Thanne bei Otfrid
ANDREAS NIEVERGELT: Relativpronomen in den althochdeutschen Glossen
REGINA FROSCHAUER / STEFANIE STRICKER: Huggen und denchen bei Notker
II. Mittelhochdeutsche Sprachperiode
DELPHINE PASQUES: Syntaktische, semantische und pragmatische Kennzeichen der Belege von denne im Lucidarius (12. Jahrhundert)
FRANZ SIMMLER: Evangelistare vom Ende des 13. und aus dem 14. Jahrhundert. Aufbauprinzipien und Funktionen
III. Frühneuhochdeutsche Sprachperiode
ODILE SCHNEIDER-MIZONY: Lässt sich ein stilistisches Modell des Renaissance-Romans zur Erklärung von syntaktischen Präferenzen anwenden?
MAXI KRAUSE: Zu Othmar Nachtgalls Gantz Euangelisch hystori (1528)
IV. Neuhochdeutsche Sprachperiode
MICHEL LEFÈVRE: Dann in den deutschen Zeitungen des 17. Jahrhunderts. Zwischen Konnektor und Markierung der Polyphonie
OLIVIER DUPLATRE: Zur semantischen Untersuchung des modernen denn
JEAN HAUDRY: Fröhliche Urständ
RENE PERENNEC: Wortmigration und Resilienz: französisch/ englisch ‚flair‘, deutsch ‚Flair‘
V. Sprachperioden übergreifende Untersuchungen
GABRIELE von OLBERG-HAVERKATE: Sprach- und Kulturgeschichte im Spiegel der Prosaweltchroniken des 13. bis 15. Jahrhunderts. Die Bezeichnungen für die Wochentage
CLAUDIA WICH-REIF: Krankheitsbezeichnungen in der Evangelientradition vom 14. bis zum 18. Jahrhundert
OLIVIER DUPLATRE / MICHEL LEFÈVRE / DELPHINE PASQUES / THÉRESE ROBIN: Bilanz zu thanne, denne, dann und denn
NÁNDOR CSIKY / ALBRECHT GREULE: Wörterbücher als Quellen der historischen Valenz-Forschung am Beispiel des Verbs verzeihen
JÓZEF WIKTOROWICZ: Die semantische Entwicklung der Partikel denn
Schriftenverzeichnis Yvon Desportes
Aktualisiert: 2020-01-20
> findR *
In den Beiträgen werden theoretische Aspekte einer Textsortenklassifizierung ebenso behandelt wie exemplarische Textsortenanalysen anhand von gegenwartssprachlichen und sprachgeschichtlichen Materialgrundlagen. Neben Beiträgen, die eine gesamte Textsortenanalyse vornehmen, gibt es solche, die einzelne textuelle Merkmale (wie Verbvalenz als Textsorten-Marker, Kategorie der emotionalen Wertung in der Lyrik, Raumerfahrung als Textdimension, Etikettenformeln bzw. Phraseologien im Text) zum Gegenstand haben.
Aktualisiert: 2019-12-19
> findR *

Die Murbacher Hymnen sind die einzige althochdeutsche Interlinearversion einer lateinischen Hymnensammlung aus dem ersten Viertel des 9. Jahrhunderts, entstanden vermutlich auf der Reichenau. In der vorliegenden Arbeit steht im Mittelpunkt, die Qualität der althochdeutschen Übersetzung im Vergleich mit ihrer lateinischen Vorlage zu bewerten. Damit verbunden ist die Frage nach der Funktion der ahd. interlinearen Übertragung im Rahmen des Unterrichts im klösterlichen Schulbetrieb. Dazu ist es notwendig, die als Vorlage dienenden lateinischen Hymnen zu interpretieren, sprachlich zu analysieren und anschließend die althochdeutsche Interlinearversion als Hilfsmittel zum angemessenen Verständnis des lateinischen Textes zu bewerten. Mögliche Beziehungen zu anderen Übersetzungen und Glossaren des alemannischen Sprachraums werden dabei berücksichtigt. Grundlage der Textarbeit ist eine handschriftennahe Edition, d.h. eine Edition, die den althochdeutschen Text interlinear über dem lateinischen anordnet. Dabei wurde die einzige erhaltene Handschrift in der Bodleian Library in Oxford zugrunde gelegt.
Aktualisiert: 2020-01-20
> findR *
Im Sammelband sind Beiträge von Wissenschaftlern aus St. Petersburg und Berlin zur Lexik, zur Syntax und speziell zur Valenztheorie, zur Textlinguistik und zur Sprachgeschichte mit syntaktischen und textlinguistischen Schwerpunkten vertreten. Thematisch und methodologisch sind die neuen Konzeptionen und ihre Anwendungen auf eine breite empirische Grundlage verbunden durch das Bemühen, Strukturerkenntnisse mit Funktionsermittlungen zu verbinden.
Aktualisiert: 2019-12-19
> findR *
Der Autor untersucht Reiseführer, Werbebroschüren, Reisekataloge sowie Zeitungen und gibt einen repräsentativen Überblick über die vorkommenden Textsorten. Zudem spannt er einen Bogen zur Betriebswirtschaftslehre. Die dort üblichen Vorschläge zur Gestaltung von Werbeanzeigen überprüft er auf ihre praktische Relevanz.
Aktualisiert: 2020-01-20
> findR *

Vorwort. Von FRANZ SIMMLER und CLAUDIA WICH-REIF
I. Althochdeutsche Sprachperiode
YVON DESPORTES: Die Funktion von selb in der Anapher im althochdeutschen „Isidor“
MIKHAIL KORYSHEV: Christi Geburt in der Vulgata, im „Heliand“ und bei Otfrid aus sprachpragmatischer Sicht
FRANZ SIMMLER: Reihenfolge und Aufbauprinzipien von Satzgliedern in der lateinisch-althochdeutschen „Tatianbilingue“ und in Otfrids „Evangelienbuch“ und ihre Textfunktionen
CLAUDIA WICH-REIF: Präteritopräsentien in der „Tatianbilingue“ und in Otfrids „Evangelienbuch“
II. Mittelhochdeutsche Sprachperiode
NIKOLAI A. BONDARKO: Die sprachlichen Erscheinungsformen der deontischen Modalität in der Epistola ad fratres de Monte Dei Wilhelms von Saint-Thierry und in deren mittelhochdeutscher Übertragung
NATALIA GORBEL: Substantivgruppen mit Possessivpronomen in mittelhochdeutschen literarischen Gattungen
NORBERT RICHARD WOLF: Das Verbalpräfix ge - in mittelhochdeutschen Urkunden
III. Frühneuhochdeutsche Sprachperiode
DANIELLE BUSCHINGER: Zur Verbstellung im frühneuhochdeutschen Prosaroman exemplifiziert am „Prosa-Tristrant“ (1484)
MECHTHILD HABERMANN: Koordination und Subordination in der Syntax von Gebrauchstexten aus der Inkunabelzeit
GALINA S. MOSKALJUK: Makrostrukturelle Kontinuitäten und Veränderungen in den ältesten deutschen Kochrezepten
LARISSA NEBORSJAKA: Besonderheiten der syntaktischen Struktur der direkten und indirekten Rede im deutschen Volksbuch vom 16. bis 18. Jahrhundert
MARINA A. OLEYNIK: Zur Textsortengebundenheit der Adressatenbezeichnung (am Beispiel von Widmungen und Vorreden zu literarischen Texten des 16. Jahrhunderts)
IV. Gegenwartssprache
LILJA BIRR-TSURKAN: Der syntaktische Aufbau deutscher Balladen
KONSTANTIN FILIPPOV: Zur Geschichte der germanistischen Textlinguistik in Russland (unter besonderer Berücksichtigung der Textsyntax)
ALBRECHT GREULE: Die Parenthese in der deutschen Sprache: Gegenwart und Geschichte
XENIA NOVOZHILOWA: Metanarrative Einheiten in literarischen Texten des 19. und 20. Jahrhunderts. Ihre Formen und Funktionen
GALINA K. SCHAPOVALOVA: Einfluss des Genres/der Textsorte auf die syntaktische Gestaltung der deutschen Sonett-Texte
Aktualisiert: 2020-01-20
> findR *
Gesamtsätze, ihre Strukturen und Funktionen wurden in der historischen Syntax des Deutschen bisher vernachlässigt. Ihre Behandlung ist das Ziel der neun Beiträge dieses Sammelbandes. Alle Arbeiten sind empirisch orientiert und berücksichtigen bisher noch nicht ausgewertete Materialien vom Althochdeutschen bis zur Gegenwartssprache. Theoretisch geklärt werden die Termini Gesamtsatz, Ganzsatz und Periode, das Verhältnis von Vers und Satz in der Bibelsprache und die Möglichkeiten der Ermittlung von Satzgrenzen bei Überlieferungen, in denen in der Gegenwartssprache bekannte Normen der Begrenzung nicht existieren. Neu ist die Verbindung von Syntax und Textlinguistik, indem die Relevanz der Gesamtsätze bei der Konstitution einzelner Textsorten wie Prosaroman, Erzählung, Zunftsatzung, Biographie, Bericht, Vision, Vita Christi und Ordensregel herausgearbeitet wird.
Aktualisiert: 2023-04-11
> findR *
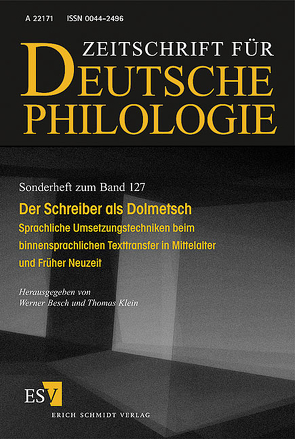
Vor der Etablierung einer überregionalen hochdeutschen Schrift- und Standardsprache seit dem 16. Jahrhundert war Textreproduktion als Abschrift oder Nachdruck in der Regel mit einer sprachlichen Anpassung verbunden, da die Vorlage einem anderen Schreibdialekt und/oder einen veralteten Sprachstand aufwies und daher nicht (mehr) problemlos verständlich war. Wie sind die mittelalterlichen Schreiber, wie die Drucker der beginnenden Frühen Neuzeit bei dieser sprachlichen Anpassung vorgegangen? Dieser Frage wird in den Beiträgen des Sonderhefts an althochdeutschen, mittelhochdeutschen und frühneuhochdeutschen Beispielen aus sehr unterschiedlichen Textsorten nachgegangen. Bei allen Unterschieden tritt dabei ein tendenziell einheitliches Verhalten der Schreiber und Drucker zu Tage: Sie waren bemüht, die Inhaltsseite des Textes möglichst unverändert zu lassen und auch die ausdrucksseitige Anpassung auf das Nötigste zu beschränken.
Die Beiträge des Sonderhefts decken den Zeitraum von der althochdeutschen Zeit bis ins 17. Jahrhundert und ein breites Spektrum von Textsorten ab. Die Ergebnisse und methodischen Zugriffe sind sowohl für Sprachhistoriker als auch für Mediävisten von Interesse.
Aktualisiert: 2023-05-02
Autor:
Paul Bennett,
Rolf Bergmann,
Werner Besch,
Martin Durrell,
Astrid Ensslin,
Walter Haas,
Walter Hoffmann,
Thomas Klein,
Robert Peters,
Bernhard Schnell,
Franz Simmler,
Stefanie Stricker,
Peter Wiesinger
Aktualisiert: 2019-01-08
> findR *
MEHR ANZEIGEN
Bücher von Simmler, Franz
Sie suchen ein Buch oder Publikation vonSimmler, Franz ? Bei Buch findr finden Sie alle Bücher Simmler, Franz.
Entdecken Sie neue Bücher oder Klassiker für Sie selbst oder zum Verschenken. Buch findr hat zahlreiche Bücher
von Simmler, Franz im Sortiment. Nehmen Sie sich Zeit zum Stöbern und finden Sie das passende Buch oder die
Publiketion für Ihr Lesevergnügen oder Ihr Interessensgebiet. Stöbern Sie durch unser Angebot und finden Sie aus
unserer großen Auswahl das Buch, das Ihnen zusagt. Bei Buch findr finden Sie Romane, Ratgeber, wissenschaftliche und
populärwissenschaftliche Bücher uvm. Bestellen Sie Ihr Buch zu Ihrem Thema einfach online und lassen Sie es sich
bequem nach Hause schicken. Wir wünschen Ihnen schöne und entspannte Lesemomente mit Ihrem Buch
von Simmler, Franz .
Simmler, Franz - Große Auswahl an Publikationen bei Buch findr
Bei uns finden Sie Bücher aller beliebter Autoren, Neuerscheinungen, Bestseller genauso wie alte Schätze. Bücher
von Simmler, Franz die Ihre Fantasie anregen und Bücher, die Sie weiterbilden und Ihnen wissenschaftliche Fakten
vermitteln. Ganz nach Ihrem Geschmack ist das passende Buch für Sie dabei. Finden Sie eine große Auswahl Bücher
verschiedenster Genres, Verlage, Schlagworte Genre bei Buchfindr:
Unser Repertoire umfasst Bücher von
- Simmon, Scott
- Simmon-Kammann, Maria-Regina
- Simmonds, H.Anne
- Simmonds, Martin
- Simmonds, Posy
- Simmons, Anna
- Simmons, Anthea
- Simmons, Ben
- Simmons, Charles
- Simmons, Curt
Sie haben viele Möglichkeiten bei Buch findr die passenden Bücher für Ihr Lesevergnügen zu entdecken. Nutzen Sie
unsere Suchfunktionen, um zu stöbern und für Sie interessante Bücher in den unterschiedlichen Genres und Kategorien
zu finden. Neben Büchern von Simmler, Franz und Büchern aus verschiedenen Kategorien finden Sie schnell und
einfach auch eine Auflistung thematisch passender Publikationen. Probieren Sie es aus, legen Sie jetzt los! Ihrem
Lesevergnügen steht nichts im Wege. Nutzen Sie die Vorteile Ihre Bücher online zu kaufen und bekommen Sie die
bestellten Bücher schnell und bequem zugestellt. Nehmen Sie sich die Zeit, online die Bücher Ihrer Wahl anzulesen,
Buchempfehlungen und Rezensionen zu studieren, Informationen zu Autoren zu lesen. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
das Team von Buchfindr.