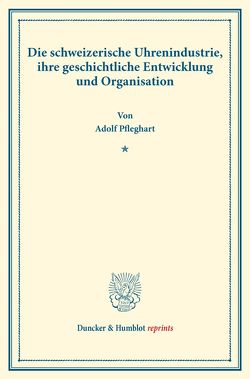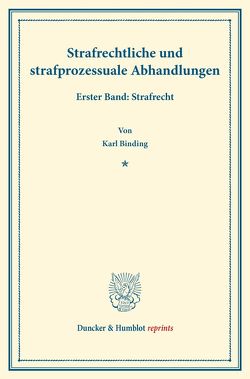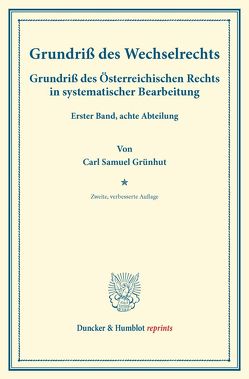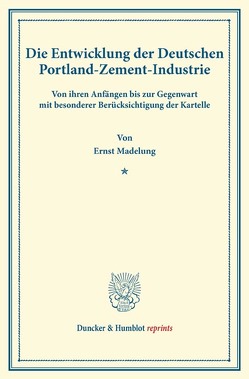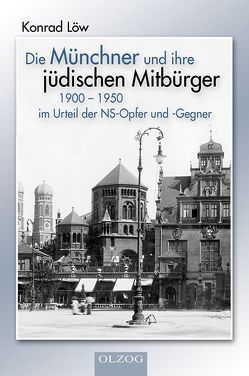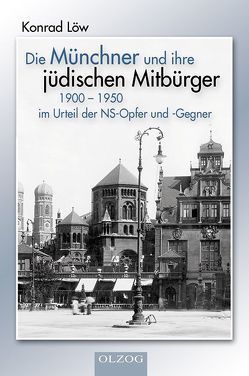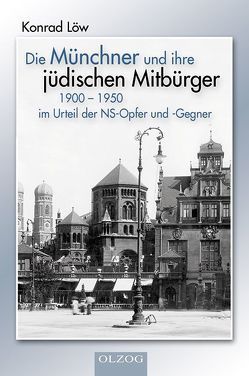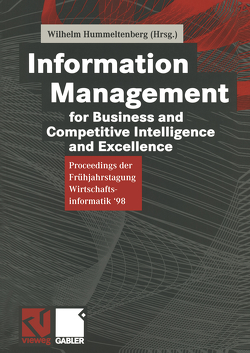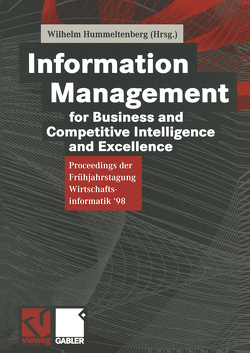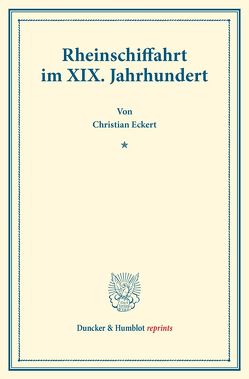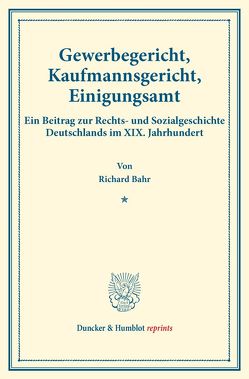Autoren Biografie
»Jurist, Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, * 28.12.1874 Zürich, † 1.1.1960 Zürich.
Huber entstammt einer großbürgerlichen Zürcher Familie der industriellen Gründerepoche. Als Verwaltungsratspräsident der Großunternehmungen der Schweizerischen Aluminium-Industrie AG (heute Alusuisse) und der Maschinenfabrik Oerlikon AG (MFO) – auf alle finanziellen Bezüge nun diesen Stellungen verzichtet er während der Dauer seiner diplomatischen, richterlichen und philantropischen Tätigkeit – sowie als Mitglied und Vorsitzender zahlreicher traditionsverpflichteter Gesellschaften Zürichs und der Schweiz bewahrt er äußerlich die Prägung durch diese feudale Lebenssphäre, wiewohl er innerlich im Laufe einer langen Entwicklung und eines weltweiten Wirkens weit über sie hinausgewachsen ist.
Huber schwankt zunächst zwischen einer Laufbahn in der Mathematik, im Bankwesen, in der Theologie und in der Jurisprudenz, um sich schließlich entschlossen der letzten zuzuwenden, wobei er von vornherein an ein diplomatisches Wirken denkt. Durch sein Interesse für Geschichte, Kunst, Musik, Politik, Militär, aber auch für Glaubensprobleme, durch seine Verbindungen mit Wirtschaft und Industrie und durch seine Reisen in alle Kontinente erhalten seine Bildung und seine Persönlichkeit universale Züge. Das juristische Denken wird zunächst auf der Universität (Lausanne, Zürich und Berlin 1894–97) stark durch Huber F. Hitzig in Zürich und Bernhard Hübler in Berlin, literarisch durch Ihering, Gierke und Andreas Heusler im Sinne des damals herrschenden Rechtspositivismus beeinflußt. Diese Grundauffassung prägt in Methode wie Begrifflichkeit die umfangreiche Dissertation ›Die Staatensuccession‹ (1897), die in Staats- und völkerrechtlichen Kreisen Aufsehen erregt und Huber bald darauf – der Ruf erreicht ihn auf einer 2jährigen Weltreise in Tokio – den ordentlichen Lehrstuhl für Staats-, Völker- und Kirchenrecht in Zürich einträgt. Sein akademisches Wirken dauert nicht lang, denn ab 1907 wird Huber in steigendem Maß vom schweizerischen Bundesrat mit diplomatischen und rechtskonsularischen Aufgaben betraut; 1919 gibt er den Lehrstuhl endgültig auf.
Seine Rechtsauffassung, die sich in Wechselwirkung von akademischer Lehrtätigkeit, diplomatischen und richterlichen Aufgaben und einer zunehmenden Beschäftigung mit sozialen, ethischen und theologischen Fragen entfaltet, zeigt die Wandlung vom Rechtspositivismus über einen optimistischen Rechtsidealismus zu einem betont christlichen, von verborgen skeptischen Zügen durchwobenen Rechtsethos. Das Recht – so heißt es im Beginn noch – hat die Aufgabe, ein bestehendes, historisch gewordenes Rechtsverhältnis in allgemein anwendbare, abstrakte und auf die Fülle der konkreten Fälle anwendbare Normen zu fassen. Diese Normen sind vom Juristen zunächst auf ihre logisch-empirische Brauchbarkeit, nicht auf einen möglichen ethischen Gehalt zu prüfen. Aber diese klassische Idee des Rechtspositivismus, bei der Recht nichts anderes als der Ausdruck bestehender Machtstrukturen ist, vermag Huber immer weniger zu befriedigen. Er durchschaut von einem ethischen Grundgefühl, aber noch mehr von einer christlichen Verantwortlichkeit aus ihre Fragwürdigkeit, die Anmaßung ihrer Eigengesetzlichkeit, wiewohl er lebenslang um den formalen Wert des positiven Rechtes weiß und betont, daß auf klaren Rechtsbegriffen und auf dem Respekt vor dem gültigen, funktionierenden Recht sowohl die Ordnung des Rechtsstaates wie die Möglichkeit des ihn speziell interessierenden, zu seiner eigentlichen Berufung gewordenen Völkerrechtes beruht. Aber immer mehr wird bei ihm der systematischspekulative Trieb durch das sozialethische Streben im Recht, wird die bloße Jurisprudenz vom beherrschenden Gedanken der Gerechtigkeit abgelöst. Die Entwicklung zeigt sich klar und zielstrebig von seinem Hauptwerk ›Die soziologischen Grundlagen des Völkerrechtes‹ (1910) bis zu seiner späten Schrift ›Wesen und Würde der Jurisprudenz‹ (1948). Huber unterscheidet zwischen dem statischen und dem dynamischen Recht, aber nicht als Alternativen, sondern als notwendigen Stufen; die Relation zwischen beiden wird hergestellt durch die Idee der Gerechtigkeit. Der Rechtsgehorsam ist nicht mehr das Produkt einerseits der Furcht vor der Macht, anderseits der bloße Ausfluß eines logischen Bedürfnisses, sondern das Ergebnis der inneren Bindung an die Rechtsidee, des Suchens nach dem ›gerechten Recht‹. Dabei wird die Frage nach dem absoluten Beziehungspunkt als dem unverrückbaren Grund alles Rechtes für Huber immer dringlicher, und so kommt er, um dem Relativismus zu entgehen, immer klarer zu einer religiösen Begründung und Deutung des Rechtes. Wer wirklich Recht sagt, sagt Gerechtigkeit. Und wer wirklich Gerechtigkeit sagt, sagt Gott. Damit ist die Frage nach dem materiellen Inhalt der Gerechtigkeit beantwortet, die im Rechtsidealismus noch offen blieb: ›Gerecht ist jedenfalls nur das Recht, das dem göttlichen Willen entspricht.‹
Doch diese in langer Bemühung erworbene Rechtsauffassung wird bei Huber nie zur festgeprägten Theorie. Er erkennt die Interdependenz zwischen dem Rechtsdenken und anderen Sphären des Geistigen, dem Politischen, Wirtschaftlichen, Sozialen und Ethischen und hält oft das ganze Problem im Zustand der Schwebe, des Wachstums, der Läuterung, und auch dann noch, wenn er seinen abgeklärten und bekenntnishaft christlichen Standpunkt gewonnen hat, bleibt und wird er erst recht offen für alle Fragen, tolerant für alle Standpunkte, sucht die Begriffe an der Erfahrung auf ihre Tauglichkeit hin zu prüfen. Dieses umsichtige Streben nach der Gerechtigkeit realisiert sich in Hubers weit ausgreifender diplomatischer, staatsmännischer und richterlicher Tätigkeit. Sie beginnt mit seiner Teilnahme an der II. Friedenskonferenz im Haag (1907), an der Huber – als weitaus jüngster offizieller Delegierter – erstmals schmerzlich den Zusammenstoß mit der vom reinen Machtdenken und nationalem Egoismus diktierten Diplomatie der Großmächte, aber auch die Ohnmacht des nur auf das Recht vertrauenden Kleinstaates erlebt. Die Formel vom ›reziproken Fakultativ-Obligatorium‹ der Schiedsgerichtsbarkeit, mit der er den Gedanken der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit nach dem Scheitern des allgemeinen Obligatoriums zu retten versucht, ist seine originelle Idee. Sie dringt zwar damals nicht durch, taucht aber in der späteren Völkerbundspolitik wieder auf und wird wörtlich in die Locarno-Verträge übernommen (1925). Von jetzt an ist Hubers leidenschaftliches Engagement für die völkerrechtlichen Ziele, auch das Streben, den schweizerischen Staat an den internationalen Aufgaben zu interessieren, ihn aus dem kleinmütigen Hang zur Geborgenheit herauszuholen, in steigendem Maß zu spüren. Als Rechtskonsulent der Regierung für internationale Fragen in den Jahren 1907–22 hat er vorab zwei Ziele: durch ein System von Schiedsverträgen die Schweiz in eine festgefügte internationale Rechtsordnung zu verpflichten, und zugleich, vor allem in den Kriegs- und Nachkriegsjahren, der schweizerisch Neutralitätspolitik eine für den Weltfrieden fruchtbare Zielsetzung zu geben. Er wird der Ratgeber der vier schweizerischen Außenminister A. Hoffmann, G. Ador, F. Calonder und G. Motta, schafft schon mitten im Krieg einen Entwurf für den Völkerbund (1917), der von der Schweiz den Großmächten vermittelt wird, aber im Schatten von Wilsons Projekt verschwindet, bereitet behutsam den Beitritt der Schweiz zum Völkerbund vor, indem er dabei in intensiven Verhandlungen mit Clémenceau, Poincaré, Wilson, Lloyd George und Lord Balfour die Anerkennung des schweizerischen Neutralitätsstatutes erreicht, bestimmt überhaupt in jenen Jahren als die ›Graue Eminenz‹ des Bundesrates faktisch die schweizerische Außenpolitik und tritt zuletzt im Volksabstimmungskampf selbst in die Arena, nachdem er zuvor die bundesrätliche Botschaft zum Völkerbundsbeitritt – wohl das bedeutsamste staatsrechtliche Dokument der schweizerischen Außenpolitik jener Jahre – verfaßt hatte. Seine Teilnahme an all diesen Aufgaben ist geprägt von juristisch-politischem Scharfblick, von tiefem humanitärem Verantwortlichkeitsgefühl für den Völkerfrieden und von Sorge um das echte Patrimonium seines Landes. Doktrinärem Internationalismus steht er skeptisch gegenüber. Andererseits gilt sein Kampf der Vergötzung der staatlichen Souveränitätsidee, die jede völkerrechtliche Ordnung immer wieder illusorisch zu machen droht, und die Heranbildung ethischer Voraussetzungen für die Schaffung besserer völkerrechtlicher Ordnungen und Normen gewinnt in seinem Denken und Handeln immer mehr die Priorität. Im Schiedsvertrag Deutschland/Schweiz (1921) – dem ersten internationalen Vertrag, den das besiegte Deutschland frei abschließen konnte – schuf er ein Modell solch ethisch fundierter Ordnung, das für zahlreiche internationale Verträge maßgebend wurde.
Nach kurzer Wirksamkeit als schweizerischer Völkerbundsdelegierter – er durchschaute klar die Mängel in der Struktur und Situation der Institution, und Völkerbundspolitik war für ihn nicht das Ziel, sondern der Ausgangspunkt für die Bemühungen um den Völkerfrieden – wurde Huber am 14.9.1921 zum Mitglied des neugeschaffenen Ständigen Internationalen Gerichtshofes im Haag gewählt. Schon bei der Ausarbeitung seines Statuts in der Völkerbundsversammlung war er maßgebend beteiligt, und er setzte beim Antritt seines Amtes große Hoffnungen in diese Institution, der allerdings beim Arbeitsbeginn zwei wesentliche Voraussetzungen fehlten, über die jedes normale Gericht verfügen muß: ein konzipiertes materielles Recht und ein formales Prozeßrecht. An beiden wurde unter Hubers Mitwirkung Schritt für Schritt gearbeitet. Das Reglement für den Gerichtshof war weitgehend sein Werk; und die wesentlichen Urteile in den Jahren 1922–30 (1925–27 war er sein Präsident) waren mit ihrer sentenziösen Klarheit und ihrem politischen Weitblick und Gerechtigkeitssinn von ihm formuliert; sie bildeten die Ansätze für eine Kodifikation des Völkerrechtes. Hubers Vorstoßen zu den letzten Prinzipien, auch im scheinbar unbedeutenden Streitfall, sein Versuch, das Einzelne aus dem Wust materieller Erörterungen und formalistischer Rabulistik herauszuheben und in den Gesamtzusammenhang zu stellen, sein Sinn für die Bedeutung des Präjudizes, sein Blick für die politische Tragweite der Entscheidungen – das alles gab der Arbeit des Gerichtshofes weitgehend das Gepräge und machte ihn zu einer Stätte konstruktiver Arbeit am Völkerrecht. Daß er das Präsidium und 1930 überhaupt das Richteramt mit einem Gefühl der Enttäuschung niederlegte, lag in der bewußten Ignorierung und weitgehenden Ausschaltung des Gerichtshofes durch die virulent wieder auflebende Großmachtpolitik begründet.
Die Krönung von Hubers Bemühungen um Menschlichkeit und Völkerversöhnung war sein Wirken als Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz in den Jahren 1928 bis zum Kriegsende. Seine Leistung ist nur schwer faßbar. Sie liegt vor allem auf 3 Gebieten. Bei der spirituellen Leitung bewahrt er die Kunst, in allem Wesentlichen fest zu bleiben und alles Zufällige und Zweitrangige zurückzustellen und so auch in einer von Haß und Jammer zerrissenen Welt nach Möglichkeit das Menschliche zu retten. In der Lösung der juristisch-politischen Probleme steuert er dem völkerrechtlichen Chaos durch seine Denkschriften an die kriegführenden Mächte wie an die Rotkreuzmitarbeiter und die nationalen Rotkreuzgesellschaften. Es sind Dokumente von höchster politischer, diplomatischer und moralischer Bedeutung, noch heute maßgebend, in allen Zweifelsfällen über die Richtlinien der Rotkreuzpolitik befragt. Vieles davon ist später in die Genfer Konvention von 1949 eingegangen, vor allem die Grundsätze für den Schutz der Zivilbevölkerung in Kriegen. Endlich hat Huber mitten in der Flut von Barbarei des 2. Weltkrieges als oberster Leiter des Hilfswerkes Zeit und Kraft gefunden, die geistige Begründung und Entfaltung des Rotkreuzgedankens, die eigentliche ›Rotkreuz-Ethik‹ darzulegen, besonders in der Schrift ›Der barmherzige Samariter‹ (1940).«
Vogelsanger, Peter, in: Neue Deutsche Biographie 9 (1972), S. 681–684