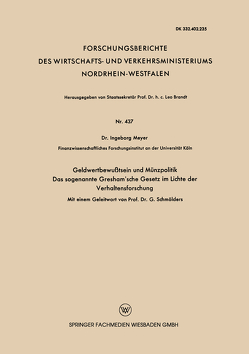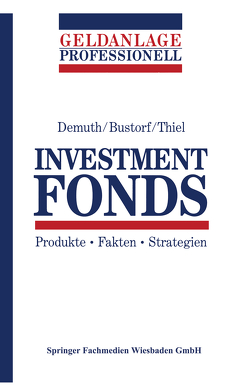Geld- und Geldwerttheorien im Privatrecht der Industrialisierung (1815–1914).
Ökonomische Wechsellagen in der sogenannten Begriffsjurisprudenz.
Kai-Peter Ott
Über Geld spricht man nicht im BGB. Geld hat man bekanntlich zu haben. Kannten die BGB-Redaktoren keine Inflation und keine Währungsturbulenzen? Oder waren sie von ökonomischer Blindheit geschlagen? Oder widersprach die Regelung des Geldverkehrs ihren Wirtschaftsvorstellungen? Diese Fragen, die am Vorabend der Europäischen Währungsunion auch an die gegenwärtige Rechtswissenschaft gestellt werden könnten, betreffen nicht allein das BGB, sondern die gesamte Jurisprudenz des 19. Jahrhunderts, deren Ergebnis das BGB ist. Innerhalb der Rechtswissenschaft richten sie sich vor allem an die nur allzu oft als »Begriffsjuristen« abgetanen Lehrer des römischen Rechts, da es die Germanisten von Anfang an verstanden hatten, sich gleichzeitig als national, wirtschaftsorientiert und sozial zu charakterisieren. Im weiteren geht es um die Interdependenz von Recht, Wirtschaft und Politik. Die Antworten auf diese Fragen sollen nun nicht in dem unverbindlich heiteren Ambiente der großen Prinzipien, sondern durch gründliche Grabungen in den Lehrbüchern und Gesetzesdebatten der damaligen Zeit gesucht werden. Aus juristischer Perspektive wird die Effizienzsteigerung der Geldwirtschaft im Verlauf des 19. Jahrhunderts durchleuchtet. Im Mittelpunkt steht neben der Durchsetzung von Papiergeld, Banknoten und Buchgeld im Zahlungsverkehr vor allem die..weiterlesen