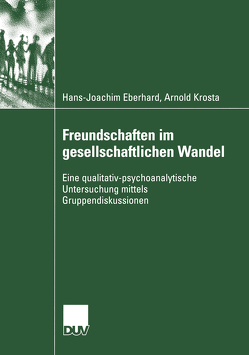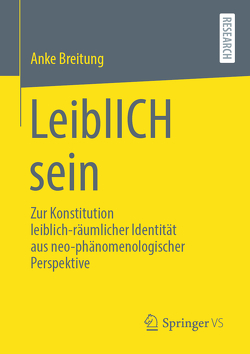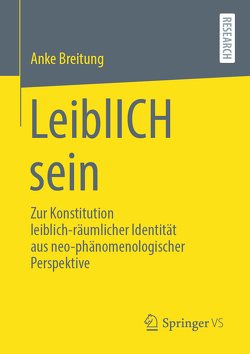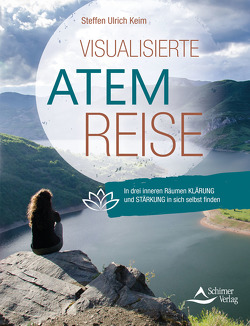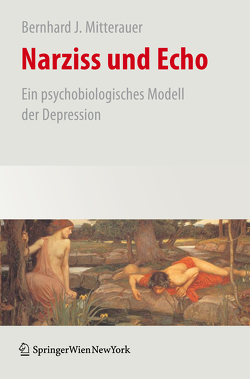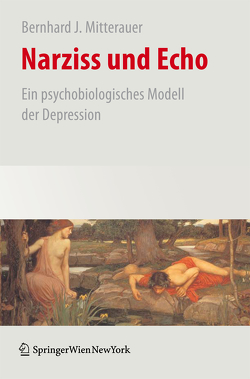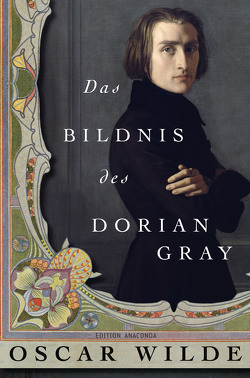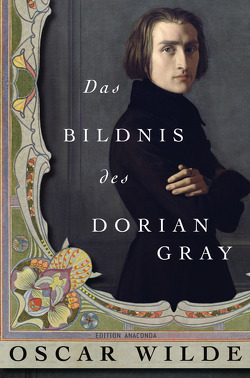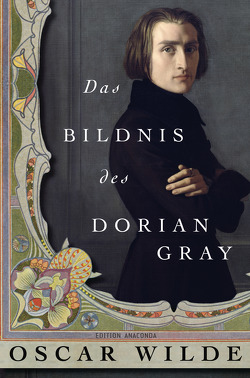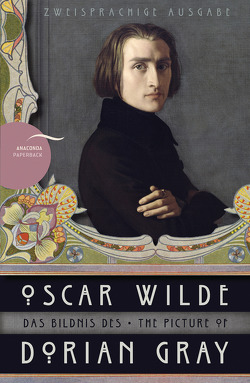Sein-Selbst-Ich bei Michel de Montaigne
Marlene Meding
Wer sich mit Montaigne beschäftigt, wird einem facettenreichen Menschen am Beginn der ›Moderne‹ begegnen. Seine Essais sind – obwohl im 16. Jahrhundert geschrieben – nach wie vor aktuell und anregend, eine praktische Philosophie für das tägliche Leben. Das ›Gewand‹, das er seinen Essais gegeben hat, kann als eine Art Verkleidung, als ›Larve‹, gesehen werden, die in seiner Zeit wohl unabdingbare existentielle Voraussetzung ist.
Das Selbst ist für Montaigne das alles bestimmende mit dem es sich zu beschäftigen lohnt, und als Erster setzt er das Ich als Zentrum seines Interesses. Das Ich, das sich verändert, dass den anderen benötigt, um zu sein, der wiederum auch ein Ich ist.
Obwohl jahrhundertealte Verbote diesem Ich entgegenstehen, stellt er sich gegen alle Konventionen seiner Zeit und praktiziert das, was ihm für sich angemessen scheint.
Wissen ist für ihn nachrangig, ihn beschäftigt der Mensch in seinem Sosein, und um mehr über den Menschen ›an sich‹ zu erfahren, beschäftigt er sich mit dem, der ihm Tag und Nacht zur Verfügung steht: mit sich selbst. Im Schreiben seiner Essais findet Montaigne einen spiegelbildlichen Gesprächspartner, jemanden, der ihn gut kennt, der sein Bild in sich trägt und es weitergibt: er ist sich immer wieder ein Gegenüber. Aus seinem Selbstverhältnis geht sein Selbstverständnis hervor, aus seinem Bild von sich selbst sein objektives Menschenbild.
Für ihn gilt, dass dem Menschen sein eigenes Wesen überantwortet und an ihn die Aufgabe gestellt ist, damit zurecht zu kommen und etwas damit zu tun, ‚der Mensch werde und wisse, was er ist, dann hat er schon das Rechte‘ (Michel de Montaigne).