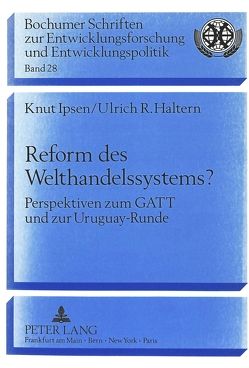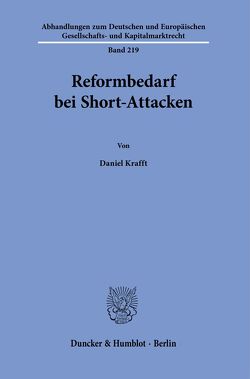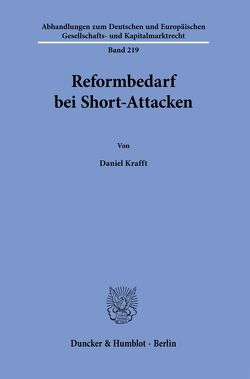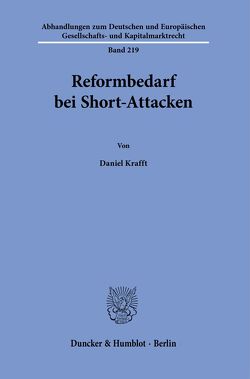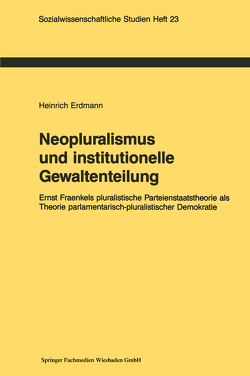Verfassungsgerichtsbarkeit, Demokratie und Mißtrauen.
Das Bundesverfassungsgericht in einer Verfassungstheorie zwischen Populismus und Progressivismus.
Ulrich R. Haltern
Das Problem der verfassungsgerichtlichen Läuterung der demokratisch unmittelbar legitimierten Ergebnisse des politischen Prozesses ist durch dogmatische oder rein funktionelle Betrachtungen nicht zu lösen. Daher stellt der Autor den Zusammenhang mit dem Bürgerbild im modernen Verfassungsstaat her.
Zu diesem Zweck wird zunächst abseits gängiger Analysemuster eine verfassungstheoretische Matrix zwischen den Polen Populismus und Progressivismus vorgestellt. Der deutsche Verfassungsdiskurs, der Recht überwiegend als objektiv und vorfindbar begreift, weist bereits die progressivistische Richtung. Eine Mischung liberalen und pluralistischen Gedankenguts mit utilitaristischen Untertönen läßt den Staat darüber hinaus als integrativ und tugendhaft gegenüber den zentrifugalen gesellschaftlichen Kräften erscheinen, wodurch dem Verfassungsgericht eine prominente Rolle in der protektiven, juridischen Demokratie des progressivistischen Gemeinwesens angetragen wird. Dies reflektiert sich in den herrschenden Theorien von Verfassungsgerichtsbarkeit.
Demgegenüber deutet ein zunächst abstrakt erarbeitetes, dann anhand des Grundgesetzes bestätigtes Modell bürgerlicher (politischer) Identität auf die Notwendigkeit gesellschaftlichen erfahrungsgestützten Lernens hin, das nach institutionellen Ermöglichungsbedingungen und einem Ausgleich von Progressivismus und Populismus verlangt. Der Verfassungsgerichtsbarkeit kommt in diesem Rahmen die Aufgabe zu, unakzeptable Präferenzen abzuweisen, worin gerade ihre politikermöglichende Funktion liegt.