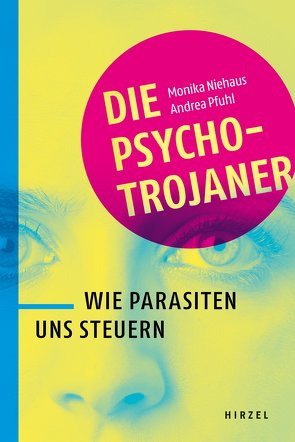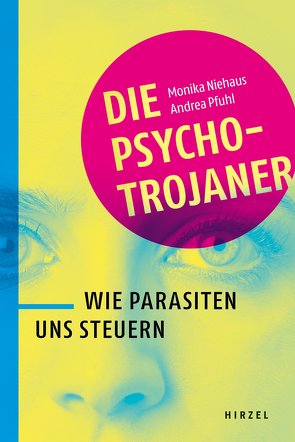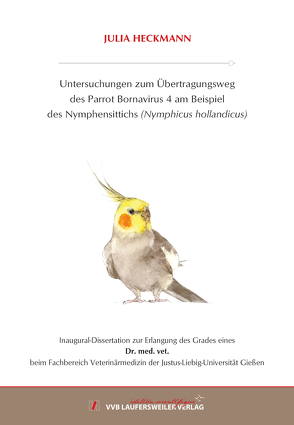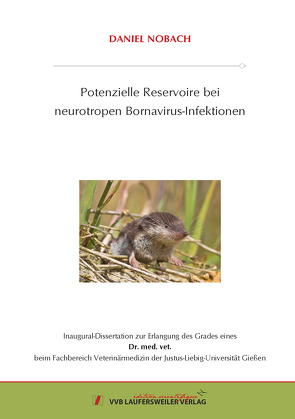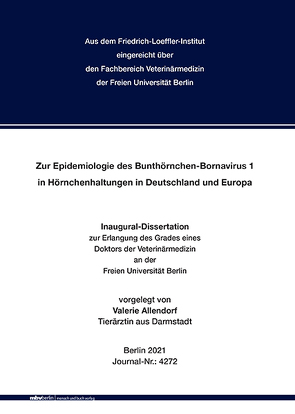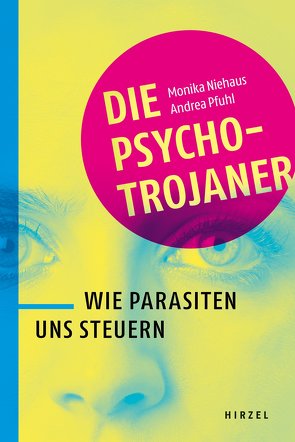Aktualisiert: 2023-06-15
> findR *
Aktualisiert: 2023-06-07
> findR *
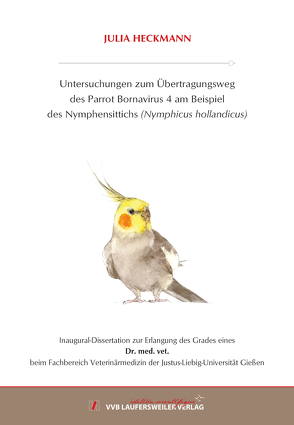
Aviäre Bornaviren können neben Psittaziden auch andere Vögel wie Kanarien und Wassergeflügel infizieren. Bei Papageien kann es durch das Parrot Bornavirus (PaBV) neben gastrointestinalen Erkrankungen, wie der Psittazinen Drüsenmagendilatation (PDD), auch zu neurologischen Symptomen kommen. PaBV stellt ein weltweites Problem dar, besonders in größeren Zuchtbetrieben oder bei der Erhaltung von bedrohten Arten. Die fäkooronasale Übertragung wurde bislang als natürliche Infektionsroute aviärer Bornaviren vermutet, konnte jedoch bisher nicht belegt werden.
Mit dieser Arbeit sollten die orale und nasale Infektionsroute, sowie die Übertragung über Schleimhaut- und Hautwunden als mögliche Infektionswege des Parrot Bornavirus am Beispiel des Nymphensittichs (Nymphicus hollandicus) als Modelltier untersucht werden.
Dazu wurden spezifisch pathogenfreie (SPF), subadulte Nymphensittiche oral (n = 9), nasal (n = 9), über eine Läsion am Gaumendach (n = 9), bzw. eine Läsion am linken Fußballen (n = 3) mit einem PaBV-4-Isolat mit einem Titer von 103 TCID50, (bzw. 104 TCID50 bei der Fußballen-Gruppe) inokuliert. Eine Mock-Gruppe (n = 2) wurde mit virusfreier Zell-
suspension ebenfalls über eine Gaumenläsion inokuliert und fungierte als Kontrollgruppe. Der Gesundheitszustand aller Tiere wurde über einen Zeitraum von 173/174 Tagen (orale und nasale Gruppe), bzw. 184 Tagen (Gaumendach-Gruppe) und 209 Tagen (Fußballen-Gruppe) beobachtet. Wöchentliche Kropf- und Kloakentupfer sowie Blutproben wurden
untersucht, um eine mögliche PaBV-RNA-Ausscheidung mittels Realtime-RT-PCR und das Auftreten von spezifischen Antikörpern gegen PaBV mittels indirektem Immunfluoreszenztest (iIFT) zu detektieren.
Beim Auftreten von mittelgradigen Krankheitssymptomen bzw. am Versuchsende wurden alle Nymphensittiche euthanasiert und ihre Organe mittels Realtime-RT-PCR auf PaBV-RNA, sowie mittels Histologie auf lymphoplasmazelluläre Infiltrate als Hinweis auf eine PDD und mittels Immunhistochemie auf virales Antigen (p24) untersucht. Eine Virusreisolierung erfolgte aus Gehirn- und Kropfmaterial eines jeden Tieres. Sekundärkrankheiten wie bakterielle Infektionen oder Mykosen des Magen-Darm-Traktes wurden ausgeschlossen.
Innerhalb der oralen und nasalen Gruppen kam es bei 8/18 Tieren zu unspezifischen Symptomen und insgesamt vier Verlusten vor Ende der Versuchszeit, was eventuell auf ein Problem mit dem Filtersystem der Isolatoren und Begleitinfektionen zurückzuführen war.
Bei fünf Tieren der oralen und bei drei der nasalen Gruppe wurde zu Beginn des Versuchs bis zum Tag 34 pi PaBV-RNA in den Tupferproben nachgewiesen. Allerdings wurde in keiner Tupferprobe eines späteren Zeitpunktes innerhalb der oralen und nasalen Gruppe, sowie in keiner Tupferprobe der Gaumendach- und Mock-Gruppe PaBV-RNA nachgewiesen. Ebenso wurde keine PaBV-RNA und kein Virusantigen in den Organen dieser Versuchsgruppen detektiert, weshalb eine produktive Infektion ausgeschlossen werden konnte.
Lediglich bei der Fußballen-Gruppe konnten niedrige PaBV-RNA-Gehalte in den Nn. ischiadici, Darm und Haut, sowie in der Histologie PDD-typische Infiltrate in der Haut von zwei Tieren nachgewiesen werden. Mittels Immunhistochemie wurde in dieser Gruppe das virale Antigen p24 bei allen drei Tieren im Rückenmark bzw. in Spinalganglien sowie in den Nn. ischiadici und in der Haut nachgewiesen. Die schwach positiven Realtime-RT-PCR-Ergebnisse wurden mittels Sequenzierung als PaBV-4 bestätigt, was die erfolgreiche Infektion über diese Route belegt. Bei keinem Versuchstier kam es zu einer Serokonversion oder zu einer PaBV-RNA-Ausscheidung. Auch war bei keinem Tier eine Virusreisolierung erfolgreich. Die Ergebnisse der Fußballen-Gruppe sprechen für eine erfolgreiche Infektion und Verteilung des Parrot Bornavirus im Wirtsorganismus über retrograden, axonalen Transport.
Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass eine nasale oder orale Aufnahme von 103 TCID50 des PaBV Stammes Ps34 im Versuch nicht als relevante Übertragungsroute fungiert, was sich mit Beobachtungen betroffener Bestände und anderen Infektionsversuchen deckt. Anhand der Ergebnisse der Fußballen-Gruppe wurde belegt, dass Hautläsionen mit Zugang zu Nervenfasern als Eintrittspforte für PaBV dienen können. Es zeigen sich Über-einstimmungen im Übertragungsverhalten zum Mammalian 1 bornavirus und dem Toll-wutvirus, welche beide zu derselben Ordnung der Mononegavirales zählen.
Die Übertragung von PaBV scheint an invasive Routen gebunden zu sein. Diese Daten könnten genutzt werden, um sinnvolle Sanierungs- und Prophylaxe-Maßnahmen von be-troffenen Zuchtbeständen bedrohter Papageienarten zu etablieren.
Aktualisiert: 2022-12-23
> findR *
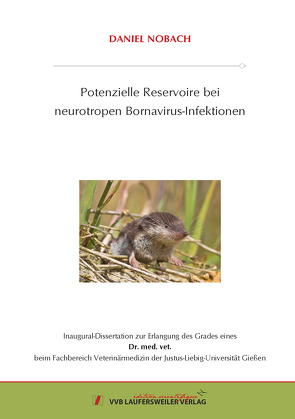
Viele Virusinfektionen und „emerging infectious diseases“ (EID) besitzen ein Reservoir in wildlebenden Tierpopulationen, von der Übertragungen der Infektionserreger auf Haustiere und Menschen stattfinden. Dies stellt eine beträchtliche Gefahr für die öffentliche Gesundheit dar und Tiermodelle, die die Reservoirsituation widerspiegeln, können durch die Erforschung grundlegender Mechanismen Hinweise für zukünftige Bekämpfungstrategien liefern.
Borna disease virus (BoDV-1) ist seit langer Zeit als Erreger der Bornaschen Krankheit (BD) bekannt, einer neurologischen, tödlichen Erkrankung bei Säugetieren, insbesondere bei Pferden und Schafen. Kürzlich wurde auch der zoonotische Charakter von BoDV-1 gezeigt und bisher wurden mehr als 30 humane Todesfälle auf BoDV-1 zurückgeführt.
Die Feldspitzmaus (Crocidura leucodon) wird als Reservoir von BoDV-1 in verschiedenen endemischen Regionen vermutet, da mehrfach Wildfänge mit natürlichen BoDV-1-Infektionen gefunden wurden und das Verteilungsmuster mit Virustranskription und Replikation in Ausscheideorganen auf eine Virusausscheidung hindeutet.
Ziel des ersten Teils der vorliegenden Arbeit war, durch Untersuchungen an lebenden infizierten Feldspitzmäusen die BoDV-1-Infektion im Reservoirtier näher zu charakterisieren. Insbesondere eine Aussage über die Ausscheidung von BoDV-1 durch infizierte Feldspitzmäuse sollte getroffen werden. Zur Erreichung dieses Ziels sollte eine Feldspitzmaushaltung und -zucht etabliert werden, um die Infektion unter kontrollierten Bedingungen zu untersuchen. In einem zweiten Teil der Arbeit wurde untersucht, ob Fledermäuse, die aufgrund ihrer biologischen Eigenschaften häufig als Reservoir für Viren fungieren und bei denen endogene Bornavirus-ähnliche Elemente im Genom verschiedener Arten gefunden wurden, natürliche BoDV-1-Infektionen aufweisen und damit als weiteres Reservoir von BoDV-1 in Frage kommen.
Für den ersten Teil der Arbeit wurden innerhalb von zwei Jahren 16 Feldspitzmäuse an zwei Standorten aus der Natur entnommen und 13 Feldspitzmäuse lebend in die Haltung genommen. Die Bedingungen und Anpassungen der Haltung an die spezifischen Bedürfnisse von Feldspitzmäusen wurden beschrieben und mit den Ansätzen früherer Spitzmaushaltungen verglichen. Innerhalb von 6 Jahren wurden 19 Nachkommen in 3 Generationen gezüchtet. Der Mittelwert der Lebensdauer in der Haltung bei den Wildfängen betrug 810 Tage (91 Tage bis 1353 Tage), der Mittelwert der Lebensdauer der in der Haltung geborenen Spitzmäuse betrug 963 Tage (401 Tage bis 1278 Tage). Die meisten ermittelten Todesursachen beinhalteten Neoplasien, die mit dem hohen Lebensalter in Zusammenhang stehen können. Die erfolgreiche Etablierung der Haltung ermöglichte die weiteren Untersuchungen dieser Arbeit an den Spitzmäusen.
Von den 16 gefangenen Feldspitzmäusen waren 8 zum Zeitpunkt des Fanges mit BoDV-1 infiziert und ermöglichten die Charakterisierung der natürlichen persistenten BoDV-1-Infektion an lebenden Feldspitzmäusen. BoDV-1-infizierte und nicht-infizierte Tiere unterschieden sich weder im Verhalten noch in der Aktivität oder in der Futteraufnahme. Der statistische Vergleich der Körpermasseentwicklung zwischen infizierten und nicht-infizierten Tieren führte zu keinen signifikanten Unterschieden. BoDV-1-infizierte Feldspitzmäuse schieden infektiöse Viren über Speichel, Haut und Urin aus, wie mittels Virusanzucht gezeigt wurde. BoDV-1-RNA wurde mittels RT-PCR in Speichel, Tränenflüssigkeit, Hauttupfer mit Hautsekreten und Hautschuppen, Urin und Kot festgestellt, interessanterweise zusätzlich auch in der Einstreu. Bei der Untersuchung über 4 aufeinanderfolgende Wochen war bei 2 Tieren in einzelnen Urinproben keine BoDV-1-RNA nachzuweisen, dies kann auf eine intermittierende Ausscheidung hinweisen. Die Untersuchung nach mehr als 250 Tagen in der Haltung zeigte, dass auch zu diesem späten Zeitpunkt der Infektion die Ausscheidung über Speichel, Tränenflüssigkeit, Hautsekreten oder Hautschuppen und Urin stattfand. Die postmortale Untersuchung der infizierten Tiere zeigte keine entzündlichen oder degenerativen Veränderungen im Zusammenhang mit der Infektion, mittels Immunhistochemie und in-situ-Hybridisierung konnte Replikation und Transkription des Virus im Nervensystem und in vielen peripheren Organen gezeigt werden und als Ausscheideorgane die Speicheldrüse, die Tränendrüse, die Niere und Harnblase und die Haut mit Talgdrüsen und Epidermis identifiziert werden. Zusätzlich konnte gezeigt werden, dass auch in der Umgebung der infizierten Spitzmaus BoDV-1-RNA mit der RT-PCR nachgewiesen werden konnte. Dies und die Ausscheidung über verschiedene Routen kann die Übertragung von Feldspitzmaus zu Feldspitzmaus ermöglichen und damit den Erhalt des Virus in der Reservoirpopulation, gleichzeitig aber auch die Übertragung auf Fehlwirte.
Für den zweiten Teil der Arbeit wurden 6 Betriebe mit vorherigen Fällen von equiner BD exemplarisch auf das Vorkommen von Fledermäusen mittels Begehung und Aufzeichnungen von Ultraschalldetektoren untersucht. Dabei wurden Quartiere und Jagdgebiete von einem Spektrum von Fledermäusen identifiziert, die eine weite Verbreitung in der Gegend besitzen. Die Untersuchung von Gehirnen von Fledermäusen verschiedener Arten aus ganz Deutschland mittels RT-PCR zeigte in 257 Tieren keinen Hinweis auf orthobornavirale RNA. Dabei wurde eine RT-PCR verwendet, die neben BoDV-1 auch andere zu dem Zeitpunkt bekannte Orthobornaviren nachweisen sollte (7 detektierbare Spezies: Mammalian 1 orthobornavirus, Mammalian 2 orthobornavirus, Passeriform 1 orthobornavirus, Passeriform 2 orthobornavirus, Psittaciform 1 orthobornavirus, Psittaciform 2 orthobornavirus, Waterbird 1 orthobornavirus). In der immunhistologischen Untersuchung zum Nachweis von BoDV-1-Phosphoprotein gab es bei 3 von 140 Tieren eine Reaktion in der glatten Muskulatur des Darmes. Eine Reaktion mit bisher unbekannten Bornaviren oder auf translatierte endogene Bornavirus-ähnliche Elemente konnte nicht ausgeschlossen werden.
Zusammengefasst hat diese Arbeit neue Erkenntnisse zur Reservoirsituation von BoDV-1 hervorgebracht. Trotz des Vorkommens von endogenen Bornavirus-ähnlichen Elementen im Genom verschiedener Fledermausarten gibt es keinen Hinweis darauf, dass sich Fledermäuse natürlich mit BoDV-1 infizieren oder eine Rolle als Reservoir für BoDV-1 spielen. Hingegen hat diese Arbeit gezeigt, dass infizierte Feldspitzmäuse persistent infiziert sind und dauerhaft BoDV-1-RNA und infektiöses Virus über verschiedene Routen ausscheiden, und hat damit den Reservoircharakter von Feldspitzmäusen als natürliches Reservoir für BoDV-1 bewiesen.
Aktualisiert: 2022-12-23
> findR *

Charakteristik der intranasalen Infektion mit neurotropen Bornaviren unter Berücksichtigung antiviraler Interventionsstrategien
Sabrina Munsch
1. Ein Ziel dieser Arbeit war die Untersuchung der Wirkung eines Furininhibitors (MI 0701) auf die intranasale Infektion mit dem Borna disease virus 1 der Ratte, einem seit langem etablierten Tiermodell zur Untersuchung neurotroper Virusinfektionen. Daten zur Inhibition der Spaltung des viralen Glykoproteins durch den Furininhibitor und die Auswirkung auf die Infektion des olfaktorischen Systems lagen bislang nicht vor. Der peptidomimetische Inhibitor MI-0701 gehört zu den wirksamsten, reversibel bindenden, niedermolekularen Furininhibitoren, dessen Wirksamkeit an diversen Beispielen viraler sowie bakterieller Infektionen gezeigt werden konnte. In-vivo-Untersuchungen mit dem Inhibitor an BoDV-1-infizierten Tieren wurden ebenfalls bislang nicht durchgeführt. Die eigenen Untersuchungen sollten zum Verständnis der initialen Phasen intranasaler Infektionen mit neurotropen Viren und möglicher antiviraler Therapieansätze bislang unzulänglich behandelbarer neurotroper Virusinfektionen beitragen. Ein weiteres Ziel war die Charakterisierung der initialen Vermehrung des BoDV 1 im olfaktorischen System sowie der entsprechenden infizierten Zellen. Dabei sollte besonderes Augenmerk auf den die olfaktorischen Nervenfasern umhüllenden olfactory ensheathing cells (OEC) liegen, vorherige Untersuchungen ließen eine zentrale Bedeutung bei der Pathogenese der Bornaschen Krankheit vermuten. Die speziellen Mechanismen der intranasalen Virusverbreitung sind bislang nur unzulänglich verstanden. Virale Infektionen können weiterhin z. B. durch Regulation des Zelltods die Homöostase des olfaktorischen Epithels beeinflussen. Im Rahmen dieser Arbeit sollte daher auch untersucht werden, ob auch die intranasale BoDV-1-Infektion einen Einfluss auf den Zelltod des olfaktorischen Epithels hat.
2. Um den Einfluss des Furininhibitors auf die Infektionsrate in-vitro zu untersuchen, wurde eine Dissoziationskultur des olfaktorischen Epithels (OE) der Ratte mit BoDV-1 infiziert und mit dem Inhibitor behandelt. Nach 4, 7 und 10 dpi lag der Anteil infizierter Zellen bei den unbehandelten Kontrollkulturen stets höher als bei denen nach Inhibitorzugabe (p<0,0001). Es konnte eine dosisabhängige Reduktion der Infektionsrate mit einer maximalen Reduktion um knapp 80 % nach Behandlung mit 10 µM des Furininhibitors nach 10 dpi festgestellt werden. Zudem sollte untersucht werden, ob die Inhibitorzugabe nach BoDV-1-Infektion einen Einfluss auf den Neuronenanteil in der Kultur hatte. Es konnte gezeigt werden, dass der Neuronenanteil abhängig von der Behandlung war (p=0,0001). Während die BoDV-1-infizierten Kulturen stets den niedrigsten neuronalen Anteil aufwiesen (10 dpi: 4,4 %), zeigten die zusätzlich mit 10 µM MI-0701 behandelten Kulturen den höchsten Neuronenanteil auf (10 dpi: 9,9 %). Dies kann für einen potentiell protektiven Effekt des Inhibitors MI-0701 bei viraler Infektion auf die olfaktorischen Neurone sprechen. Bei molekularbiologischen Untersuchungen zum Nachweis viraler messenger RNA (mRNA) und genomischer RNA (gRNA) des infizierten OEs mittels quantitativer real time RT-PCR zeigte sich initial nach 4 dpi eine äquivalente virale Replikation und Transkription, während nach 7 dpi das Verhältnis zugunsten der Transkription verschoben war und somit die virale Proteinneubildung begünstigt wurde.
Olfaktorische Hüllzellen (OEC) zeigten in vorherigen Untersuchungen eine zentrale Bedeutung bei der intranasalen Infektion mit BoDV-1. Permanente OECs der Ratte wurden hier erstmalig erfolgreich mit BoDV-1 infiziert und es wurde eine stetige Virusausbreitung über die Zeit bis hin zu einer Infektionsrate von 16,8 % nach 6 dpi festgestellt (p=<0,0001). Nach Inhibitoranwendung konnte eine dosisabhängige Reduktion der Infektionsrate (p=0,0027) mit einer maximalen Reduktion um mehr als 85 % nach Behandlung mit 10 µM des Inhibitors nach 6 dpi festgestellt werden. Bei molekularbiologischen Untersuchungen der infizierten OECs mittels quantitativer RT-PCR zum Nachweis viraler mRNA und gRNA zeigte sich initial nach 4 dpi eine verhältnismäßig höhere virale Replikationsrate im Vergleich zur Transkription, während sich die Werte nach 7 dpi denen für die Transkription anglichen. Dies unterstreicht die Rolle der olfaktorischen Hüllzellen während der BoDV-1-Infektion und die Hypothese, dass sie in der initialen Infektionsphase die virale Replikation fördern.
Insgesamt weisen die Ergebnisse der in-vitro-Untersuchungen auf eine signifikante Inhibition der Infektionsausbreitung im olfaktorischen System durch den Einsatz von MI-0701 hin. Insbesondere die olfaktorischen Hüllzellen scheinen für die Infektion besonders empfänglich zu sein und können so auch ein vielversprechendes Ziel bei der Reduktion der Infektionsrate sein.
3. Zum Studium des Inhibitoreinflusses in-vivo wurden Lewis-Ratten intranasal mit BoDV-1 infiziert und anschließend 0,5 mg MI-0701/kg Körpergewicht appliziert. Zu keinem Untersuchungszeitpunkt konnten Anzeichen einer Erkrankung bei den Tieren festgestellt werden. Nach 21 dpi zeigten die Tiere sowie auch diejenigen der Kontrollgruppe eine geringgradige nicht-eitrige Meningoenzephalitis. Abhängig von der anatomischen Lokalisation war mittels immunhistologischer Untersuchung eine Reduktion des Nachweises von BoDV-1-N um bis zu 68 % der infizierten Zellen im olfaktorischen Epithel festzustellen. Auf zellulärer Ebene konnte die deutlichste Reduktion der Infektion bei den olfaktorischen Hüllzellen (65 %) und den olfaktorischen Nervenfasern (67 %) detektiert werden, was wiederum die in-vitro Daten bestätigt. Nervalen Strukturen kommt also wie erwartet nicht nur bei der initialen Infektion und der Virusausbreitung, sondern auch bei deren Hemmung eine besondere Bedeutung zu. Mittels quantitativer real time RT-PCR zum Nachweis viraler mRNA und gRNA zeigte sich nach 21 dpi eine Reduktion der Replikation in der Nase um bis zu 45 %, die Transkription zeigte jedoch keine Reduktion. Abhängig von der zerebralen Struktur war mittels immunhistologischer Untersuchung zum Nachweis von BoDV-1-N auch im Gehirn eine Reduktion des Infektionsscores um bis zu 58 % festzustellen. Mittels quantitativer real time RT-PCR zum Nachweis viraler mRNA und gRNA zeigte sich nach 21 dpi eine Reduktion der viralen Replikation in untersuchten Gehirnregionen um bis zu 63 %, die virale Transkription zeigte im Gehirn fast keine Reduktion. Mittels quantitativer real time RT-PCR zeigte sich im Gehirn bei den infizierten Tieren ein zeitabhängiger Anstieg für die virale Replikation sowie für die Transkription, wobei stets ein Verhältnis zugunsten der Transkription nachweisbar war. Absolut waren in rostral gelegenen Arealen die höchsten Werte zu bestimmen, was dem bekannten Verlauf der BoDV-1-Infektion entspricht.
Insgesamt sprechen die Ergebnisse der in-vivo-Untersuchungen dafür, dass der intranasale Einsatz von MI-0701 zu einer Reduktion der Infektion in der Nase sowie im Gehirn führte. Inwieweit die Wirkung des Furininhibitors auf die virale Replikation eine Folge der reduzierten Virusweitergabe an nicht-infizierte Zellen aufgrund des Fehlen eines biologisch aktiven, viralen Glykoproteins ist oder der Inhibitor MI-701 auch direkt in die Phasen der viralen Replikation eingreifen kann, muss in weiteren Studien geklärt werden.
4. Um den Einfluss der BoDV-1-Infektion auf den Zelltod im olfaktorischen Epithel zu erforschen, wurde Gewebe intranasal infizierter Ratten immunhistologisch qualitativ und quantitativ auf das Vorkommen von Caspase3 (stellvertretend für lokale Apoptose) und AIF (stellvertretend für lokalen Parthanatos) untersucht. Dabei wurde zu keinem Untersuchungszeitpunkt ein signifikanter Unterschied für die Caspase-positiven Zellen im Vergleich zur Kontrollgruppe gefunden, AIF war überhaupt nicht detektierbar.
Insgesamt sprechen die Ergebnisse dafür, dass bei viraler Infektion eine Modifikation der Homöostase des olfaktorischen Epithels mittels Apoptose nicht stattfindet, Parthanatos scheint auch unabhängig von einer Infektion keine Rolle beim Zelltod dieses Epithels zu spielen.
5. In der vorliegenden Arbeit wurde zusammenfassend gezeigt, dass die Proproteinkonvertase Furin eine entscheidende Rolle bei der Virusinfektion spielt und die Anwendung des Furininhibitors MI 0701 sowohl in-vitro als auch in-vivo zu einer signifikanten Reduktion der zellulären Infektionsrate im Vergleich zu den Kontrollgruppen geführt hat. Ein zusätzlicher, noch weiter zu klassifizierender, neuroprotektiver Charakter oder mögliche direkte Interaktionen mit der viralen Replikation erscheinen nicht ausgeschlossen. Eine besondere Rolle in Bezug auf Effizienz kommt bei der Inhibition der viralen Infektion den olfaktorischen Hüllzellen zu. Der Inhibitor stellt einen vielversprechenden Ansatz zur Reduktion der Viruslast als Therapeutikum oder zur Metaphylaxe bei Infektionen mit Bornaviren dar. Somit liefert diese Studie wichtige Erkenntnisse zur Übertragung neurotroper Virusinfektionen mit zoonotischem Potential.
Aktualisiert: 2022-12-23
> findR *
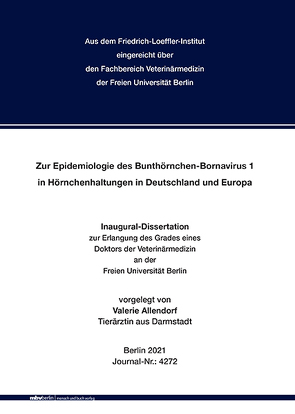
Mit der vorliegenden Arbeit wurde der Überblick bezüglich der Struktur und des Netzwerks der Hörnchenhaltung und -zucht in Deutschland, einer von vielen Nischen bei Tier-Mensch-Schnittstellen, erweitert. Dazu wurden Register für in Zoos und Privathaushalten gehaltene Hörnchen erstellt. Die hierbei auftretenden Schwierigkeiten bezüglich der Erreichbarkeit der betreffenden Personengruppen machten deutlich, dass eine zügige Untersuchung und die Eindämmung eines Infektionsgeschehens erheblich erschwert war. Der Mangel an Daten nicht nur zu Hörnchenhaltungen, sondern auch bezüglich des Besitzes der meisten exotischen Haustiere, ist sowohl im deutschen System als auch dem anderer Länder der Welt inhärent. Die Interaktion mit der Community von Halter*innen und Verkäufer*innen exotischer Haustiere offenbarten das Ausmaß von gehandelten und gehaltenen Arten.
Der beschriebene Ansatz kann als Vorlage für die epidemiologische Aufarbeitung neu auftretender Krankheiten bei exotischen Tieren dienen.
In auf den Registern aufbauenden Querschnittsstudien wurde für die Hörnchenpopulation in Privathaushalten und die Hörnchenpopulation in Zoos die Prävalenz von Subpopulationen geschätzt, in denen mindestens ein Individuum VSBV-1-infiziert war. Hierzu wurden Maultupfer oder Kotproben von 58 private bzw. 53 zoologische Subpopulationen mittels RT-qPCR auf das Vorhandensein von VSBV-1-spezifischer RNA untersucht. Dabei ergab sich eine VSBV-1-Prävalenz von 0 % (95 % CI 0 – 6,2 %) in privaten Subpopulationen und von 1,9 % (95 % CI 0 – 9,9 %) in Zoo-Subpopulationen. Für die Studienteilnahme wurde über eine Vielzahl von Hörnchen-spezifischen Medien geworben, wodurch innerhalb der Risikopopulation der Hörnchenhalter*innen und –pfleger*innen das Bewusstsein für die potentielle Infektionsgefahr durch ungetestete Hörnchen erhöht werden konnte.
Durch Intensivierung der Nachverfolgungsermittlungen in von VSBV-1 betroffenen Hörnchenhaltungen, -subpopulationen und Individuen konnte ein Handelsnetzwerk rekonstruiert werden. Gestützt durch phylogenetische Analysen des Genoms von VSBV-1-Isolaten konnte gezeigt werden, dass das VSBV-1-Geschehen in Deutschland vermutlich auf einen einmaligen Eintrag von VSBV-1 mit einem Prevost-Hörnchen zurückgeht, das Ende der 1990er aus seinem Herkunftsland Indonesien importiert wurde. Von der Haltung des Importeurs wurde das Virus über gehandelte Tiere in Zoos und weitere private Haltungen verbreitet. In einer dieser Haltungen wurde VSBV-1 auf Bunthörnchen übertragen. Somit können sich die zukünftigen Untersuchungen zum Erregerursprung und Wildtierreservoir auf den südostasiatischen Raum konzentrieren.
Aktualisiert: 2021-10-20
> findR *
Aktualisiert: 2023-04-16
> findR *
MEHR ANZEIGEN
Bücher zum Thema Bornavirus
Sie suchen ein Buch über Bornavirus? Bei Buch findr finden Sie eine große Auswahl Bücher zum
Thema Bornavirus. Entdecken Sie neue Bücher oder Klassiker für Sie selbst oder zum Verschenken. Buch findr
hat zahlreiche Bücher zum Thema Bornavirus im Sortiment. Nehmen Sie sich Zeit zum Stöbern und finden Sie das
passende Buch für Ihr Lesevergnügen. Stöbern Sie durch unser Angebot und finden Sie aus unserer großen Auswahl das
Buch, das Ihnen zusagt. Bei Buch findr finden Sie Romane, Ratgeber, wissenschaftliche und populärwissenschaftliche
Bücher uvm. Bestellen Sie Ihr Buch zum Thema Bornavirus einfach online und lassen Sie es sich bequem nach
Hause schicken. Wir wünschen Ihnen schöne und entspannte Lesemomente mit Ihrem Buch.
Bornavirus - Große Auswahl Bücher bei Buch findr
Bei uns finden Sie Bücher beliebter Autoren, Neuerscheinungen, Bestseller genauso wie alte Schätze. Bücher zum
Thema Bornavirus, die Ihre Fantasie anregen und Bücher, die Sie weiterbilden und Ihnen wissenschaftliche
Fakten vermitteln. Ganz nach Ihrem Geschmack ist das passende Buch für Sie dabei. Finden Sie eine große Auswahl
Bücher verschiedenster Genres, Verlage, Autoren bei Buchfindr:
Sie haben viele Möglichkeiten bei Buch findr die passenden Bücher für Ihr Lesevergnügen zu entdecken. Nutzen Sie
unsere Suchfunktionen, um zu stöbern und für Sie interessante Bücher in den unterschiedlichen Genres und Kategorien
zu finden. Unter Bornavirus und weitere Themen und Kategorien finden Sie schnell und einfach eine Auflistung
thematisch passender Bücher. Probieren Sie es aus, legen Sie jetzt los! Ihrem Lesevergnügen steht nichts im Wege.
Nutzen Sie die Vorteile Ihre Bücher online zu kaufen und bekommen Sie die bestellten Bücher schnell und bequem
zugestellt. Nehmen Sie sich die Zeit, online die Bücher Ihrer Wahl anzulesen, Buchempfehlungen und Rezensionen zu
studieren, Informationen zu Autoren zu lesen. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen das Team von Buchfindr.