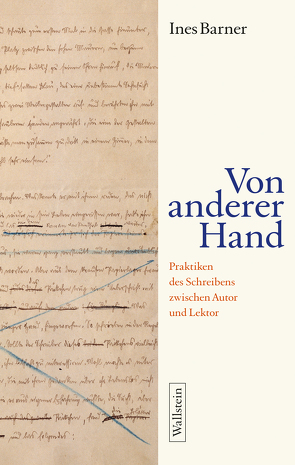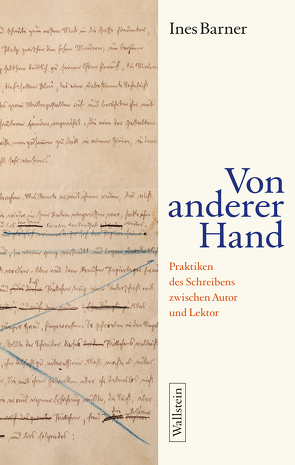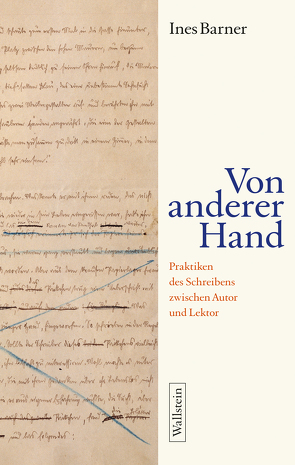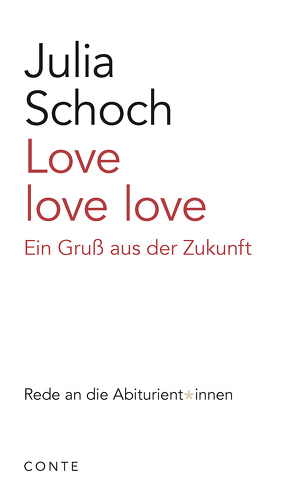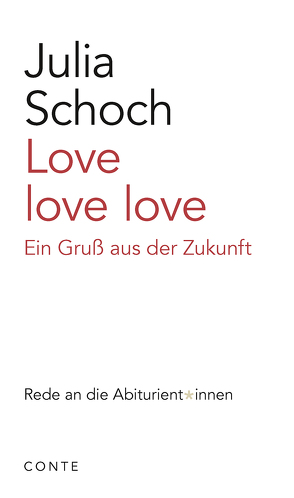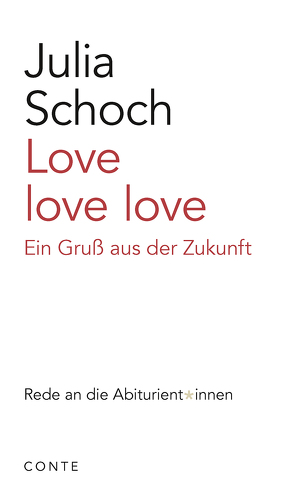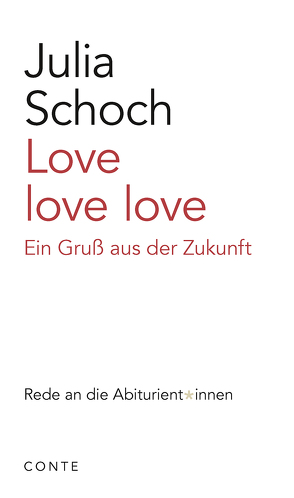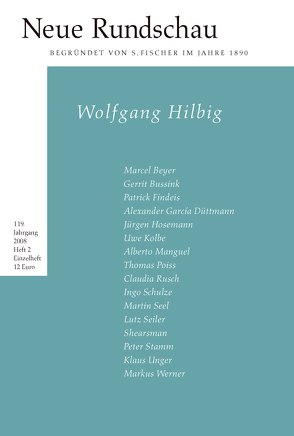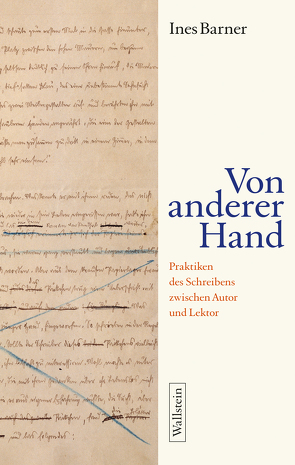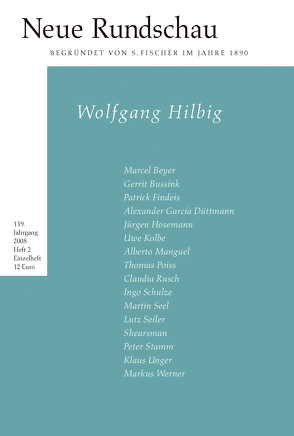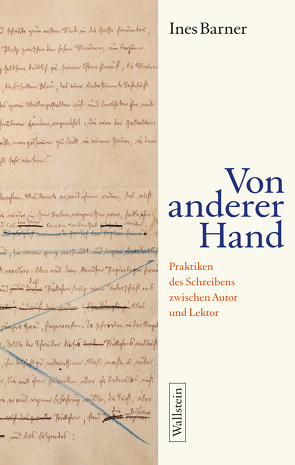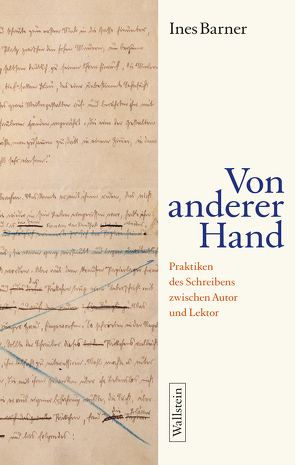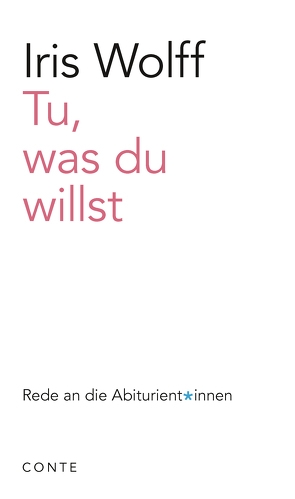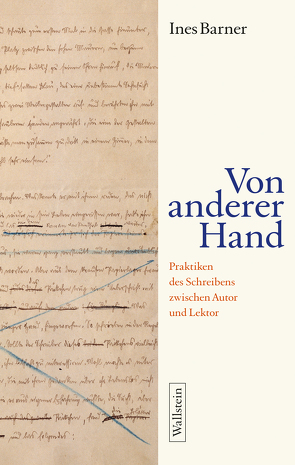
Literatur machen. Fallstudien zur Zusammenarbeit von Autor und Lektor im 20. Jahrhundert.
Robert Walser / Christian Morgenstern
Rainer Maria Rilke / Fritz Hünich
Peter Handke / Elisabeth Borchers
Marcel Beyer / Christian Döring
Schreiben braucht den Rückzug – so ein Topos, der das Schreiben zum Ort der Abgeschiedenheit macht. Doch werden Texte und Bücher nicht von Autoren allein gemacht, sondern im Wechselspiel verschiedener Akteure. Mit dem Aufkommen des Lektorats um 1900 wurde die Funktion des mitschreibenden Anderen institutionalisiert. Seitdem avancierte das Lektorat zu jener Vermittlungsinstanz, die nicht nur auswählt, welche Texte zu Büchern werden, sondern qua Mitarbeit am Text vielfach formt, was wir lesen. Welches Wissen wird zwischen Autor und Lektor ausgehandelt, hergestellt und angewendet? Lässt sich ein Text so ›verbessern‹, dass er seinen eigenen Maßgaben gerecht bleibt (oder vielleicht erst wird) und zugleich den Voraussetzungen seiner künftigen Öffentlichkeit entspricht? Die Verschiebung der Aufmerksamkeit vom singulären Autor auf den »unsichtbaren Zweiten« rückt die betrieblichen Bedingungen moderner Autorschaft in den Fokus. Literarisches Schreiben wird als eine relationale, kollaborative Praxis greifbar. Zugleich eröffnet der Blick auf das Lektorieren neue Perspektiven auf literarische Werke sowie auf die zugehörigen Schreibszenen und Autorenbilder.
Das Buch versammelt vier Fallstudien, die auf größtenteils erstmals rekonstruiertem Quellenmaterial beruhen. Untersucht wird die Zusammenarbeit von Robert Walser und Christian Morgenstern, von Rainer Maria Rilke und Fritz Hünich, von Peter Handke und Elisabeth Borchers sowie von Marcel Beyer und Christian Döring.
Aktualisiert: 2023-06-30
> findR *
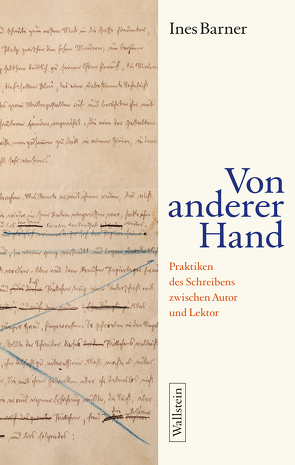
Literatur machen. Fallstudien zur Zusammenarbeit von Autor und Lektor im 20. Jahrhundert.
Robert Walser / Christian Morgenstern
Rainer Maria Rilke / Fritz Hünich
Peter Handke / Elisabeth Borchers
Marcel Beyer / Christian Döring
Schreiben braucht den Rückzug – so ein Topos, der das Schreiben zum Ort der Abgeschiedenheit macht. Doch werden Texte und Bücher nicht von Autoren allein gemacht, sondern im Wechselspiel verschiedener Akteure. Mit dem Aufkommen des Lektorats um 1900 wurde die Funktion des mitschreibenden Anderen institutionalisiert. Seitdem avancierte das Lektorat zu jener Vermittlungsinstanz, die nicht nur auswählt, welche Texte zu Büchern werden, sondern qua Mitarbeit am Text vielfach formt, was wir lesen. Welches Wissen wird zwischen Autor und Lektor ausgehandelt, hergestellt und angewendet? Lässt sich ein Text so ›verbessern‹, dass er seinen eigenen Maßgaben gerecht bleibt (oder vielleicht erst wird) und zugleich den Voraussetzungen seiner künftigen Öffentlichkeit entspricht? Die Verschiebung der Aufmerksamkeit vom singulären Autor auf den »unsichtbaren Zweiten« rückt die betrieblichen Bedingungen moderner Autorschaft in den Fokus. Literarisches Schreiben wird als eine relationale, kollaborative Praxis greifbar. Zugleich eröffnet der Blick auf das Lektorieren neue Perspektiven auf literarische Werke sowie auf die zugehörigen Schreibszenen und Autorenbilder.
Das Buch versammelt vier Fallstudien, die auf größtenteils erstmals rekonstruiertem Quellenmaterial beruhen. Untersucht wird die Zusammenarbeit von Robert Walser und Christian Morgenstern, von Rainer Maria Rilke und Fritz Hünich, von Peter Handke und Elisabeth Borchers sowie von Marcel Beyer und Christian Döring.
Aktualisiert: 2023-06-30
> findR *
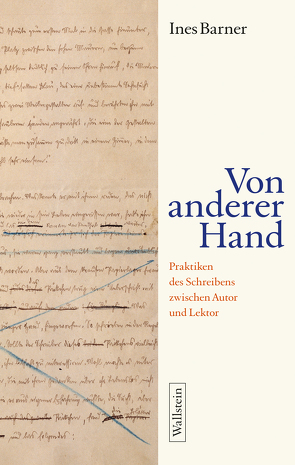
Literatur machen. Fallstudien zur Zusammenarbeit von Autor und Lektor im 20. Jahrhundert.
Robert Walser / Christian Morgenstern
Rainer Maria Rilke / Fritz Hünich
Peter Handke / Elisabeth Borchers
Marcel Beyer / Christian Döring
Schreiben braucht den Rückzug – so ein Topos, der das Schreiben zum Ort der Abgeschiedenheit macht. Doch werden Texte und Bücher nicht von Autoren allein gemacht, sondern im Wechselspiel verschiedener Akteure. Mit dem Aufkommen des Lektorats um 1900 wurde die Funktion des mitschreibenden Anderen institutionalisiert. Seitdem avancierte das Lektorat zu jener Vermittlungsinstanz, die nicht nur auswählt, welche Texte zu Büchern werden, sondern qua Mitarbeit am Text vielfach formt, was wir lesen. Welches Wissen wird zwischen Autor und Lektor ausgehandelt, hergestellt und angewendet? Lässt sich ein Text so ›verbessern‹, dass er seinen eigenen Maßgaben gerecht bleibt (oder vielleicht erst wird) und zugleich den Voraussetzungen seiner künftigen Öffentlichkeit entspricht? Die Verschiebung der Aufmerksamkeit vom singulären Autor auf den »unsichtbaren Zweiten« rückt die betrieblichen Bedingungen moderner Autorschaft in den Fokus. Literarisches Schreiben wird als eine relationale, kollaborative Praxis greifbar. Zugleich eröffnet der Blick auf das Lektorieren neue Perspektiven auf literarische Werke sowie auf die zugehörigen Schreibszenen und Autorenbilder.
Das Buch versammelt vier Fallstudien, die auf größtenteils erstmals rekonstruiertem Quellenmaterial beruhen. Untersucht wird die Zusammenarbeit von Robert Walser und Christian Morgenstern, von Rainer Maria Rilke und Fritz Hünich, von Peter Handke und Elisabeth Borchers sowie von Marcel Beyer und Christian Döring.
Aktualisiert: 2023-06-30
> findR *
Sie alle hier stehen auch vor solch einem Moment. Manch einem macht er vermutlich Angst, andere fühlen sich lässig herausgefordert, und andere empfinden vielleicht gar nichts. Ich weiß nicht, welche Variante die beste ist. Ich weiß es wirklich nicht. Obwohl ich zu Ihnen aus der Zukunft spreche.
Aktualisiert: 2023-06-29
> findR *
Sie alle hier stehen auch vor solch einem Moment. Manch einem macht er vermutlich Angst, andere fühlen sich lässig herausgefordert, und andere empfinden vielleicht gar nichts. Ich weiß nicht, welche Variante die beste ist. Ich weiß es wirklich nicht. Obwohl ich zu Ihnen aus der Zukunft spreche.
Aktualisiert: 2023-06-29
> findR *
Sie alle hier stehen auch vor solch einem Moment. Manch einem macht er vermutlich Angst, andere fühlen sich lässig herausgefordert, und andere empfinden vielleicht gar nichts. Ich weiß nicht, welche Variante die beste ist. Ich weiß es wirklich nicht. Obwohl ich zu Ihnen aus der Zukunft spreche.
Aktualisiert: 2023-06-29
> findR *
Sie alle hier stehen auch vor solch einem Moment. Manch einem macht er vermutlich Angst, andere fühlen sich lässig herausgefordert, und andere empfinden vielleicht gar nichts. Ich weiß nicht, welche Variante die beste ist. Ich weiß es wirklich nicht. Obwohl ich zu Ihnen aus der Zukunft spreche.
Aktualisiert: 2023-06-29
> findR *

Literatur kann die Vergangenheit aufleben lassen, indem sie zu einem durch Worte geformten ,Experimentierraum‘ wird. Das interaktive Potential von NS-Täterfiktionen, einem Subgenre der Gattung der Holocaust-Literatur, kann einen wichtigen erinnerungsstiftenden Beitrag zur individuellen Auseinandersetzung mit den NS-Tätern und Täterinnen leisten. Dieses Buch bietet eine vergleichende Analyse der Romane (1995) von Bernhard Schlink, (1995) von Marcel Beyer und (2019) von Martin Beyer, durch die das spezifische ,Interaktionspotential‘ dieser drei Texte herausgear-beitet wird. Durch die offene Erzählstruktur der Texte, die janusköpfige Täterfigurendarstel-lung, den Einsatz von intertextuellen Verweisen sowie Referenzen und Authentizitätsmarkern entfaltet sich ein besonderes appellatives Potential, durch das die Leserinnen und Leser in ein interaktives Leseerlebnis involviert werden, das eine kritische und ,explorative‘ Lesehaltung einfordert und Prozesse der Selbstpositionierung anstößt. Dadurch werden die Leserinnen und Leser in der Auseinandersetzung mit diesen Texten – ganz im Sinne Sartres – zur Einnahme einer autonomen und engagierten Lesehaltung angeregt.
Inhalt
0. Einleitung: Die textüberschreitende, interaktive Auseinandersetzung mit zeitgenössischen NS-Täterfiktionen durch ,Erinnerungshandeln‘ und ,Selbstpositionierung‘ 1
1. Holocaust-Erinnerung in Deutschland 16
1.1 Der Täterdiskurs in Deutschland: Eine zeitgeschichtliche Bestandsaufnahme 16
1.1.1 Der Täterdiskurs der unmittelbaren Nachkriegsjahre 21
1.1.2 Der Täterdiskurs von 1960 bis in die 1980er Jahre 28
1.1.3 Der Täterdiskurs ab 1990 36
1.2 Die ,Normalität‘ der NS-Täter? Psychosoziale Muster der NS-Täter 42
1.3 Entwicklung eines ,mehrdimensionalen‘ Täterbegriffs 69
1.4 Ausgangslage für die multikausal inspirierte Analyse der Täterfigurenkonzeption 83
2. Das Täterbild in der Literatur 86
2.1 Holocaust-Literatur 86
2.2 Die Blickwende zu den NS-Tätern und Täterinnen in der Literatur 101
2.3 Literaturwissenschaftlicher Forschungsstand 118
3. Das Interaktionspotential zeitgenössischer NS-Täterfiktionen:
Erzähltechnische und wirkungsästhetische Strategien 135
3.1 Appellfunktion der offenen Erzählstruktur 140
3.2 Inszenierung der Täterfigur 150
3.3 Dialogizität durch Intertextualität 158
3.4 Referenzen und Authentizitätsstrategien 161
4. Bernhard Schlink: (1995) 165
4.1 Appellfunktion der offenen Erzählstruktur 170
4.2 Inszenierung der NS-Täterin Hanna Schmitz 178
4.2.1 Analyse der janusköpfigen Täterfigurenkonzeption 180
4.2.2 Einordnung in die Tätertypologie 204
4.3 Dialogizität durch Intertextualität 219
4.4 Referenzen und Authentizitätsstrategien 244
5. Marcel Beyer: (1995) 251
5.1 Appellfunktion der offenen Erzählstruktur 256
5.2 Inszenierung des NS-Täters Hermann Karnau 260
5.2.1 Analyse der janusköpfigen Täterfigurenkonzeption 262
5.2.2 Einordnung in die Tätertypologie 291
5.3 Dialogizität durch Intertextualität 294
5.4 Referenzen und Authentizitätsstrategien 313
6. Martin Beyer: (2019) 329
6.1 Appellfunktion der offenen Erzählstruktur 336
6.2 Inszenierung des NS-Täters August Unterseher 343
6.2.1 Analyse der janusköpfigen Täterfigurenkonzeption 344
6.2.2 Einordnung in die Tätertypologie 371
6.3 Dialogizität durch Intertextualität 374
6.4 Referenzen und Authentizitätsstrategien 387
7. Fazit 400
8. Literaturverzeichnis 408
Aktualisiert: 2023-06-29
> findR *

Literatur kann die Vergangenheit aufleben lassen, indem sie zu einem durch Worte geformten ,Experimentierraum‘ wird. Das interaktive Potential von NS-Täterfiktionen, einem Subgenre der Gattung der Holocaust-Literatur, kann einen wichtigen erinnerungsstiftenden Beitrag zur individuellen Auseinandersetzung mit den NS-Tätern und Täterinnen leisten. Dieses Buch bietet eine vergleichende Analyse der Romane (1995) von Bernhard Schlink, (1995) von Marcel Beyer und (2019) von Martin Beyer, durch die das spezifische ,Interaktionspotential‘ dieser drei Texte herausgear-beitet wird. Durch die offene Erzählstruktur der Texte, die janusköpfige Täterfigurendarstel-lung, den Einsatz von intertextuellen Verweisen sowie Referenzen und Authentizitätsmarkern entfaltet sich ein besonderes appellatives Potential, durch das die Leserinnen und Leser in ein interaktives Leseerlebnis involviert werden, das eine kritische und ,explorative‘ Lesehaltung einfordert und Prozesse der Selbstpositionierung anstößt. Dadurch werden die Leserinnen und Leser in der Auseinandersetzung mit diesen Texten – ganz im Sinne Sartres – zur Einnahme einer autonomen und engagierten Lesehaltung angeregt.
Inhalt
0. Einleitung: Die textüberschreitende, interaktive Auseinandersetzung mit zeitgenössischen NS-Täterfiktionen durch ,Erinnerungshandeln‘ und ,Selbstpositionierung‘ 1
1. Holocaust-Erinnerung in Deutschland 16
1.1 Der Täterdiskurs in Deutschland: Eine zeitgeschichtliche Bestandsaufnahme 16
1.1.1 Der Täterdiskurs der unmittelbaren Nachkriegsjahre 21
1.1.2 Der Täterdiskurs von 1960 bis in die 1980er Jahre 28
1.1.3 Der Täterdiskurs ab 1990 36
1.2 Die ,Normalität‘ der NS-Täter? Psychosoziale Muster der NS-Täter 42
1.3 Entwicklung eines ,mehrdimensionalen‘ Täterbegriffs 69
1.4 Ausgangslage für die multikausal inspirierte Analyse der Täterfigurenkonzeption 83
2. Das Täterbild in der Literatur 86
2.1 Holocaust-Literatur 86
2.2 Die Blickwende zu den NS-Tätern und Täterinnen in der Literatur 101
2.3 Literaturwissenschaftlicher Forschungsstand 118
3. Das Interaktionspotential zeitgenössischer NS-Täterfiktionen:
Erzähltechnische und wirkungsästhetische Strategien 135
3.1 Appellfunktion der offenen Erzählstruktur 140
3.2 Inszenierung der Täterfigur 150
3.3 Dialogizität durch Intertextualität 158
3.4 Referenzen und Authentizitätsstrategien 161
4. Bernhard Schlink: (1995) 165
4.1 Appellfunktion der offenen Erzählstruktur 170
4.2 Inszenierung der NS-Täterin Hanna Schmitz 178
4.2.1 Analyse der janusköpfigen Täterfigurenkonzeption 180
4.2.2 Einordnung in die Tätertypologie 204
4.3 Dialogizität durch Intertextualität 219
4.4 Referenzen und Authentizitätsstrategien 244
5. Marcel Beyer: (1995) 251
5.1 Appellfunktion der offenen Erzählstruktur 256
5.2 Inszenierung des NS-Täters Hermann Karnau 260
5.2.1 Analyse der janusköpfigen Täterfigurenkonzeption 262
5.2.2 Einordnung in die Tätertypologie 291
5.3 Dialogizität durch Intertextualität 294
5.4 Referenzen und Authentizitätsstrategien 313
6. Martin Beyer: (2019) 329
6.1 Appellfunktion der offenen Erzählstruktur 336
6.2 Inszenierung des NS-Täters August Unterseher 343
6.2.1 Analyse der janusköpfigen Täterfigurenkonzeption 344
6.2.2 Einordnung in die Tätertypologie 371
6.3 Dialogizität durch Intertextualität 374
6.4 Referenzen und Authentizitätsstrategien 387
7. Fazit 400
8. Literaturverzeichnis 408
Aktualisiert: 2023-06-22
> findR *

Literatur kann die Vergangenheit aufleben lassen, indem sie zu einem durch Worte geformten ,Experimentierraum‘ wird. Das interaktive Potential von NS-Täterfiktionen, einem Subgenre der Gattung der Holocaust-Literatur, kann einen wichtigen erinnerungsstiftenden Beitrag zur individuellen Auseinandersetzung mit den NS-Tätern und Täterinnen leisten. Dieses Buch bietet eine vergleichende Analyse der Romane (1995) von Bernhard Schlink, (1995) von Marcel Beyer und (2019) von Martin Beyer, durch die das spezifische ,Interaktionspotential‘ dieser drei Texte herausgear-beitet wird. Durch die offene Erzählstruktur der Texte, die janusköpfige Täterfigurendarstel-lung, den Einsatz von intertextuellen Verweisen sowie Referenzen und Authentizitätsmarkern entfaltet sich ein besonderes appellatives Potential, durch das die Leserinnen und Leser in ein interaktives Leseerlebnis involviert werden, das eine kritische und ,explorative‘ Lesehaltung einfordert und Prozesse der Selbstpositionierung anstößt. Dadurch werden die Leserinnen und Leser in der Auseinandersetzung mit diesen Texten – ganz im Sinne Sartres – zur Einnahme einer autonomen und engagierten Lesehaltung angeregt.
Inhalt
0. Einleitung: Die textüberschreitende, interaktive Auseinandersetzung mit zeitgenössischen NS-Täterfiktionen durch ,Erinnerungshandeln‘ und ,Selbstpositionierung‘ 1
1. Holocaust-Erinnerung in Deutschland 16
1.1 Der Täterdiskurs in Deutschland: Eine zeitgeschichtliche Bestandsaufnahme 16
1.1.1 Der Täterdiskurs der unmittelbaren Nachkriegsjahre 21
1.1.2 Der Täterdiskurs von 1960 bis in die 1980er Jahre 28
1.1.3 Der Täterdiskurs ab 1990 36
1.2 Die ,Normalität‘ der NS-Täter? Psychosoziale Muster der NS-Täter 42
1.3 Entwicklung eines ,mehrdimensionalen‘ Täterbegriffs 69
1.4 Ausgangslage für die multikausal inspirierte Analyse der Täterfigurenkonzeption 83
2. Das Täterbild in der Literatur 86
2.1 Holocaust-Literatur 86
2.2 Die Blickwende zu den NS-Tätern und Täterinnen in der Literatur 101
2.3 Literaturwissenschaftlicher Forschungsstand 118
3. Das Interaktionspotential zeitgenössischer NS-Täterfiktionen:
Erzähltechnische und wirkungsästhetische Strategien 135
3.1 Appellfunktion der offenen Erzählstruktur 140
3.2 Inszenierung der Täterfigur 150
3.3 Dialogizität durch Intertextualität 158
3.4 Referenzen und Authentizitätsstrategien 161
4. Bernhard Schlink: (1995) 165
4.1 Appellfunktion der offenen Erzählstruktur 170
4.2 Inszenierung der NS-Täterin Hanna Schmitz 178
4.2.1 Analyse der janusköpfigen Täterfigurenkonzeption 180
4.2.2 Einordnung in die Tätertypologie 204
4.3 Dialogizität durch Intertextualität 219
4.4 Referenzen und Authentizitätsstrategien 244
5. Marcel Beyer: (1995) 251
5.1 Appellfunktion der offenen Erzählstruktur 256
5.2 Inszenierung des NS-Täters Hermann Karnau 260
5.2.1 Analyse der janusköpfigen Täterfigurenkonzeption 262
5.2.2 Einordnung in die Tätertypologie 291
5.3 Dialogizität durch Intertextualität 294
5.4 Referenzen und Authentizitätsstrategien 313
6. Martin Beyer: (2019) 329
6.1 Appellfunktion der offenen Erzählstruktur 336
6.2 Inszenierung des NS-Täters August Unterseher 343
6.2.1 Analyse der janusköpfigen Täterfigurenkonzeption 344
6.2.2 Einordnung in die Tätertypologie 371
6.3 Dialogizität durch Intertextualität 374
6.4 Referenzen und Authentizitätsstrategien 387
7. Fazit 400
8. Literaturverzeichnis 408
Aktualisiert: 2023-06-22
> findR *
Aktualisiert: 2023-06-20
> findR *
Aktualisiert: 2023-06-20
> findR *
Aktualisiert: 2023-06-20
> findR *
Ein Heft zu Wolfgang Hilbig: Mit dem Tod von Wolfgang Hilbig im Jahr 2007 verlor die deutschsprachige Literatur eine einzigartige Stimme, einen Autor zwischen Durchlässigkeit und Kraft, zwischen Unbeweglichkeit und Unruhe – so hat er sich selbst beschrieben. Wolfgang Hilbig war ein »Traumverlorener, ein versprengter Paradiesgänger« (Süddeutsche Zeitung), ein Verletzter und Widerständiger. Seine Romane, Erzählungen und Gedichte sind leidenschaftlich und voll brennender Sehnsucht, elegisch, grüblerisch, zärtlich. Der erste Band der Werkausgabe ist soeben erschienen. Die Neue Rundschau möchte an diesen großen Schriftsteller, Dichter und Essayisten erinnern und hat deshalb Weggefährten, Autoren und Freunde um Texte gebeten, die von seinem Werk und ihm als Person erzählen.
Aktualisiert: 2023-06-06
> findR *
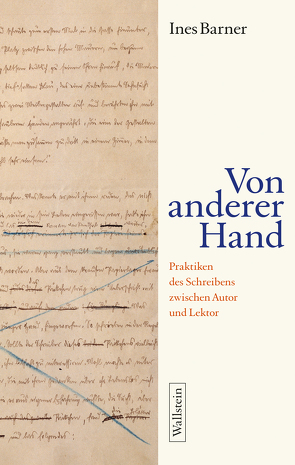
Literatur machen. Fallstudien zur Zusammenarbeit von Autor und Lektor im 20. Jahrhundert.
Robert Walser / Christian Morgenstern
Rainer Maria Rilke / Fritz Hünich
Peter Handke / Elisabeth Borchers
Marcel Beyer / Christian Döring
Schreiben braucht den Rückzug – so ein Topos, der das Schreiben zum Ort der Abgeschiedenheit macht. Doch werden Texte und Bücher nicht von Autoren allein gemacht, sondern im Wechselspiel verschiedener Akteure. Mit dem Aufkommen des Lektorats um 1900 wurde die Funktion des mitschreibenden Anderen institutionalisiert. Seitdem avancierte das Lektorat zu jener Vermittlungsinstanz, die nicht nur auswählt, welche Texte zu Büchern werden, sondern qua Mitarbeit am Text vielfach formt, was wir lesen. Welches Wissen wird zwischen Autor und Lektor ausgehandelt, hergestellt und angewendet? Lässt sich ein Text so ›verbessern‹, dass er seinen eigenen Maßgaben gerecht bleibt (oder vielleicht erst wird) und zugleich den Voraussetzungen seiner künftigen Öffentlichkeit entspricht? Die Verschiebung der Aufmerksamkeit vom singulären Autor auf den »unsichtbaren Zweiten« rückt die betrieblichen Bedingungen moderner Autorschaft in den Fokus. Literarisches Schreiben wird als eine relationale, kollaborative Praxis greifbar. Zugleich eröffnet der Blick auf das Lektorieren neue Perspektiven auf literarische Werke sowie auf die zugehörigen Schreibszenen und Autorenbilder.
Das Buch versammelt vier Fallstudien, die auf größtenteils erstmals rekonstruiertem Quellenmaterial beruhen. Untersucht wird die Zusammenarbeit von Robert Walser und Christian Morgenstern, von Rainer Maria Rilke und Fritz Hünich, von Peter Handke und Elisabeth Borchers sowie von Marcel Beyer und Christian Döring.
Aktualisiert: 2023-06-02
> findR *
Ein Heft zu Wolfgang Hilbig: Mit dem Tod von Wolfgang Hilbig im Jahr 2007 verlor die deutschsprachige Literatur eine einzigartige Stimme, einen Autor zwischen Durchlässigkeit und Kraft, zwischen Unbeweglichkeit und Unruhe – so hat er sich selbst beschrieben. Wolfgang Hilbig war ein »Traumverlorener, ein versprengter Paradiesgänger« (Süddeutsche Zeitung), ein Verletzter und Widerständiger. Seine Romane, Erzählungen und Gedichte sind leidenschaftlich und voll brennender Sehnsucht, elegisch, grüblerisch, zärtlich. Der erste Band der Werkausgabe ist soeben erschienen. Die Neue Rundschau möchte an diesen großen Schriftsteller, Dichter und Essayisten erinnern und hat deshalb Weggefährten, Autoren und Freunde um Texte gebeten, die von seinem Werk und ihm als Person erzählen.
Aktualisiert: 2023-06-02
> findR *
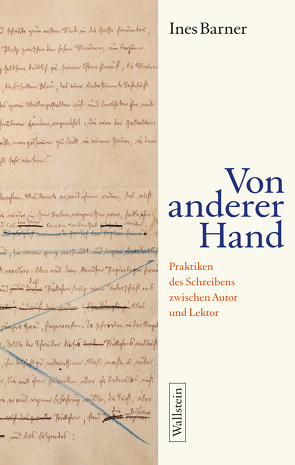
Literatur machen. Fallstudien zur Zusammenarbeit von Autor und Lektor im 20. Jahrhundert.
Robert Walser / Christian Morgenstern
Rainer Maria Rilke / Fritz Hünich
Peter Handke / Elisabeth Borchers
Marcel Beyer / Christian Döring
Schreiben braucht den Rückzug – so ein Topos, der das Schreiben zum Ort der Abgeschiedenheit macht. Doch werden Texte und Bücher nicht von Autoren allein gemacht, sondern im Wechselspiel verschiedener Akteure. Mit dem Aufkommen des Lektorats um 1900 wurde die Funktion des mitschreibenden Anderen institutionalisiert. Seitdem avancierte das Lektorat zu jener Vermittlungsinstanz, die nicht nur auswählt, welche Texte zu Büchern werden, sondern qua Mitarbeit am Text vielfach formt, was wir lesen. Welches Wissen wird zwischen Autor und Lektor ausgehandelt, hergestellt und angewendet? Lässt sich ein Text so ›verbessern‹, dass er seinen eigenen Maßgaben gerecht bleibt (oder vielleicht erst wird) und zugleich den Voraussetzungen seiner künftigen Öffentlichkeit entspricht? Die Verschiebung der Aufmerksamkeit vom singulären Autor auf den »unsichtbaren Zweiten« rückt die betrieblichen Bedingungen moderner Autorschaft in den Fokus. Literarisches Schreiben wird als eine relationale, kollaborative Praxis greifbar. Zugleich eröffnet der Blick auf das Lektorieren neue Perspektiven auf literarische Werke sowie auf die zugehörigen Schreibszenen und Autorenbilder.
Das Buch versammelt vier Fallstudien, die auf größtenteils erstmals rekonstruiertem Quellenmaterial beruhen. Untersucht wird die Zusammenarbeit von Robert Walser und Christian Morgenstern, von Rainer Maria Rilke und Fritz Hünich, von Peter Handke und Elisabeth Borchers sowie von Marcel Beyer und Christian Döring.
Aktualisiert: 2023-05-19
> findR *
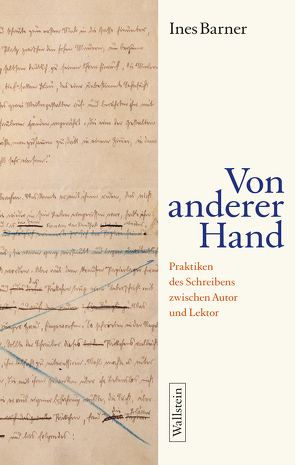
Literatur machen. Fallstudien zur Zusammenarbeit von Autor und Lektor im 20. Jahrhundert.
Robert Walser / Christian Morgenstern
Rainer Maria Rilke / Fritz Hünich
Peter Handke / Elisabeth Borchers
Marcel Beyer / Christian Döring
Schreiben braucht den Rückzug – so ein Topos, der das Schreiben zum Ort der Abgeschiedenheit macht. Doch werden Texte und Bücher nicht von Autoren allein gemacht, sondern im Wechselspiel verschiedener Akteure. Mit dem Aufkommen des Lektorats um 1900 wurde die Funktion des mitschreibenden Anderen institutionalisiert. Seitdem avancierte das Lektorat zu jener Vermittlungsinstanz, die nicht nur auswählt, welche Texte zu Büchern werden, sondern qua Mitarbeit am Text vielfach formt, was wir lesen. Welches Wissen wird zwischen Autor und Lektor ausgehandelt, hergestellt und angewendet? Lässt sich ein Text so ›verbessern‹, dass er seinen eigenen Maßgaben gerecht bleibt (oder vielleicht erst wird) und zugleich den Voraussetzungen seiner künftigen Öffentlichkeit entspricht? Die Verschiebung der Aufmerksamkeit vom singulären Autor auf den »unsichtbaren Zweiten« rückt die betrieblichen Bedingungen moderner Autorschaft in den Fokus. Literarisches Schreiben wird als eine relationale, kollaborative Praxis greifbar. Zugleich eröffnet der Blick auf das Lektorieren neue Perspektiven auf literarische Werke sowie auf die zugehörigen Schreibszenen und Autorenbilder.
Das Buch versammelt vier Fallstudien, die auf größtenteils erstmals rekonstruiertem Quellenmaterial beruhen. Untersucht wird die Zusammenarbeit von Robert Walser und Christian Morgenstern, von Rainer Maria Rilke und Fritz Hünich, von Peter Handke und Elisabeth Borchers sowie von Marcel Beyer und Christian Döring.
Aktualisiert: 2023-05-12
> findR *
Wir haben keine Ahnung, was der Wind eigentlich macht.
Vielleicht ist der Verstand nicht oben und die Gefühle unten, also weniger wert, sondern manchmal genau andersherum. Vielleicht sind Kontrolle, Macht und Status nicht unter allen Umständen erstrebenswert, sondern auch Qualitäten wie Nachgiebigkeit, Offenheit, die Freiheit von materiellen Dingen.
Aktualisiert: 2023-01-04
> findR *
MEHR ANZEIGEN
Bücher zum Thema Marcel Beyer
Sie suchen ein Buch über Marcel Beyer? Bei Buch findr finden Sie eine große Auswahl Bücher zum
Thema Marcel Beyer. Entdecken Sie neue Bücher oder Klassiker für Sie selbst oder zum Verschenken. Buch findr
hat zahlreiche Bücher zum Thema Marcel Beyer im Sortiment. Nehmen Sie sich Zeit zum Stöbern und finden Sie das
passende Buch für Ihr Lesevergnügen. Stöbern Sie durch unser Angebot und finden Sie aus unserer großen Auswahl das
Buch, das Ihnen zusagt. Bei Buch findr finden Sie Romane, Ratgeber, wissenschaftliche und populärwissenschaftliche
Bücher uvm. Bestellen Sie Ihr Buch zum Thema Marcel Beyer einfach online und lassen Sie es sich bequem nach
Hause schicken. Wir wünschen Ihnen schöne und entspannte Lesemomente mit Ihrem Buch.
Marcel Beyer - Große Auswahl Bücher bei Buch findr
Bei uns finden Sie Bücher beliebter Autoren, Neuerscheinungen, Bestseller genauso wie alte Schätze. Bücher zum
Thema Marcel Beyer, die Ihre Fantasie anregen und Bücher, die Sie weiterbilden und Ihnen wissenschaftliche
Fakten vermitteln. Ganz nach Ihrem Geschmack ist das passende Buch für Sie dabei. Finden Sie eine große Auswahl
Bücher verschiedenster Genres, Verlage, Autoren bei Buchfindr:
Sie haben viele Möglichkeiten bei Buch findr die passenden Bücher für Ihr Lesevergnügen zu entdecken. Nutzen Sie
unsere Suchfunktionen, um zu stöbern und für Sie interessante Bücher in den unterschiedlichen Genres und Kategorien
zu finden. Unter Marcel Beyer und weitere Themen und Kategorien finden Sie schnell und einfach eine Auflistung
thematisch passender Bücher. Probieren Sie es aus, legen Sie jetzt los! Ihrem Lesevergnügen steht nichts im Wege.
Nutzen Sie die Vorteile Ihre Bücher online zu kaufen und bekommen Sie die bestellten Bücher schnell und bequem
zugestellt. Nehmen Sie sich die Zeit, online die Bücher Ihrer Wahl anzulesen, Buchempfehlungen und Rezensionen zu
studieren, Informationen zu Autoren zu lesen. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen das Team von Buchfindr.