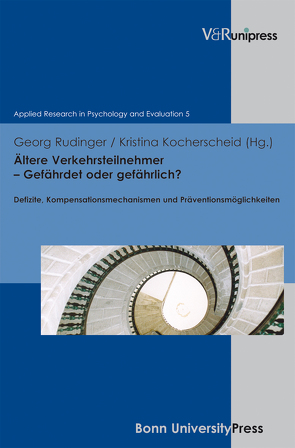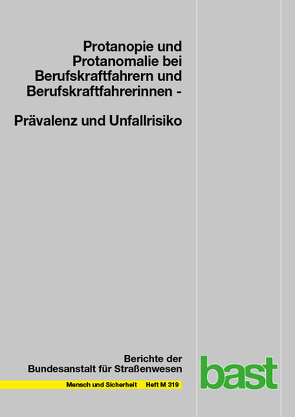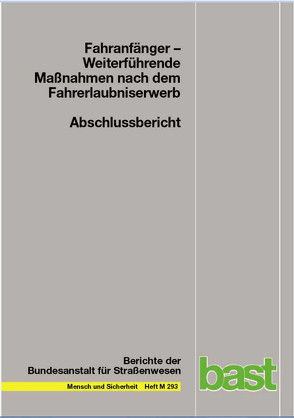Aktualisiert: 2023-07-03
> findR *

Die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) ist eine sehr häufige psychiatrische Störung im Kindesalter, die derzeit primär neurobiologisch und genetisch erklärt wird. Der Autor liefert einerseits einen umfassenden Überblick zu Geschichte, Definition und Diagnose, Ätiologie, Begleitstörungen und Modellen, andererseits geht er erstmals der Frage nach, ob diese Erkrankung auch auf Basis systemischer und evolutionärer Hypothesen differenzierter analysiert und erklärt werden kann. Insbesondere geht er der Frage nach, ob innerhalb des breiten Spektrums von ADHS ein bestimmter Subtyp ein erhöhtes Unfallrisiko aufweist. Neben den empirischen Ergebnissen können aus dieser Arbeit auch klinisch-sozialpädagogische Konsequenzen gezogen werden. Durch ein maßgeschneidertes Bündeln von fördernden und fordernden Komponenten – im Sinne eines ganzheitlichen Behandlungskonzepts – wird zukünftig der Sozialpädagogik besonders in der Risikoprävention eine größere Bedeutung zukommen.
Aktualisiert: 2023-07-02
> findR *

Die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) ist eine sehr häufige psychiatrische Störung im Kindesalter, die derzeit primär neurobiologisch und genetisch erklärt wird. Der Autor liefert einerseits einen umfassenden Überblick zu Geschichte, Definition und Diagnose, Ätiologie, Begleitstörungen und Modellen, andererseits geht er erstmals der Frage nach, ob diese Erkrankung auch auf Basis systemischer und evolutionärer Hypothesen differenzierter analysiert und erklärt werden kann. Insbesondere geht er der Frage nach, ob innerhalb des breiten Spektrums von ADHS ein bestimmter Subtyp ein erhöhtes Unfallrisiko aufweist. Neben den empirischen Ergebnissen können aus dieser Arbeit auch klinisch-sozialpädagogische Konsequenzen gezogen werden. Durch ein maßgeschneidertes Bündeln von fördernden und fordernden Komponenten – im Sinne eines ganzheitlichen Behandlungskonzepts – wird zukünftig der Sozialpädagogik besonders in der Risikoprävention eine größere Bedeutung zukommen.
Aktualisiert: 2023-07-02
> findR *
Richtig reagieren bei Notfällen mit Kindern und Jugendlichen
Aktualisiert: 2023-06-28
> findR *
Richtig reagieren bei Notfällen mit Kindern und Jugendlichen
Aktualisiert: 2023-06-28
> findR *
Ältere Verkehrsteilnehmer – Gefährdet oder gefährlich?
Aktualisiert: 2023-06-28
> findR *
Ältere Verkehrsteilnehmer – Gefährdet oder gefährlich?
Aktualisiert: 2023-06-28
> findR *
Ältere Verkehrsteilnehmer – Gefährdet oder gefährlich?
Aktualisiert: 2023-05-28
> findR *
Richtig reagieren bei Notfällen mit Kindern und Jugendlichen
Aktualisiert: 2023-05-28
> findR *
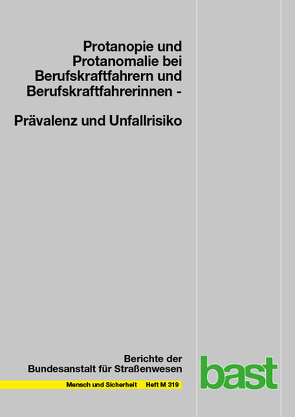
M 319: Paula Friedrichs, Paul Schmidt, Kerstin Schmidt:
Protanopie und Protanomalie bei Berufskraftfahrern und Berufskraftfahrerinnen:
Prävalenz und Unfallrisiko
68 S., 13 Abb., 29 Tab., ISBN 978-3-95606-624-5, 2021
Hintergrund der Studie war die Harmonisierung des europäischen Rechts zur Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) bezüglich der Anforderungen an das Farbsehvermögen von Berufskraftfahrern und Berufskraftfahrerinnen. Mit der Umsetzung in deutsches Recht können seit dem 01.07.2011 Personen mit einer vorliegenden Rotblindheit oder Rotsehschwäche in Deutschland auch sämtliche Fahrerlaubnisse der Gruppe 2 (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, FzF) erwerben (zuvor nur C1, C1E, C, CE), bei Rotblindheit oder Rotschwäche mit einem Anomalquotienten unter 0,5 ist jetzt lediglich eine Aufklärung der betroffenen Person über die mögliche Gefährdung erforderlich. Gegen diese gelockerte Regelung werden von der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft und anderen Fachleuten Bedenken geäußert. Um eine Grundlage in der Argumentation zu zukünftigen oder bestehenden gesetzlichen Regelungen zu schaffen, sollten in der vorliegenden Studie belastbare epidemiologische Daten, die Rückschlüsse auf das Ausmaß und die Relevanz von Protanopie und Protanomalie bei Berufskraftfahrern und Berufskraftfahrerinnen für die Verkehrssicherheit zulassen, recherchiert werden. Die Datengewinnung erfolgte auf zwei Wegen. Zum einen fand eine systematische Literaturrecherche zur Identifizierung von Studien statt, wobei die Studien nach bestimmten Kriterien ausgewählt und anschließend die jeweiligen Daten extrahiert wurden. Zum anderen erfolgte eine Datenrecherche bei Behörden, Fachgesellschaften, Versicherern und Berufsgenossenschaften. In der Datenrecherche wurden veröffentlichte Zahlen recherchiert sowie Institutionen, Arbeits-/Betriebsmedizinpraxen und weitere Fachleute nach Daten befragt. Eine Datengrundlage zur Schätzung der aktuellen Prävalenz speziell unter Berufskraftfahrern und Berufskraftfahrerinnen konnte weder über die Daten noch über die Literaturrecherche geschaffen werden. Bei keiner der kontaktierten Institutionen liegen strukturierte personenbezogene Daten zur Diagnose von Farbsinnstörungen vor. In der Literaturrecherche konnten jedoch Prävalenzen für die Gesamtbevölkerung in Europa ermittelt und in einer Metaanalyse zusammengefasst werden. Die ermittelten Werte bestätigen die allgemein verwendeten Werte. Innerhalb der männlichen Bevölkerung sind ca. 1 % protanop und ca. 2 % protogestört, wohingegen die Prävalenzen beider Protostörungen bei Frauen deutlich unter 0,1 % liegen. Eine Datengrundlage zur Schätzung des Unfallrisikos unter protogestörten Berufskraftfahrern und Berufskraftfahrerinnen konnte ausschließlich über die Literaturrecherche und lediglich in begrenztem Umfang geschaffen werden. Bis auf eine Studie, die 1996 veröffentlicht wurde, wurden die identifizierten Studien vor 1980 publiziert und es ist zweifelhaft, ob die damaligen Bedingungen (Straßenverhältnisse, Verkehrsaufkommen, lichttechnische Ausstattung der Kraftfahrzeuge, technische Anforderungen an die Verkehrszeichen usw.) mit heutigen Verhältnissen vergleichbar sind. Hinsichtlich des Unfallrisikos lässt sich übergreifend aus den identifizierten und eingeschlossenen Studien keine statistische Erhöhung des Unfallrisikos bei oder durch protanope, protanomale oder protogestörte Kraftfahrzeugführende nachweisen, sodass die auf Basis dieser Studie ermittelten Daten keine Grundlage für eine Rücknahme der im Rahmen der Harmonisierung des europäischen Rechts zum 01.07.2011 erfolgten Änderung der Anlage 6 FeV bieten.
Aktualisiert: 2023-01-16
> findR *
Sportunfälle sind eindeutig der Schwerpunkt bei den Unfällen Studierender. Das hohe Unfallrisiko zeigt sich sowohl im Sportstudium als auch im Rahmen der Sportangebote des allgemeinen freiwilligen Hochschulsports. Statistische Auswertungen machen deutlich, dass Sportunfälle in Hochschulen mehr Kosten verursachen als alle anderen
Fachbereiche zusammen. Bis zu 75 % der Unfallkosten fallen für die Behandlung von Sportunfällen an. Entsprechend hoch ist auch das Verletzungsrisiko. Mit Band 16 der Schriftenreihe möchten wir Übungsleitern, Studierenden, Hochschulsportverantwortlichen und Hochschulleitungen die Zusammenhänge zwischen „falschem Sport“ und Unfallrisiko deutlich machen. Die Schrift entstand im Rahmen einer Kooperation zwischen der Hochschule Fulda, der Landesunfallkasse Niedersachsen, dem Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband (adh) und der Unfallkasse Hessen.
Aktualisiert: 2020-11-24
> findR *
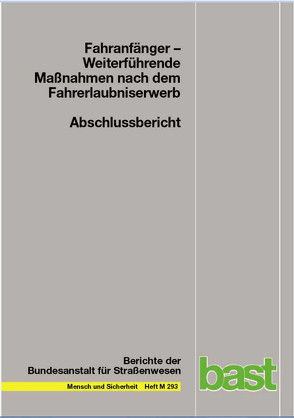
M 293:
Projektgruppe Hochrisikophase Fahranfänger
Fahranfänger – weiterführende Maßnahmen nach dem Fahrerlaubniserwerb
Abschlussbericht
88 S., 7 Abb., 13 Tab., ISBN 978-3-95606-483-8, 201 259 g EUR 17,50
Die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) wurde im Oktober 2013 vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) beauftragt, im Rahmen einer Projektgruppe weitere Maßnahmenvorschläge zur Absenkung des Fahranfängerrisikos zu erarbeiten. Der Projektgruppenauftrag umfasste zwei Aufgabenstellungen: Im Rahmen von Aufgabe A sollten weiterführende Maßnahmen zur Absenkung des Unfallrisikos von Fahranfängern in der Phase ihrer Höchstgefährdung unmittelbar am Anfang des selbständigen Fahrens (sogenannte „Hochrisikophase“) erarbeitet werden. Als Maßnahmenarten in der Hochrisikophase sollten berücksichtigt werden:
Möglichkeiten
1. des erweiterten Fahrerfahrungsaufbaus unter risikoarmen Bedingungen,
2. der Verstärkung protektiver Regelungen und
3. der edukativen Intervention.
Im Rahmen von Aufgabe B sollten Konzepte zur Institutionalisierung einer breiteren wissenschaftlichen Abstützung von Fahrausbildung und Fahranfängermaßnahmen entwickelt werden.
Die BASt richtete entsprechend eine Projektgruppe "Hochrisikophase Fahranfänger“ (PGHR) ein. Beteiligt an dieser Gruppe waren Vertreter der verkehrspolitischen Fachebene von Bund und Ländern, Experten der Praxisverbände (z.B. ADAC, DVR, Fahrlehrerverbände) sowie externe Wissenschaftler und die Fachreferenten der BASt. Die Projektgruppe traf sich zur Bearbeitung beider Aufgabenstellungen mehrfach zwischen Februar 2014 und Oktober 2018. Der vorliegende Abschlussbericht stellt die Ergebnisse der Projektgruppenarbeit dar. Er wurde von den Fachreferenten der BASt erstellt und mit den Projektgruppenmitgliedern abgestimmmt.
Teil I des Abschlussberichts geht auf die Projektgruppenergebnisse zu Aufgabe A ein. Im Kern steht hier ein gemeinsamer Vorschlag der Projektgruppen¬mitglieder für eine zukünftige Ausrichtung des deutschen Systems der Fahranfängervorbereitung in der Phase nach der obligatorischen Fahrausbildung und Fahrerlaubnisprüfung. Der Projektgruppenvorschlag für die Hochrisikophase umfasst im Wesentlichen:
• Eine generelle Verlängerung der Probezeit – Die Probezeit beträgt derzeit zwei Jahre. Es wird vorgeschlagen, die Probezeit auf drei Jahre auszudehnen, um Fahranfänger länger zu einem vorsichtigen und regelkonformen Fahren anzuhalten.
• Probezeitreduzierungen bei freiwilliger Teilnahme an qualifizierten Maßnahmen – Als Anreiz zur freiwilligen Teilnahme an solchen qualifizierten Maßnahmen werden Probezeitreduzierungen vorgeschlagen. Das vorgeschlagene Schema sieht als maximal zu erreichende Probezeitreduzierung 12 Monate vor. Somit ergibt sich als Untergrenze eine zweijährige Probezeit entsprechend der derzeitigen Probezeit¬regelung. Qualifizierte Maßnahmen – Begleitetes Fahren und edukative Maßnahmen werden als qualifizierte Maßnahmen vorgeschlagen.
Diese einzelnen Elemente des Projektgruppenvorschlags werden sowohl detailliert beschrieben als auch begründet.
Teil II des Abschlussberichts geht – ebenfalls im Rahmen von Aufgabe A –ausführlich auf die im Projektvorschlag enthaltenen edukativen Maßnahmen für die Hochrisikophase ein. Hier sind zwei eigenständige Berichte enthalten, die – zusätzlich zur Projektgruppenarbeit – von den Erstellern der edukativen Maßnahmen in Auftrag gegeben wurden. Der erste dieser beiden eigenständigen Berichte stellt die zwei erarbeiteten edukativen Maßnahmen vor. Hierzu wird eingegangen auf zentrale Fragen zu Nutzenerwartungen für die Fahranfängervorbereitung, zu wissenschaftlichen Grundlagen der Gestaltung der edukativen Maßnahmen sowie zu organisatorischen Anforderungen an eine Implementierung der edukativen Maßnahmen. Der zweite dieser beiden eigenständigen Berichte beinhaltet eine Gegenüberstellung der beiden edukativen Maßnahmen des Projektgruppenvorschlags mit den früheren "Freiwilligen Fortbildungsseminaren für Fahranfänger", um erstere von letzteren anhand von fünf Kriterien abzugrenzen.
In Teil III des Berichts werden die Ergebnisse der Projektgruppenarbeit zu Aufgabe B berichtet. Aus derzeitiger Sicht grundsätzlich realisierbar erscheint die dauerhafte Implementierung und Finanzierung einer Fachkommission "Fahranfängervorbereitung" aus Bundesmitteln.
Aktualisiert: 2023-01-16
Autor:
Martina Albrecht,
Michael Bähr,
Renate Bartelt-Lehrfeld,
Martin Bodenschatz,
Bianca Bredow,
Gerhard von Bressensdorf,
Roland Brünken,
Ingo Burchardt,
Pascal Busch,
Petra Butterwege,
Ulrich Chiellino,
Rolf Dautel-Haußmann,
Michael Fuchs,
Walter Funk,
Heidi Gattenthaler,
Tina Gehlert,
Judith Grothe,
Birgit Hauser,
Dieter Kettenbach,
Matthias Knobloch,
Ingo Kossmann,
Peter Lehnert,
Detlev Leutner,
Hendrik Pistor,
Thomas Rensch,
Mathias Rüdel,
Jürgen-Michael Satz,
Daniel Schüle,
Kay Schulte,
Anton Stecher,
Dietmar Sturzbecher,
Ralf Vennefrohne,
Mark Vollfrath,
Georg Willmes-Lenz,
Rainer Zeitwanger

F 131: Fahrerassistenz- und Fahrerinformationssysteme (FAS/FIS) – Personale Voraussetzungen ihres Erwerbs und Nutzung durch ältere Kraftfahrerinnen und -fahrer
Volker Hargutt, Ramona Kenntner-Mabiala, Yvonne Kaussner, Alexandra Neukum
103 Seiten (4,5 MB), 23 Abb., 11 Tab., ISBN 978-3-95606-489-0, 2019
In den nächsten Jahren ist mit einer steigenden Anzahl autofahrender Senioreninnen und Senioren im Straßenverkehr zu rechnen. Mit zunehmendem Alter gehen jedoch zahlreiche fahrrelevante Leistungsveränderungen und Einschränkungen einher. Ein relativ neuartiger Ansatz zur Kompensation altersbedingter Einschränkungen und zur Senkung des Unfallrisikos ist der gezielte Einsatz von Fahrerassistenz- und -informationssystemen (FAS/FIS). Im Rahmen dieses Projekts werden die personalen Voraussetzungen älterer Autofahrer für Erwerb und Nutzung derartiger Systeme untersucht.
In einer Literaturanalyse werden Möglichkeiten zur Erhöhung der Verkehrssicherheit durch den Einsatz von FAS/FIS dargestellt. Basierend auf einem Überblick über Akzeptanzuntersuchungen von FAS/FIS werden Faktoren herausgearbeitet, die speziell für Senioren von hoher Bedeutung sind.
Im empirischen Teil des Projekts werden über zwei verschiedene methodische Zugänge Informationen über die personalen Voraussetzungen des Erwerbs und der Nutzung von FAS/FIS durch ältere Autorfahrer gesammelt. Zum einen über Einzelinterviews von Autohändlern, die in Kontakt mit älteren Kunden stehen, zum anderen über Fokusgruppendiskussionen direkt mit der Zielgruppe.
Die Autohausbefragungen zeigen, dass der Verkaufsberater eine entscheidende Rolle bei der Information älterer Fahrer spielt. Das Thema „Fahrerassistenzsystem“ wird selten von den Kunden selbst angesprochen, sondern muss vom Kundenberater gezielt adressiert werden. Während jüngere Kunden sich Fahrerassistenzsysteme oft aus Komfort- und Prestigegründen kaufen, ist bei älteren Kunden der Sicherheitsaspekt das bedeutendste Argument für den Kauf eines Systems. Sehr große Bedeutung messen die interviewten Verkaufsberater Probefahrten zu: Sie können Ängste und Bedenken nehmen und teilweise auch Skeptiker überzeugen. Als Kauf- und Nutzungsbarrieren nannten die Berater Zweifel hinsichtlich der Zuverlässigkeit des Systems und die relativ hohen Kosten für FAS/FIS.
Anliegen der Fokusgruppendiskussionen ist es, Vertreter der Zielgruppe „ältere Autofahrer“ direkt zu befragen. Der Großteil der Fokusgruppenteilnehmer hat sich bis zum Workshop mit dem Thema FAS/FIS noch sehr wenig auseinandergesetzt und entsprechend auch nur sehr wenig Vorwissen zum Thema aufgebaut. Interessanterweise lässt sich aber bei sehr vielen Teilnehmern bereits durch eine sehr knappe Information zur Funktionsweise einzelner Systeme zumindest eine Nutzungs- bei manchen sogar eine Kaufintention erzeugen.
Basierend auf den Erkenntnissen der Literaturanalyse, der Autohausbefragungen und der Fokusgruppendiskussionen wird ein Arbeitsmodell zum Einfluss personaler Faktoren auf die Nutzungsintention älterer Autofahrer von FAS/FIS entworfen. Dieses Arbeitsmodell soll OEMs, Verbände usw. darin unterstützen, konkrete Maßnahmen zu einer weiteren Verbreitung von FAS/FIS unter älteren Fahrern abzuleiten. Zur Quantifizierung einzelner Einflussfaktoren wurde ein Fragebogen entwickelt, den mittels einer Online-Umfrage 585 Personen beantworteten. Mittels logistischer Regression werden die im Arbeitsmodell spezifizierten Prädiktoren daraufhin überprüft, ob sie einen relevanten Einfluss auf die Nutzungsintention verschiedener FAS/FIS haben.
Die Ergebnisse zeigen, dass ein einziges Modell zur Vorhersage einer Nutzung von FAS/FIS im Allgemeinen fehlschlagen muss. Jedes FAS/FIS weist gewisse Merkmale auf, die es von anderen FAS/FIS unterscheidet und die offensichtlich auch einen Unterschied hinsichtlich einer Nutzungsintention machen. So werden an ein sehr selten agierendes Notsystem andere Kriterien angelegt, als an ein System, das kontinuierlich in das Fahrgeschehen eingreift.
Bereits heute sind einige Voraussetzungen gegeben, die eine weitere Verbreitung von FAS/FIS unabhängig vom Geschlecht und Alter potenzieller Nutzer in den nächsten Jahren sehr wahrscheinlich machen. Beschleunigen lässt sich dieser Prozess durch weitere gezielte Informationsverbreitung hinsichtlich der Möglichkeiten, bestimmte physische/kognitive Einschränkungen (die nicht unbedingt nur eine bestimmte Altersgruppe betreffen) mit Hilfe vom FAS/FIS zu kompensieren. Über eine Analyse des Mobilitätsverhaltens und potenzieller Einschränkungen sollten potenziellen Neuwagenkäufern FAS/FIS gezielt und bedarfsgerecht angeboten werden. Zentrale Bedenken hinsichtlich FAS/FIS hatten viele Befragte in Bezug auf zu erwartende Folgekosten sowie zu Fragen der Datensicherheit. Hier ist eine transparente Informationspolitik hilfreich, die den Kunden Sicherheit bezüglich zu erwartender Folgekosten und der Datensicherheit vermittelt.
Aktualisiert: 2020-01-17
> findR *
Aktualisiert: 2023-04-01
> findR *

Die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) ist eine sehr häufige psychiatrische Störung im Kindesalter, die derzeit primär neurobiologisch und genetisch erklärt wird. Der Autor liefert einerseits einen umfassenden Überblick zu Geschichte, Definition und Diagnose, Ätiologie, Begleitstörungen und Modellen, andererseits geht er erstmals der Frage nach, ob diese Erkrankung auch auf Basis systemischer und evolutionärer Hypothesen differenzierter analysiert und erklärt werden kann. Insbesondere geht er der Frage nach, ob innerhalb des breiten Spektrums von ADHS ein bestimmter Subtyp ein erhöhtes Unfallrisiko aufweist. Neben den empirischen Ergebnissen können aus dieser Arbeit auch klinisch-sozialpädagogische Konsequenzen gezogen werden. Durch ein maßgeschneidertes Bündeln von fördernden und fordernden Komponenten – im Sinne eines ganzheitlichen Behandlungskonzepts – wird zukünftig der Sozialpädagogik besonders in der Risikoprävention eine größere Bedeutung zukommen.
Aktualisiert: 2023-01-31
> findR *
In Deutschland konsumieren ca. 3 Millionen Menschen gelegentlich oder regelmäßig Cannabisprodukte. Nach bisheriger Gesetzeslage und Rechtspraxis droht diesen 3 Millionen der Entzug des Führerscheins, selbst wenn sie nie unter dem Einfluss von Cannabis ein Fahrzeug führten. Mit Beschluss vom 8.7.2002 erklärte das Bundesverfassungsgericht diese Praxis für verfassungswidrig: Die Kammer geht davon aus, dass der einmalige oder nur gelegentliche Cannabiskonsum ohne Bezug zum Straßenverkehr für sich allein kein hinreichendes Verdachtselement bildet. Die Autoren des Buches, Wissenschaftler, Juristen und Politologen zeigen detailliert auf, welche Gefahr von Cannabiskonsumenten im Straßenverkehr und am Arbeitsplatz tatsächlich ausgeht und wie Regelungen aussehen müssten, um einen Schutz von cannabisinduzierten Schäden zu gewährleisten, ohne die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen in unnötiger Weise einzuschränken.
Aktualisiert: 2023-03-14
> findR *
Ältere Verkehrsteilnehmer – Gefährdet oder gefährlich?
Aktualisiert: 2019-04-23
> findR *
Richtig reagieren bei Notfällen mit Kindern und Jugendlichen
Aktualisiert: 2019-04-18
> findR *
Richtig reagieren bei Notfällen mit Kindern und Jugendlichen
Aktualisiert: 2019-04-18
> findR *
MEHR ANZEIGEN
Bücher zum Thema Unfallrisiko
Sie suchen ein Buch über Unfallrisiko? Bei Buch findr finden Sie eine große Auswahl Bücher zum
Thema Unfallrisiko. Entdecken Sie neue Bücher oder Klassiker für Sie selbst oder zum Verschenken. Buch findr
hat zahlreiche Bücher zum Thema Unfallrisiko im Sortiment. Nehmen Sie sich Zeit zum Stöbern und finden Sie das
passende Buch für Ihr Lesevergnügen. Stöbern Sie durch unser Angebot und finden Sie aus unserer großen Auswahl das
Buch, das Ihnen zusagt. Bei Buch findr finden Sie Romane, Ratgeber, wissenschaftliche und populärwissenschaftliche
Bücher uvm. Bestellen Sie Ihr Buch zum Thema Unfallrisiko einfach online und lassen Sie es sich bequem nach
Hause schicken. Wir wünschen Ihnen schöne und entspannte Lesemomente mit Ihrem Buch.
Unfallrisiko - Große Auswahl Bücher bei Buch findr
Bei uns finden Sie Bücher beliebter Autoren, Neuerscheinungen, Bestseller genauso wie alte Schätze. Bücher zum
Thema Unfallrisiko, die Ihre Fantasie anregen und Bücher, die Sie weiterbilden und Ihnen wissenschaftliche
Fakten vermitteln. Ganz nach Ihrem Geschmack ist das passende Buch für Sie dabei. Finden Sie eine große Auswahl
Bücher verschiedenster Genres, Verlage, Autoren bei Buchfindr:
Sie haben viele Möglichkeiten bei Buch findr die passenden Bücher für Ihr Lesevergnügen zu entdecken. Nutzen Sie
unsere Suchfunktionen, um zu stöbern und für Sie interessante Bücher in den unterschiedlichen Genres und Kategorien
zu finden. Unter Unfallrisiko und weitere Themen und Kategorien finden Sie schnell und einfach eine Auflistung
thematisch passender Bücher. Probieren Sie es aus, legen Sie jetzt los! Ihrem Lesevergnügen steht nichts im Wege.
Nutzen Sie die Vorteile Ihre Bücher online zu kaufen und bekommen Sie die bestellten Bücher schnell und bequem
zugestellt. Nehmen Sie sich die Zeit, online die Bücher Ihrer Wahl anzulesen, Buchempfehlungen und Rezensionen zu
studieren, Informationen zu Autoren zu lesen. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen das Team von Buchfindr.