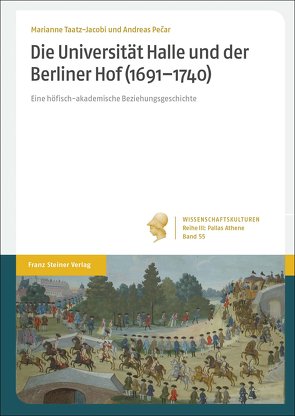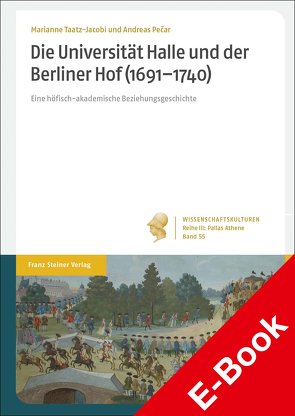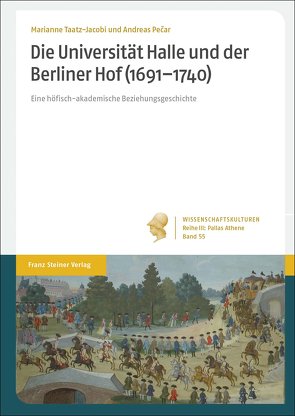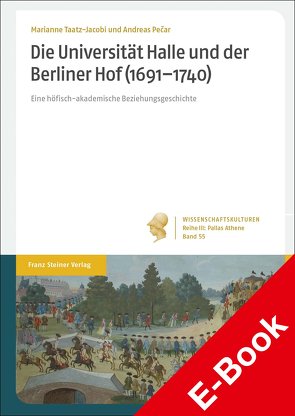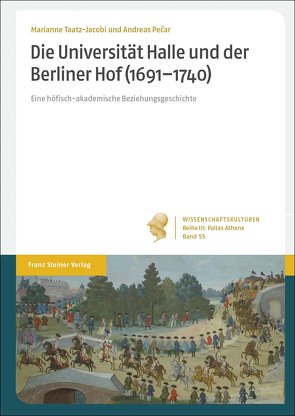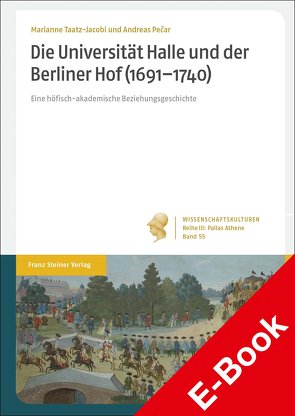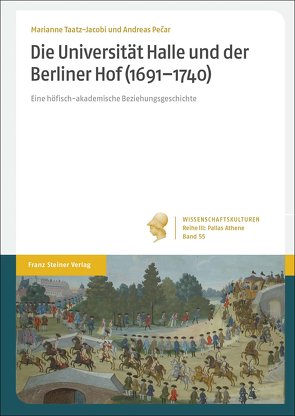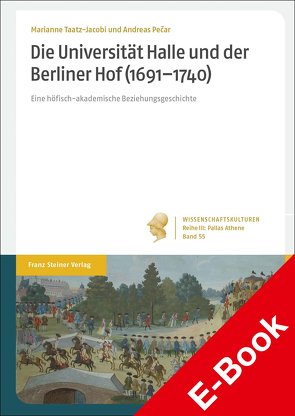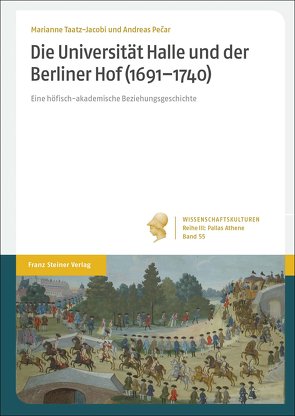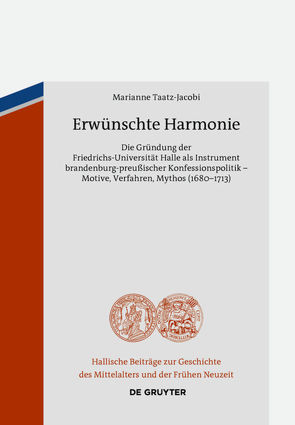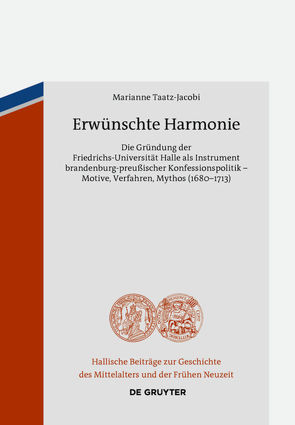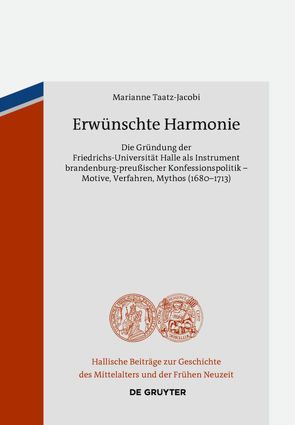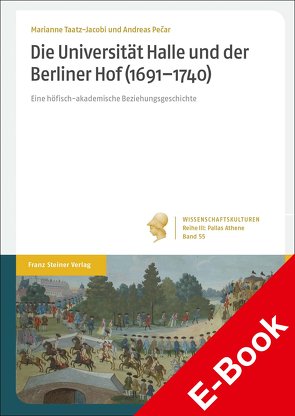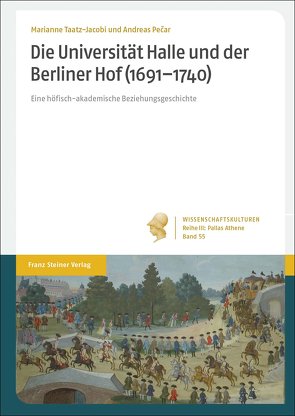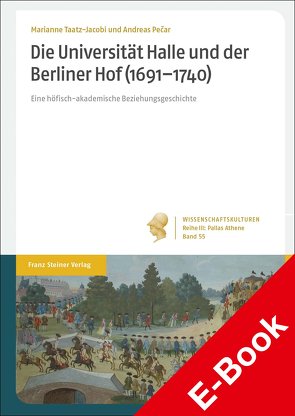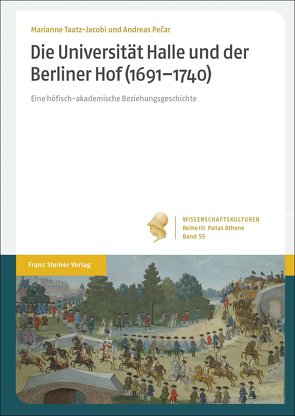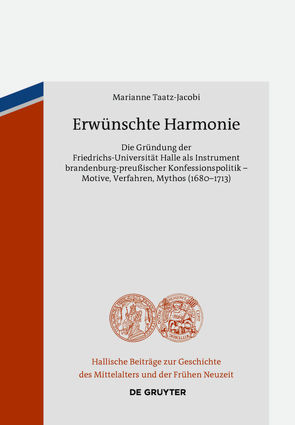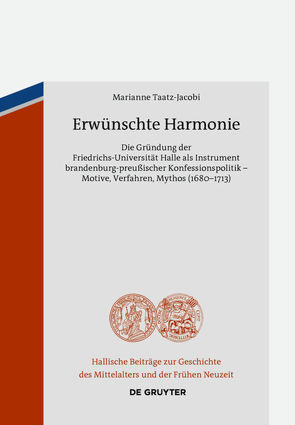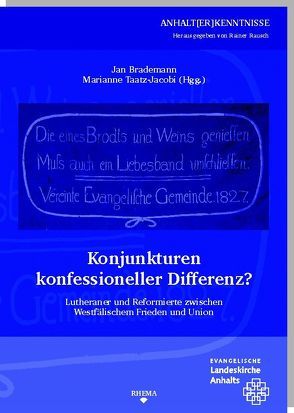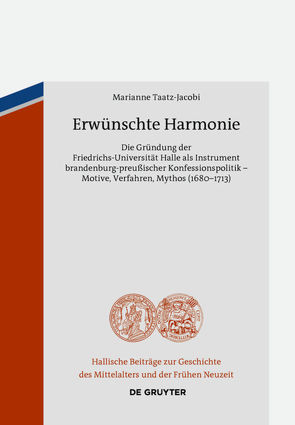Aktualisiert: 2023-06-15
> findR *
Aktualisiert: 2023-06-15
> findR *
Aktualisiert: 2023-06-14
> findR *
Aktualisiert: 2023-06-07
> findR *
Aktualisiert: 2023-06-07
> findR *
Aktualisiert: 2023-06-01
> findR *
Aktualisiert: 2023-06-01
> findR *
Aktualisiert: 2023-06-01
> findR *
Aktualisiert: 2023-06-01
> findR *
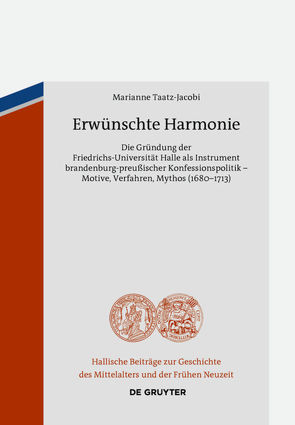
Lange Zeit wurde die Fridericiana in Halle in ihren Anfängen als Reformuniversität des Pietismus und der Aufklärung verstanden. Bei gründlicher Untersuchung der Quellen zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Der Universitätsgründung lag kein auf Pietismus und Aufklärung zielendes, von kurfürstlicher Seite durchgeplantes, reformpolitisches Programm zugrunde. Vielmehr entsprach sie der Logik eines seit 1613 entwickelten konfessionspolitischen Handlungskatalogs, der auf die Selbst-Reformation der mehrheitlich lutherischen Untertanen und die Förderung der Reformierten setzte. In Halle wurde diese Politik seit der Eingliederung des Herzogtums Magdeburg in den hohenzollernschen Territorialverbund 1680 etabliert und mit der Universitätsgründung noch einmal forciert. Die Herstellung einer innerlutherischen Vielfalt an der Fridericiana durch eine vermeintlich innovative, auf Pietisten und Frühaufklärer ausgerichtete Personalstrategie war dabei nur ein Umweg zum Erreichen des konfessionspolitischen Ziels. Damit wird sowohl mit dem Mythos der Reformuniversität Halle als auch mit dem Mythos der preußischen Toleranz aufgeräumt. Vielmehr überlagerten sich an der Universität und in der Stadt Halle Ende des 17. Jahrhunderts grundlegende Konflikte um Rechtgläubigkeit und konfessionelle Identitätsstiftung im Luthertum in exemplarischer Weise. Die Analyse der Auseinandersetzungen zwischen Universitätsprofessoren, hallischer Stadtgeistlichkeit und Berliner Zentralregierung führt zu innovativen Erklärungen für die Entstehung des Halleschen Pietismus und sein Verhältnis zur lutherischen Orthodoxie und zur Aufklärung im Rahmen lutherischer Konfessionskultur.
Aktualisiert: 2023-05-29
> findR *
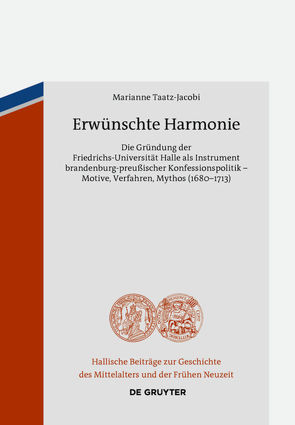
Lange Zeit wurde die Fridericiana in Halle in ihren Anfängen als Reformuniversität des Pietismus und der Aufklärung verstanden. Bei gründlicher Untersuchung der Quellen zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Der Universitätsgründung lag kein auf Pietismus und Aufklärung zielendes, von kurfürstlicher Seite durchgeplantes, reformpolitisches Programm zugrunde. Vielmehr entsprach sie der Logik eines seit 1613 entwickelten konfessionspolitischen Handlungskatalogs, der auf die Selbst-Reformation der mehrheitlich lutherischen Untertanen und die Förderung der Reformierten setzte. In Halle wurde diese Politik seit der Eingliederung des Herzogtums Magdeburg in den hohenzollernschen Territorialverbund 1680 etabliert und mit der Universitätsgründung noch einmal forciert. Die Herstellung einer innerlutherischen Vielfalt an der Fridericiana durch eine vermeintlich innovative, auf Pietisten und Frühaufklärer ausgerichtete Personalstrategie war dabei nur ein Umweg zum Erreichen des konfessionspolitischen Ziels. Damit wird sowohl mit dem Mythos der Reformuniversität Halle als auch mit dem Mythos der preußischen Toleranz aufgeräumt. Vielmehr überlagerten sich an der Universität und in der Stadt Halle Ende des 17. Jahrhunderts grundlegende Konflikte um Rechtgläubigkeit und konfessionelle Identitätsstiftung im Luthertum in exemplarischer Weise. Die Analyse der Auseinandersetzungen zwischen Universitätsprofessoren, hallischer Stadtgeistlichkeit und Berliner Zentralregierung führt zu innovativen Erklärungen für die Entstehung des Halleschen Pietismus und sein Verhältnis zur lutherischen Orthodoxie und zur Aufklärung im Rahmen lutherischer Konfessionskultur.
Aktualisiert: 2023-05-29
> findR *
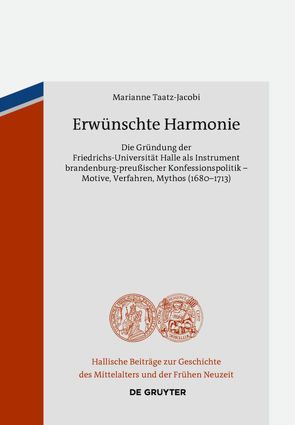
Lange Zeit wurde die Fridericiana in Halle in ihren Anfängen als Reformuniversität des Pietismus und der Aufklärung verstanden. Bei gründlicher Untersuchung der Quellen zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Der Universitätsgründung lag kein auf Pietismus und Aufklärung zielendes, von kurfürstlicher Seite durchgeplantes, reformpolitisches Programm zugrunde. Vielmehr entsprach sie der Logik eines seit 1613 entwickelten konfessionspolitischen Handlungskatalogs, der auf die Selbst-Reformation der mehrheitlich lutherischen Untertanen und die Förderung der Reformierten setzte. In Halle wurde diese Politik seit der Eingliederung des Herzogtums Magdeburg in den hohenzollernschen Territorialverbund 1680 etabliert und mit der Universitätsgründung noch einmal forciert. Die Herstellung einer innerlutherischen Vielfalt an der Fridericiana durch eine vermeintlich innovative, auf Pietisten und Frühaufklärer ausgerichtete Personalstrategie war dabei nur ein Umweg zum Erreichen des konfessionspolitischen Ziels. Damit wird sowohl mit dem Mythos der Reformuniversität Halle als auch mit dem Mythos der preußischen Toleranz aufgeräumt. Vielmehr überlagerten sich an der Universität und in der Stadt Halle Ende des 17. Jahrhunderts grundlegende Konflikte um Rechtgläubigkeit und konfessionelle Identitätsstiftung im Luthertum in exemplarischer Weise. Die Analyse der Auseinandersetzungen zwischen Universitätsprofessoren, hallischer Stadtgeistlichkeit und Berliner Zentralregierung führt zu innovativen Erklärungen für die Entstehung des Halleschen Pietismus und sein Verhältnis zur lutherischen Orthodoxie und zur Aufklärung im Rahmen lutherischer Konfessionskultur.
Aktualisiert: 2023-05-29
> findR *
Aktualisiert: 2023-05-13
> findR *
Aktualisiert: 2023-05-13
> findR *
Aktualisiert: 2023-03-29
> findR *
Aktualisiert: 2023-03-14
> findR *
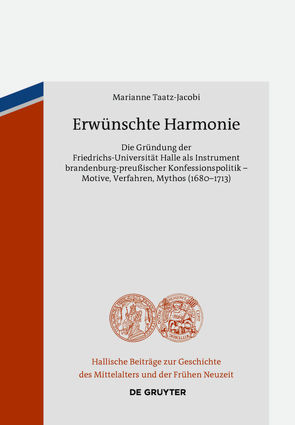
Lange Zeit wurde die Fridericiana in Halle in ihren Anfängen als Reformuniversität des Pietismus und der Aufklärung verstanden. Bei gründlicher Untersuchung der Quellen zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Der Universitätsgründung lag kein auf Pietismus und Aufklärung zielendes, von kurfürstlicher Seite durchgeplantes, reformpolitisches Programm zugrunde. Vielmehr entsprach sie der Logik eines seit 1613 entwickelten konfessionspolitischen Handlungskatalogs, der auf die Selbst-Reformation der mehrheitlich lutherischen Untertanen und die Förderung der Reformierten setzte. In Halle wurde diese Politik seit der Eingliederung des Herzogtums Magdeburg in den hohenzollernschen Territorialverbund 1680 etabliert und mit der Universitätsgründung noch einmal forciert. Die Herstellung einer innerlutherischen Vielfalt an der Fridericiana durch eine vermeintlich innovative, auf Pietisten und Frühaufklärer ausgerichtete Personalstrategie war dabei nur ein Umweg zum Erreichen des konfessionspolitischen Ziels. Damit wird sowohl mit dem Mythos der Reformuniversität Halle als auch mit dem Mythos der preußischen Toleranz aufgeräumt. Vielmehr überlagerten sich an der Universität und in der Stadt Halle Ende des 17. Jahrhunderts grundlegende Konflikte um Rechtgläubigkeit und konfessionelle Identitätsstiftung im Luthertum in exemplarischer Weise. Die Analyse der Auseinandersetzungen zwischen Universitätsprofessoren, hallischer Stadtgeistlichkeit und Berliner Zentralregierung führt zu innovativen Erklärungen für die Entstehung des Halleschen Pietismus und sein Verhältnis zur lutherischen Orthodoxie und zur Aufklärung im Rahmen lutherischer Konfessionskultur.
Aktualisiert: 2023-03-27
> findR *
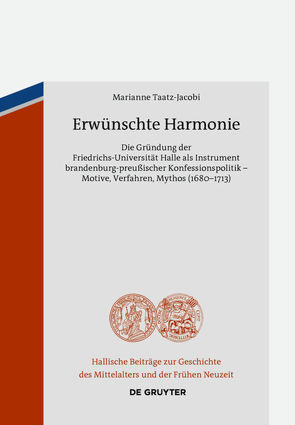
Lange Zeit wurde die Fridericiana in Halle in ihren Anfängen als Reformuniversität des Pietismus und der Aufklärung verstanden. Bei gründlicher Untersuchung der Quellen zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Der Universitätsgründung lag kein auf Pietismus und Aufklärung zielendes, von kurfürstlicher Seite durchgeplantes, reformpolitisches Programm zugrunde. Vielmehr entsprach sie der Logik eines seit 1613 entwickelten konfessionspolitischen Handlungskatalogs, der auf die Selbst-Reformation der mehrheitlich lutherischen Untertanen und die Förderung der Reformierten setzte. In Halle wurde diese Politik seit der Eingliederung des Herzogtums Magdeburg in den hohenzollernschen Territorialverbund 1680 etabliert und mit der Universitätsgründung noch einmal forciert. Die Herstellung einer innerlutherischen Vielfalt an der Fridericiana durch eine vermeintlich innovative, auf Pietisten und Frühaufklärer ausgerichtete Personalstrategie war dabei nur ein Umweg zum Erreichen des konfessionspolitischen Ziels. Damit wird sowohl mit dem Mythos der Reformuniversität Halle als auch mit dem Mythos der preußischen Toleranz aufgeräumt. Vielmehr überlagerten sich an der Universität und in der Stadt Halle Ende des 17. Jahrhunderts grundlegende Konflikte um Rechtgläubigkeit und konfessionelle Identitätsstiftung im Luthertum in exemplarischer Weise. Die Analyse der Auseinandersetzungen zwischen Universitätsprofessoren, hallischer Stadtgeistlichkeit und Berliner Zentralregierung führt zu innovativen Erklärungen für die Entstehung des Halleschen Pietismus und sein Verhältnis zur lutherischen Orthodoxie und zur Aufklärung im Rahmen lutherischer Konfessionskultur.
Aktualisiert: 2023-03-27
> findR *
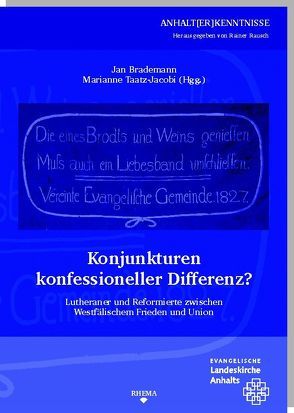
Im Jahr 2017 jährte sich nicht nur die Thesenveröffentlichung Luthers zum 500., sondern auch der Aufruf König Friedrich Wilhelms III. von Preußen zu gemeinsamen Abendmahlsfeiern von Lutheranern und Reformierten zum 200. Mal. Dies bot den Anlass, das Verhältnis dieser beiden protestantischen Großkonfessionen genauer zu untersuchen.
Im Mittelpunkt der im vorliegenden Buch versammelten Beiträge stehen Fallbeispiele aus Regionen, in denen beide Gruppen auf engem Raum miteinander interagierten. Die Vorstellung, seit dem Westfälischen Frieden sei das Verhältnis der beiden vormals verfeindeten Konfessionen auf eine gesamtprotestantische Identität hinausgelaufen, erweist sich dabei als falsch: Trotz ihrer dogmatischen Nähe und zahlreicher gemeinsamer Symbole und Rituale (v.a. Liturgien) kam es auch nach 1648 immer wieder zu – durchaus konflikthaften – Schwankungen der Präsenz und der wechselseitigen Wahrnehmung beider Gruppen.
Solche Konjunkturen konfessioneller Differenz lassen sich nicht einfach auf religiöse oder theologische Problemlagen zurückführen, sondern wurden durch unterschiedliche gesellschaftliche Bedingungen und Einflussfaktoren gefördert und geprägt. Ihnen wird über die Epochengrenze zur Moderne hinaus nachgespürt, nicht zuletzt, weil die 1817 angestoßenen Bemühungen zu einer Union vielfach weitere solcher Konjunkturen bedingten.
****************************
Inhaltsverzeichnis:
Geleitwort des Reihenherausgebers
Vorwort
Jan Brademann und Marianne Taatz-Jacobi:
Einleitung
1. KONFESSION ALS KONZEPT: THEORETISCHE SONDIERUNGEN
Georg Raatz:
Was ist Konfession? Religions-, system- und kulturtheoretische Annäherungen an eine ambivalente Kategorie
Anna Daniel und Franka Schäfer:
Konfession im Vollzug. Eine am Begriff der Praxis orientierte kultursoziologische Betrachtung
2. FALLSTUDIEN AUS DEM ALTEN REICH
Alexander Schunka:
Das Theatrum des Kirchenkriegs. Konfessionelle Pluralität im deutschen Protestantismus um 1700 – Befunde und Perspektiven
Mathis Leibetseder:
Sakraltopographie und Simultaneum. Zur Reproduktion konfessioneller Differenz in drei brandenburgischen Landstädten des 18. Jahrhunderts
Andreas Erb:
Zwei Konfessionen, vier Parteien. Pfarrstreitigkeiten in Hecklingen (Anhalt) im Spannungsfeld von Landesherr, Gutsherr, Pfarrer und Untertanen (17./18. Jahrhundert)
Stefan Gorißen:
Konfessionelle Identitäten? Lutheraner und Reformierte im Herzogtum Berg im 17. und 18. Jahrhundert
3. FALLSTUDIEN AUS DEM 19. JAHRHUNDERT
Veronika Albrecht-Birkner:
Die Einführung der Union und die frühe Erweckungsbewegung im Siegerland
Lena Krull:
Reformierte, Lutheraner und die Frage der Union in Lippe (1817 bis ca. 1850)
Hans Seehase:
Evangelische Union ohne eigenes Bekenntnis. Verschlungene Pfade der Kirche zwischen Union und Agende in der Provinz Sachsen zwischen 1817 und 1846
Claudia Drese:
Transkonfessionalität oder politischer Opportunismus? Die »Reconstruction des Protestantismus« in Anhalt-Bernburg
Niels Grüne:
Von protestantischer Dualität zu innerkonfessioneller Alterität. Reformierte, Lutheraner und der diskursive Einschnitt der Kirchenunion in südwestdeutschen Dörfern der Sattelzeit
Die Autorinnen und Autoren
Aktualisiert: 2020-06-25
Autor:
Veronika Albrecht-Birkner,
Jan Brademann,
Anna Daniel,
Claudia Drese,
Andreas Erb,
Stefan Gorißen,
Niels Grüne,
Lena Krull,
Mathis Leibetseder,
Georg Raatz,
Rainer Rausch,
Franka Schäfer,
Alexander Schunka,
Hans Seehase,
Marianne Taatz-Jacobi
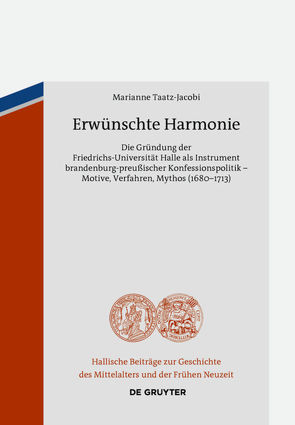
Lange Zeit wurde die Fridericiana in Halle in ihren Anfängen als Reformuniversität des Pietismus und der Aufklärung verstanden. Bei gründlicher Untersuchung der Quellen zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Der Universitätsgründung lag kein auf Pietismus und Aufklärung zielendes, von kurfürstlicher Seite durchgeplantes, reformpolitisches Programm zugrunde. Vielmehr entsprach sie der Logik eines seit 1613 entwickelten konfessionspolitischen Handlungskatalogs, der auf die Selbst-Reformation der mehrheitlich lutherischen Untertanen und die Förderung der Reformierten setzte. In Halle wurde diese Politik seit der Eingliederung des Herzogtums Magdeburg in den hohenzollernschen Territorialverbund 1680 etabliert und mit der Universitätsgründung noch einmal forciert. Die Herstellung einer innerlutherischen Vielfalt an der Fridericiana durch eine vermeintlich innovative, auf Pietisten und Frühaufklärer ausgerichtete Personalstrategie war dabei nur ein Umweg zum Erreichen des konfessionspolitischen Ziels. Damit wird sowohl mit dem Mythos der Reformuniversität Halle als auch mit dem Mythos der preußischen Toleranz aufgeräumt. Vielmehr überlagerten sich an der Universität und in der Stadt Halle Ende des 17. Jahrhunderts grundlegende Konflikte um Rechtgläubigkeit und konfessionelle Identitätsstiftung im Luthertum in exemplarischer Weise. Die Analyse der Auseinandersetzungen zwischen Universitätsprofessoren, hallischer Stadtgeistlichkeit und Berliner Zentralregierung führt zu innovativen Erklärungen für die Entstehung des Halleschen Pietismus und sein Verhältnis zur lutherischen Orthodoxie und zur Aufklärung im Rahmen lutherischer Konfessionskultur.
Aktualisiert: 2023-03-27
> findR *
MEHR ANZEIGEN
Bücher von Taatz-Jacobi, Marianne
Sie suchen ein Buch oder Publikation vonTaatz-Jacobi, Marianne ? Bei Buch findr finden Sie alle Bücher Taatz-Jacobi, Marianne.
Entdecken Sie neue Bücher oder Klassiker für Sie selbst oder zum Verschenken. Buch findr hat zahlreiche Bücher
von Taatz-Jacobi, Marianne im Sortiment. Nehmen Sie sich Zeit zum Stöbern und finden Sie das passende Buch oder die
Publiketion für Ihr Lesevergnügen oder Ihr Interessensgebiet. Stöbern Sie durch unser Angebot und finden Sie aus
unserer großen Auswahl das Buch, das Ihnen zusagt. Bei Buch findr finden Sie Romane, Ratgeber, wissenschaftliche und
populärwissenschaftliche Bücher uvm. Bestellen Sie Ihr Buch zu Ihrem Thema einfach online und lassen Sie es sich
bequem nach Hause schicken. Wir wünschen Ihnen schöne und entspannte Lesemomente mit Ihrem Buch
von Taatz-Jacobi, Marianne .
Taatz-Jacobi, Marianne - Große Auswahl an Publikationen bei Buch findr
Bei uns finden Sie Bücher aller beliebter Autoren, Neuerscheinungen, Bestseller genauso wie alte Schätze. Bücher
von Taatz-Jacobi, Marianne die Ihre Fantasie anregen und Bücher, die Sie weiterbilden und Ihnen wissenschaftliche Fakten
vermitteln. Ganz nach Ihrem Geschmack ist das passende Buch für Sie dabei. Finden Sie eine große Auswahl Bücher
verschiedenster Genres, Verlage, Schlagworte Genre bei Buchfindr:
Unser Repertoire umfasst Bücher von
Sie haben viele Möglichkeiten bei Buch findr die passenden Bücher für Ihr Lesevergnügen zu entdecken. Nutzen Sie
unsere Suchfunktionen, um zu stöbern und für Sie interessante Bücher in den unterschiedlichen Genres und Kategorien
zu finden. Neben Büchern von Taatz-Jacobi, Marianne und Büchern aus verschiedenen Kategorien finden Sie schnell und
einfach auch eine Auflistung thematisch passender Publikationen. Probieren Sie es aus, legen Sie jetzt los! Ihrem
Lesevergnügen steht nichts im Wege. Nutzen Sie die Vorteile Ihre Bücher online zu kaufen und bekommen Sie die
bestellten Bücher schnell und bequem zugestellt. Nehmen Sie sich die Zeit, online die Bücher Ihrer Wahl anzulesen,
Buchempfehlungen und Rezensionen zu studieren, Informationen zu Autoren zu lesen. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
das Team von Buchfindr.