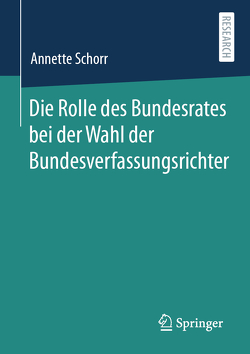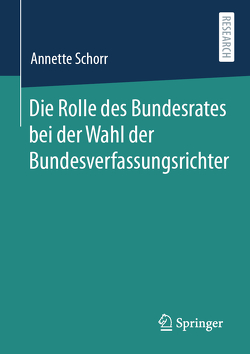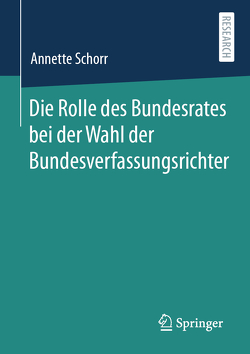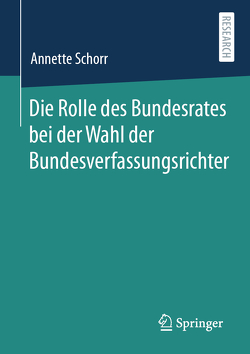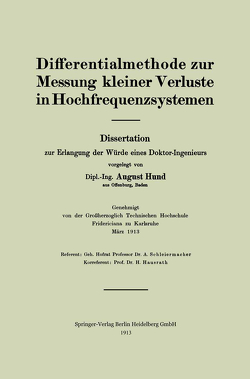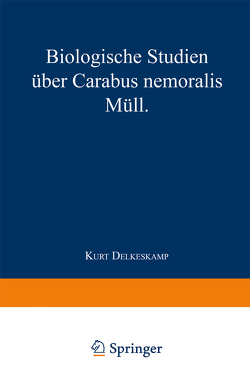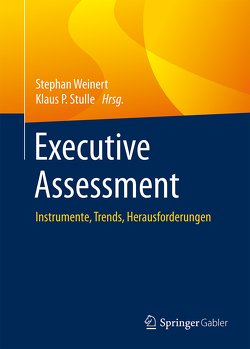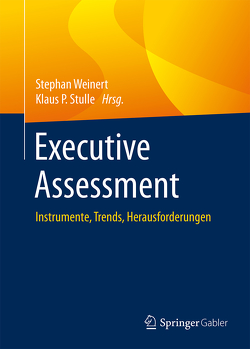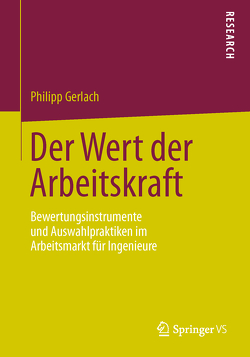Berufungsverfahren als Bestenauslese?
Eine rechtliche und empirische Analyse der Auswahlpraxis in Berufungsverfahren
Mirja Otten
Berufungsverfahren gehören zu den in Personalauswahlprozessen selten gewordenen kooptativ geprägten Verfahren. Sie reglementieren den Zugang zu einer akademischen Elite und sind ein zentrales Steuerungselement für die Ausrichtung der Universitäten und Fakultäten. Die Hauptverantwortlichkeit für die Durchführung dieser Auswahlprozesse liegt bei den Fakultäten und Fachbereichen. Dies ist ein Umstand, der Autonomie und Selbstverwaltungsrechte der Fachbereiche betont und verfassungsrechtlichen Freiheiten Ausdruck verleiht. Die Ausgestaltung der Verfahren muss aber auch selbst grundrechtlichen Anforderungen genügen. In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Regularien geschaffen, um die Verfahren transparenter zu gestalten und die Entscheidungsfindung zu objektivieren. Die Vielschichtigkeit der Regelungen und Regelungsebenen hat die Komplexität der Verfahrensdurchführung erheblich erhöht.
Im wissenschaftlichen Diskurs sind Berufungsverfahren bislang nur am Rande berücksichtigt worden. Empirische Untersuchungen hatten als Forschungsgegenstand hauptsächlich Fragestellungen zu Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit im Blick.
Das Ziel dieser Arbeit war es daher, die Anforderungen zu bestimmen, deren Erfüllung gegeben sein muss, um Berufungsverfahren als tatsächlichen Prozesses der Bestenauslese qualifizieren zu können. Dies erfordert neben einer Analyse der rechtlichen Rahmenbedingungen, denen Berufungsverfahren genügen müssen, auch die Einbeziehung der Anforderungen, die aus psychologisch-diagnostischer Sicht Qualitätsmerkmale eines Personalauswahlprozesses ausmachen.
Den Schwerpunkt dieser Arbeit bildet dann die Erhebung und Analyse empirischer Daten, die – rückgekoppelt an die rechtlichen und psychologisch-diagnostischen Anforderungen – Aufschluss über den Stand der Auswahlpraxis geben soll.
Aus dieser Analyse ergibt sich ein heterogenes Bild der Verfahrensgestaltung. Auch wenn nicht von einer Untauglichkeit der bestehenden Auswahlpraxis gesprochen werden kann, bleiben die erfassten Standards noch zu häufig hinter den rechtlichen und diagnostischen Anforderungen an eine umfassende Bestenauslese zurück.
Besonders hervorstechend ist die einseitige Ausrichtung der Verfahren, die in engem Zusammenhang mit einem forschungszentrierten Selbstverständnis der auswählenden Gremien zu stehen scheint. Die Prüfung der Qualifikationen von Bewerbern erfolgt demnach nicht kongruent zu den tatsächlichen Anforderungen und rechtlich definierten Aufgaben der Zielpositionen und basiert zudem auf selektiven, teilweise oberflächlich geprüften Leistungsindikatoren. Dadurch entsteht ein Informationsdefizit bezüglich der Person des Bewerbers, das teilweise auch über informelle Erkundigungen kompensiert wird. Neben diesen informellen Informationen werden die Verfahren auch durch implizite Eignungsvermutungen qua Gruppenzugehörigkeit oder durch sachfremde Erwägungen beeinflusst. Auch wird nicht konsequent ermittelt, inwiefern Beziehungen zwischen Kandidaten und Kommissionsmitgliedern Anlass zur Besorgnis der Befangenheit geben.
Die eingesetzten Kontrollinstanzen scheinen sich nicht durchweg als effektiv zu erweisen, stattdessen ist eine Verlagerung von Entscheidungsmomenten aus dem eigentlichen Verfahren in informelle Strukturen zu beobachten.
Eine Ursache für die schwierige Umsetzbarkeit von Reformen der Verfahren mag auch in dem auf Stabilisierung und Erhalt bestehender Verhältnisse gerichteten Habitus und in der daraus resultierenden Arbeits- und Verfahrenskultur liegen.
Basierend auf der vorliegenden Analyse wurden verschiedene Maßnahmen vorgeschlagen, einigen Schwachstellen des bestehenden Auswahlsystems zu begegnen, die einerseits auf eine Verwirklichung der Bestenauslese abzielen und andererseits durch die Etablierung neuer Routinen auch die bestehende Verfahrenskultur langfristig neu ausrichten könnten.