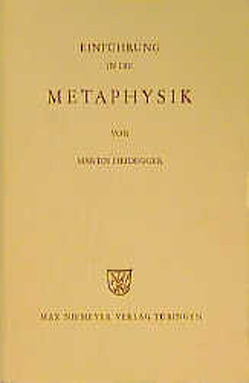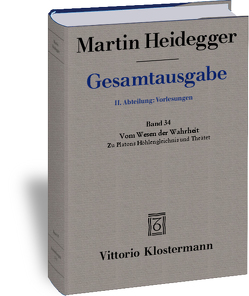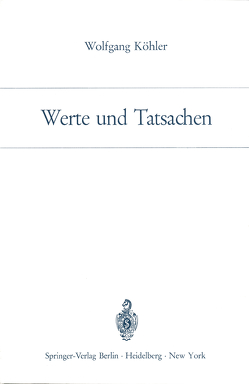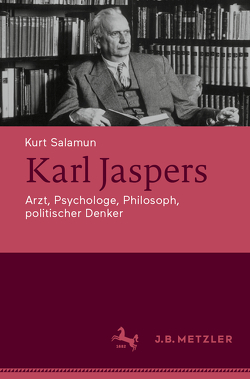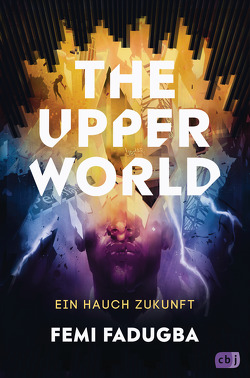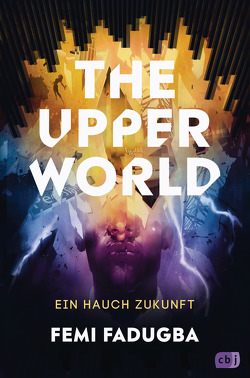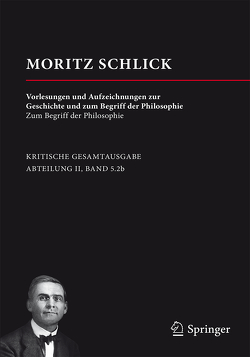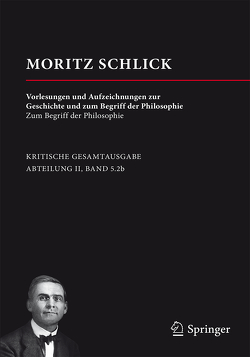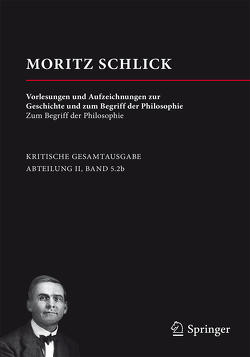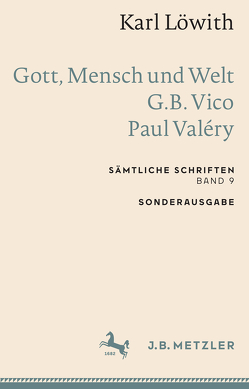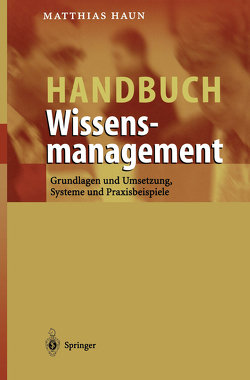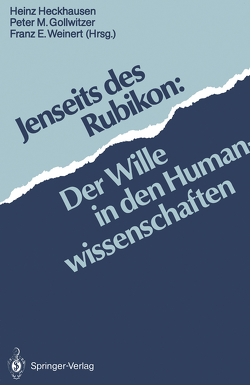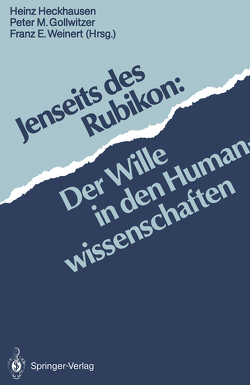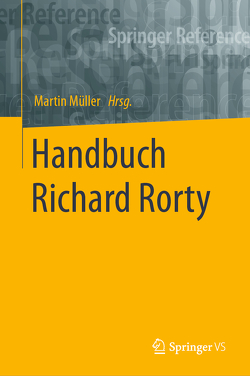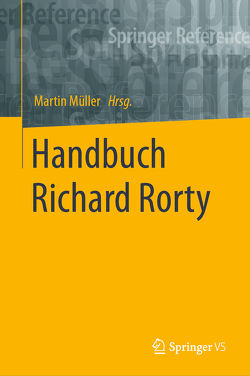Vom Wesen der Wahrheit. Zu Platons Höhlengleichnis und Theätet (Wintersemester 1931/32)
Martin Heidegger, Hermann Mörchen
Die Griechen verstanden das, was wir das Wahre nennen, als das ‚Un-verborgene‘, das der Verborgenheit Entrissene. Später, und bis heute, gilt „Wahrheit“ als bloße Richtigkeit, als Übereinstimmung der Aussage mit der Sache. Diesem verhängnisvollen Bedeutungswandel nachgehend macht Martin Heideggers Vorlesung im Wintersemester 1931/32 Halt „auf einer Zwischenstation“: bei Platon. Wenn wir „uns ganz dem Text überlassen“, werden wir vielleicht „von der Kraft Platonscher Gestaltung betroffen werden, – was ganz und gar nichts Beiläufiges, keine ästhetische Zugabe ist beim Verstehen einer Philosophie“. Sein Höhlengleichnis „gibt uns den entscheidenden Wink in das Wesen der Unverborgenheit“. Die Frage nach ihr ist die „nach der Wesensgeschichte des Menschen“, nach der „Entbergsamkeit“ als dem Grundgeschehnis unserer Ek-sistenz. In welche Gefahrenzone er damit gerät, zeigt sich am Schicksal des Philosophierenden – eines Befreiten unter Gefesselten.
Wahrheit als Unverborgenheit gehört in die griechische Erfahrung von Sein als „Anwesenheit“. Der volle, zeithaft-geschichtliche Sinn von An-wesen meldet sich in Platons „Idee des Guten“, interpretiert als „Ermächtigung dessen, worauf es überhaupt ankommt“. Die Frage nach der Wahrheit bedarf aber, um „Geschichte zu werden für uns“, eines Umwegs. Denn zur Unverborgenheit gehört, „wie das Tal zum Berg“, die Verbergung. Im „Theätet“, einem Gespräch über das Wissen, geht es um das Wesen der Unwahrheit als Verdrehung. Verständlich wird, wie das Problem der Seinsverfehlung überhaupt sich in der philosophischen Tradition verengen konnte zu dem der unrichtigen Aussage.