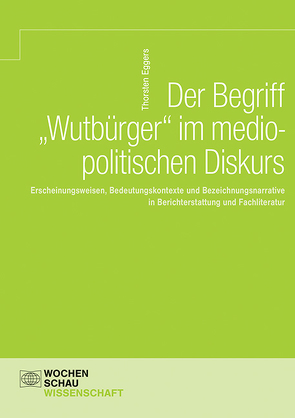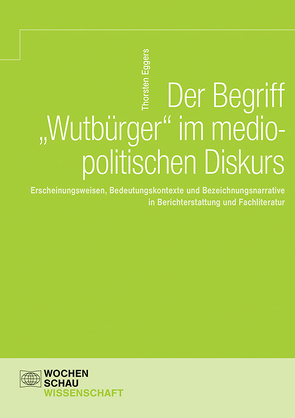In dem Buch von Heinz Stahl und Stephan Friedrich von den Eichen zeigen namhafte Experten aus Wissenschaft, Führungs- und Beratungspraxis, wie Netzwerkstrukturen erfolgreich angewendet werden können. Von den Grundlagen bis hin zur praktischen Umsetzung erfährt der Leser, was bei der Vernetzung zu beachten ist. Das Werk dient damit der erfolgreichen Unternehmensführung.
Aktualisiert: 2023-06-24
Autor:
Reinhard J. Ambros,
Thilo Beck,
Norbert Copray,
Stephan Duschek,
Thorsten Eggers,
Johannes Feldmayer,
Dietmar Fink,
Bettina Fischer,
Jörg Freiling,
Anne Freund,
Stephan A. Friedrich von den Eichen,
Hans Georg Gemünden,
Ulrich Grimm,
Ulrich Hemel,
Hans H. Hinterhuber,
Frank Huber,
Steffen Kinkel,
Bianka Knoblach,
Michael Mirow,
Michael-Jörg Oesterle,
Heike Proff,
Andreas Rasche,
Michael Reiss,
Manfred Remmel,
Birgit Renzl,
Markus Rometsch,
Hans-Gerd Servatius,
Heinz K. Stahl,
Jörg Sydow,
Carsten Vollrath,
Christoph Wamser
In dem Buch von Heinz Stahl und Stephan Friedrich von den Eichen zeigen namhafte Experten aus Wissenschaft, Führungs- und Beratungspraxis, wie Netzwerkstrukturen erfolgreich angewendet werden können. Von den Grundlagen bis hin zur praktischen Umsetzung erfährt der Leser, was bei der Vernetzung zu beachten ist. Das Werk dient damit der erfolgreichen Unternehmensführung.
Aktualisiert: 2023-06-24
Autor:
Reinhard J. Ambros,
Thilo Beck,
Norbert Copray,
Stephan Duschek,
Thorsten Eggers,
Johannes Feldmayer,
Dietmar Fink,
Bettina Fischer,
Jörg Freiling,
Anne Freund,
Stephan A. Friedrich von den Eichen,
Hans Georg Gemünden,
Ulrich Grimm,
Ulrich Hemel,
Hans H. Hinterhuber,
Frank Huber,
Steffen Kinkel,
Bianka Knoblach,
Michael Mirow,
Michael-Jörg Oesterle,
Heike Proff,
Andreas Rasche,
Michael Reiss,
Manfred Remmel,
Birgit Renzl,
Markus Rometsch,
Hans-Gerd Servatius,
Heinz K. Stahl,
Jörg Sydow,
Carsten Vollrath,
Christoph Wamser
In dem Buch von Heinz Stahl und Stephan Friedrich von den Eichen zeigen namhafte Experten aus Wissenschaft, Führungs- und Beratungspraxis, wie Netzwerkstrukturen erfolgreich angewendet werden können. Von den Grundlagen bis hin zur praktischen Umsetzung erfährt der Leser, was bei der Vernetzung zu beachten ist. Das Werk dient damit der erfolgreichen Unternehmensführung.
Aktualisiert: 2023-05-24
Autor:
Reinhard J. Ambros,
Thilo Beck,
Norbert Copray,
Stephan Duschek,
Thorsten Eggers,
Johannes Feldmayer,
Dietmar Fink,
Bettina Fischer,
Jörg Freiling,
Anne Freund,
Stephan A. Friedrich von den Eichen,
Hans Georg Gemünden,
Ulrich Grimm,
Ulrich Hemel,
Hans H. Hinterhuber,
Frank Huber,
Steffen Kinkel,
Bianka Knoblach,
Michael Mirow,
Michael-Jörg Oesterle,
Heike Proff,
Andreas Rasche,
Michael Reiss,
Manfred Remmel,
Birgit Renzl,
Markus Rometsch,
Hans-Gerd Servatius,
Heinz K. Stahl,
Jörg Sydow,
Carsten Vollrath,
Christoph Wamser
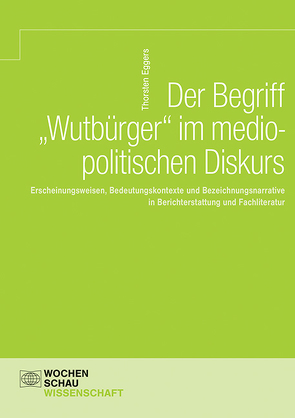
1. Einleitung
2. Diskursanalytische Herangehensweisen als Grundlage für eine Untersuchung von Wissen, Begriffen und Bedeutung
2.1 Erkenntnistheoretischer und methodologischer Zugang: Auf Foucault basierende Diskursdefinitionen und analytische Zugänge
2.1.1 Foucaults Diskurstheorie
Analyse von Diskursen und das damit einhergehende Verständnis von Bedeutung bei Foucault
2.1.2 Die Rezeption der foucaultschen Diskurstheorie nach Laclau/Mouffe
2.1.3 Weitere prägende Rezeptionen und theoretische Weiterentwicklungen foucaultscher Theorie
2.1.4 Kritikpunkte am foucaultschen Werk
2.2 Diskursanalyse als Methodologie: Operationalisierungen der Diskurstheorie
2.2.1 Diskursanalytische Rezeptionen im deutschsprachigen Diskurs
2.2.2 Die Interdiskursanalyse nach Link/Link-Heer
2.2.3 Die Kritische Diskursanalyse nach Jäger
2.3 Konkrete Methodik sowie Material-, Ereignis- und Zeitauswahl der empirischen Forschung
2.3.1 Forschungstheoretische Grundannahmen
2.3.2 Methodische Schritte
2.3.3 Material-, Ereignis- und Zeitauswahl
2.3.4 Leerstellen und offene Perspektiven
3. Empirischer Teil: Rekonstruktion der Bedeutungskontexte und Bezeichnungsnarrative von Wutbürger sowie der damit einhergehenden diskursiven Dynamiken
3.1 Bedingungen der Etablierung des Begriffes Wutbürger in der Berichterstattung über Stuttgart 21
3.1.1 Vor Stuttgart 21: Wutbürger als Wählervereinigung – Die Bürger in Wut aus Bremen
3.1.2 Stuttgart 21 – Geschichte, Hintergrund und Protest
3.1.3 „Der Wutbürger“ – Ein journalistischer Essay als Ausgangspunkt einer ‚neuen‘ politischen Protestfigur
3.2 Bedeutungs- und Diskurskontexte von Wutbürger in der regionalen und überregionalen Berichterstattung im Untersuchungszeitraum „Stuttgart 21“
3.2.1 Quantitative Verhältnisse der Erscheinung und Bedeutung von Wutbürger im Untersuchungszeitraum „Stuttgart 21“
3.2.2 Wutbürger als Bezeichnung in Leser*innenbriefen
3.2.3 Wutbürger in der Berichterstattung über Kunst und Kultur
3.2.4 Wutbürger in der Berichterstattung über Internationales
3.2.5 Wutbürger als journalistische Bezeichnung für Akteur*innen im Fußball
3.2.6 Persönlichkeiten der Zeitgeschichte als erste Wutbürger
3.2.7 Der journalistische Diskurs über den Begriff Wutbürger
3.2.8 Kollektivsymbolik im Zusammenhang mit der Bezeichnung Wutbürger in der Berichterstattung
3.3 Bedeutungs- und Diskurskontexte von Wutbürger in der regionalen und überregionalen Berichterstattung im Untersuchungszeitraum „Pegida“
3.3.1 Pegida – Hintergrund und mediopolitische Debatte
3.3.2 Quantitative Verhältnisse der Erscheinung und Bedeutung von Wutbürger im Untersuchungszeitraum „Pegida“
3.3.3 Merkmale von Wutbürger als Bezeichnung für rassistische und sich politisch rechts artikulierende und motivierte Akteur*innen
3.3.4 Wutbürger als Bezeichnung in Leser*innenbriefen
3.3.5 Wutbürger in der Berichterstattung über Kunst und Kultur
3.3.6 Wutbürger in der Berichterstattung über Internationales
3.3.7 Einzelpersonen als Wutbürger in der Berichterstattung
3.3.8 Der journalistische Diskurs über Wutbürger als Zeitgeist-Phänomen
3.3.9 Kollektivsymbolik im Zusammenhang mit der Bezeichnung Wutbürger in der Berichterstattung
3.3.10 Pegida und besorgte Bürger
3.4 Ereignisse mit prägnanten Wutbürger-Bezeichnungen in der Berichterstattung über den Untersuchungszeitraum hinaus
3.5 Zusammenfassende Ergebnisse: Phasen, Typen und Figuren von Wutbürger im mediopolitischen Diskurs
3.5.1 Zur Einordnung: Das Verständnis von Bürger, bürgerlich und Bürgertum in der untersuchten Berichterstattung im Kontext von Wutbürger
3.5.2 Übergreifende Zusammenfassung der empirischen Untersuchung – Erscheinungsweisen, Funktionen und Bedeutungskontexte von Wutbürger und ihre Entwicklungen
4. Vom Bürgertum zum Wutbürgertum
4.1 Sozialgeschichte und Theorien des Bürgertums und der bürgerlichen Gesellschaft
4.1.1 Merkmale des Bürgerbegriffes und des Bildungsbürgertums im 19. Jahrhundert
4.1.2 Exklusive Bürgerideale im Deutschen Idealismus
4.1.3 Die bürgerliche Gesellschaft bei G.W.F. Hegel
4.1.4 Die bürgerliche Gesellschaft und Klasse bei Karl Marx
4.1.5 Die bürgerliche Gesellschaft als Feindbild bildungsbürgerlicher antimoderner Diskurse
4.1.6 Die Krise des Bürgertums – sozioökonomische Bedingungen und soziologische Einordnungen des Bürgerlichen Anfang und Mitte des 20. Jahrhunderts
4.2 Verständnisse des Bürgerbegriffs aus soziologischer, sozial- und politikwissenschaftlicher Perspektive im 21. Jahrhundert
4.2.1 Zur Diskussion von bürgerlicher Gesellschaft als gesellschaftsdiagnostischem Begriff
4.2.2 Das Bürgerliche als Mitte, die Mitte als das Bürgerliche – und das Hufeisen
4.2.3 Bürgergesellschaft und Zivilgesellschaft
4.2.4 Konklusionen: Die Hybridität des Bürgerlichen
4.3 Auseinandersetzungen mit Wutbürger in wissenschaftlichen und journalistischen Veröffentlichungen
4.3.1 Auseinandersetzungen mit Wutbürger in Soziologie, Sozial- und Politikwissenschaft
4.3.2 Auseinandersetzungen mit Wutbürger in nicht-wissenschaftlichen und journalistischen Veröffentlichungen
4.3.3 Zwischenfazit: Ein vom empirischen und theoretischen Forschungsstand isoliertes Schlagwort
5. Konklusionen und Schlussfolgerungen
5.1 Das Problem der Heterogenität und Unbestimmtheit des Grundwortes Bürger
5.2 Die politische Ambivalenz von Wutbürger
5.3 Wutbürger als implizites Funktionselement Extremismus- und ‚Hufeisen‘-theoretischer Ideologie
5.4 Schlussfolgerungen
Aktualisiert: 2022-05-31
> findR *
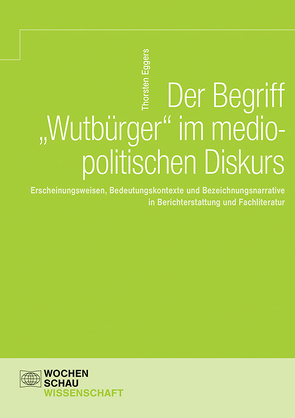
1. Einleitung
2. Diskursanalytische Herangehensweisen als Grundlage für eine Untersuchung von Wissen, Begriffen und Bedeutung
2.1 Erkenntnistheoretischer und methodologischer Zugang: Auf Foucault basierende Diskursdefinitionen und analytische Zugänge
2.1.1 Foucaults Diskurstheorie
Analyse von Diskursen und das damit einhergehende Verständnis von Bedeutung bei Foucault
2.1.2 Die Rezeption der foucaultschen Diskurstheorie nach Laclau/Mouffe
2.1.3 Weitere prägende Rezeptionen und theoretische Weiterentwicklungen foucaultscher Theorie
2.1.4 Kritikpunkte am foucaultschen Werk
2.2 Diskursanalyse als Methodologie: Operationalisierungen der Diskurstheorie
2.2.1 Diskursanalytische Rezeptionen im deutschsprachigen Diskurs
2.2.2 Die Interdiskursanalyse nach Link/Link-Heer
2.2.3 Die Kritische Diskursanalyse nach Jäger
2.3 Konkrete Methodik sowie Material-, Ereignis- und Zeitauswahl der empirischen Forschung
2.3.1 Forschungstheoretische Grundannahmen
2.3.2 Methodische Schritte
2.3.3 Material-, Ereignis- und Zeitauswahl
2.3.4 Leerstellen und offene Perspektiven
3. Empirischer Teil: Rekonstruktion der Bedeutungskontexte und Bezeichnungsnarrative von Wutbürger sowie der damit einhergehenden diskursiven Dynamiken
3.1 Bedingungen der Etablierung des Begriffes Wutbürger in der Berichterstattung über Stuttgart 21
3.1.1 Vor Stuttgart 21: Wutbürger als Wählervereinigung – Die Bürger in Wut aus Bremen
3.1.2 Stuttgart 21 – Geschichte, Hintergrund und Protest
3.1.3 „Der Wutbürger“ – Ein journalistischer Essay als Ausgangspunkt einer ‚neuen‘ politischen Protestfigur
3.2 Bedeutungs- und Diskurskontexte von Wutbürger in der regionalen und überregionalen Berichterstattung im Untersuchungszeitraum „Stuttgart 21“
3.2.1 Quantitative Verhältnisse der Erscheinung und Bedeutung von Wutbürger im Untersuchungszeitraum „Stuttgart 21“
3.2.2 Wutbürger als Bezeichnung in Leser*innenbriefen
3.2.3 Wutbürger in der Berichterstattung über Kunst und Kultur
3.2.4 Wutbürger in der Berichterstattung über Internationales
3.2.5 Wutbürger als journalistische Bezeichnung für Akteur*innen im Fußball
3.2.6 Persönlichkeiten der Zeitgeschichte als erste Wutbürger
3.2.7 Der journalistische Diskurs über den Begriff Wutbürger
3.2.8 Kollektivsymbolik im Zusammenhang mit der Bezeichnung Wutbürger in der Berichterstattung
3.3 Bedeutungs- und Diskurskontexte von Wutbürger in der regionalen und überregionalen Berichterstattung im Untersuchungszeitraum „Pegida“
3.3.1 Pegida – Hintergrund und mediopolitische Debatte
3.3.2 Quantitative Verhältnisse der Erscheinung und Bedeutung von Wutbürger im Untersuchungszeitraum „Pegida“
3.3.3 Merkmale von Wutbürger als Bezeichnung für rassistische und sich politisch rechts artikulierende und motivierte Akteur*innen
3.3.4 Wutbürger als Bezeichnung in Leser*innenbriefen
3.3.5 Wutbürger in der Berichterstattung über Kunst und Kultur
3.3.6 Wutbürger in der Berichterstattung über Internationales
3.3.7 Einzelpersonen als Wutbürger in der Berichterstattung
3.3.8 Der journalistische Diskurs über Wutbürger als Zeitgeist-Phänomen
3.3.9 Kollektivsymbolik im Zusammenhang mit der Bezeichnung Wutbürger in der Berichterstattung
3.3.10 Pegida und besorgte Bürger
3.4 Ereignisse mit prägnanten Wutbürger-Bezeichnungen in der Berichterstattung über den Untersuchungszeitraum hinaus
3.5 Zusammenfassende Ergebnisse: Phasen, Typen und Figuren von Wutbürger im mediopolitischen Diskurs
3.5.1 Zur Einordnung: Das Verständnis von Bürger, bürgerlich und Bürgertum in der untersuchten Berichterstattung im Kontext von Wutbürger
3.5.2 Übergreifende Zusammenfassung der empirischen Untersuchung – Erscheinungsweisen, Funktionen und Bedeutungskontexte von Wutbürger und ihre Entwicklungen
4. Vom Bürgertum zum Wutbürgertum
4.1 Sozialgeschichte und Theorien des Bürgertums und der bürgerlichen Gesellschaft
4.1.1 Merkmale des Bürgerbegriffes und des Bildungsbürgertums im 19. Jahrhundert
4.1.2 Exklusive Bürgerideale im Deutschen Idealismus
4.1.3 Die bürgerliche Gesellschaft bei G.W.F. Hegel
4.1.4 Die bürgerliche Gesellschaft und Klasse bei Karl Marx
4.1.5 Die bürgerliche Gesellschaft als Feindbild bildungsbürgerlicher antimoderner Diskurse
4.1.6 Die Krise des Bürgertums – sozioökonomische Bedingungen und soziologische Einordnungen des Bürgerlichen Anfang und Mitte des 20. Jahrhunderts
4.2 Verständnisse des Bürgerbegriffs aus soziologischer, sozial- und politikwissenschaftlicher Perspektive im 21. Jahrhundert
4.2.1 Zur Diskussion von bürgerlicher Gesellschaft als gesellschaftsdiagnostischem Begriff
4.2.2 Das Bürgerliche als Mitte, die Mitte als das Bürgerliche – und das Hufeisen
4.2.3 Bürgergesellschaft und Zivilgesellschaft
4.2.4 Konklusionen: Die Hybridität des Bürgerlichen
4.3 Auseinandersetzungen mit Wutbürger in wissenschaftlichen und journalistischen Veröffentlichungen
4.3.1 Auseinandersetzungen mit Wutbürger in Soziologie, Sozial- und Politikwissenschaft
4.3.2 Auseinandersetzungen mit Wutbürger in nicht-wissenschaftlichen und journalistischen Veröffentlichungen
4.3.3 Zwischenfazit: Ein vom empirischen und theoretischen Forschungsstand isoliertes Schlagwort
5. Konklusionen und Schlussfolgerungen
5.1 Das Problem der Heterogenität und Unbestimmtheit des Grundwortes Bürger
5.2 Die politische Ambivalenz von Wutbürger
5.3 Wutbürger als implizites Funktionselement Extremismus- und ‚Hufeisen‘-theoretischer Ideologie
5.4 Schlussfolgerungen
Aktualisiert: 2022-05-31
> findR *

Mit diesem Abschlussbericht stellen wir die Ergebnisse aus dem Forschungsvorhaben
„Innovation durch Kooperation und Fachkräfteentwicklung, Strategien zur Sicherung
der Zukunftsfähigkeit ostdeutscher KMU“ vor, das 2005 bis 2006 durchgeführt
und vom BMVBW finanziert wurde (Teil A). Es zielt auf die Identifikation der spezifischen
Innovationspotenziale und die Analyse der Kooperationsbeziehungen zwischen
KMU und externen Wissensträgern. Wegen der hohen Bedeutung des extern
generierten Wissenstransfers standen die Probleme bei der Kooperationsverbesserung
zwischen Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen im Zentrum dieser
Perspektive. Als weiterer Schwerpunkt des Forschungsvorhabens wurden die
langfristige Sicherung des qualifizierten Fachkräftebedarfs untersucht und Vorschläge
für eine Verbesserung der Rekrutierungschancen gemacht.
Die Erhebungen basieren auf einer Reihe von Fallstudien und auf der Auswertung
von zwischen 2001 und 2005 durchgeführten größeren Befragungen in verschiedenen
Branchen und Bundesländern Ostdeutschlands. Diese Erhebungen wurden auch
quantitativ ausgewertet.
Wir können daher für bestimmte Zusammenhänge auch Größenordnungen und Verteilungen
angeben. Der Abschlußbericht des Projekts wurde im Frühjahr 2006 auf
einer Konferenz mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft vorgestellt, deren Ergebnisse
im Anhang dokumentiert sind (Teil B).
Die vorgestellten Ergebnisse stellen das Anschlussprojekt der im Zeitraum
2004/2005 durchgeführten Studie „Aufbau Ost – Betriebliche und überbetriebliche
Erfolgsfaktoren im Verarbeitenden Gewerbe Ostdeutschlands“ dar.
Aktualisiert: 2018-07-12
> findR *
In dem Buch von Heinz Stahl und Stephan Friedrich von den Eichen zeigen namhafte Experten aus Wissenschaft, Führungs- und Beratungspraxis, wie Netzwerkstrukturen erfolgreich angewendet werden können. Von den Grundlagen bis hin zur praktischen Umsetzung erfährt der Leser, was bei der Vernetzung zu beachten ist. Das Werk dient damit der erfolgreichen Unternehmensführung.
Aktualisiert: 2023-04-24
Autor:
Reinhard J. Ambros,
Thilo Beck,
Norbert Copray,
Stephan Duschek,
Thorsten Eggers,
Johannes Feldmayer,
Dietmar Fink,
Bettina Fischer,
Jörg Freiling,
Anne Freund,
Stephan A. Friedrich von den Eichen,
Hans Georg Gemünden,
Ulrich Grimm,
Ulrich Hemel,
Hans H. Hinterhuber,
Frank Huber,
Steffen Kinkel,
Bianka Knoblach,
Michael Mirow,
Michael-Jörg Oesterle,
Heike Proff,
Andreas Rasche,
Michael Reiss,
Manfred Remmel,
Birgit Renzl,
Markus Rometsch,
Hans-Gerd Servatius,
Heinz K. Stahl,
Jörg Sydow,
Carsten Vollrath,
Christoph Wamser
MEHR ANZEIGEN
Bücher von Eggers, Thorsten
Sie suchen ein Buch oder Publikation vonEggers, Thorsten ? Bei Buch findr finden Sie alle Bücher Eggers, Thorsten.
Entdecken Sie neue Bücher oder Klassiker für Sie selbst oder zum Verschenken. Buch findr hat zahlreiche Bücher
von Eggers, Thorsten im Sortiment. Nehmen Sie sich Zeit zum Stöbern und finden Sie das passende Buch oder die
Publiketion für Ihr Lesevergnügen oder Ihr Interessensgebiet. Stöbern Sie durch unser Angebot und finden Sie aus
unserer großen Auswahl das Buch, das Ihnen zusagt. Bei Buch findr finden Sie Romane, Ratgeber, wissenschaftliche und
populärwissenschaftliche Bücher uvm. Bestellen Sie Ihr Buch zu Ihrem Thema einfach online und lassen Sie es sich
bequem nach Hause schicken. Wir wünschen Ihnen schöne und entspannte Lesemomente mit Ihrem Buch
von Eggers, Thorsten .
Eggers, Thorsten - Große Auswahl an Publikationen bei Buch findr
Bei uns finden Sie Bücher aller beliebter Autoren, Neuerscheinungen, Bestseller genauso wie alte Schätze. Bücher
von Eggers, Thorsten die Ihre Fantasie anregen und Bücher, die Sie weiterbilden und Ihnen wissenschaftliche Fakten
vermitteln. Ganz nach Ihrem Geschmack ist das passende Buch für Sie dabei. Finden Sie eine große Auswahl Bücher
verschiedenster Genres, Verlage, Schlagworte Genre bei Buchfindr:
Unser Repertoire umfasst Bücher von
Sie haben viele Möglichkeiten bei Buch findr die passenden Bücher für Ihr Lesevergnügen zu entdecken. Nutzen Sie
unsere Suchfunktionen, um zu stöbern und für Sie interessante Bücher in den unterschiedlichen Genres und Kategorien
zu finden. Neben Büchern von Eggers, Thorsten und Büchern aus verschiedenen Kategorien finden Sie schnell und
einfach auch eine Auflistung thematisch passender Publikationen. Probieren Sie es aus, legen Sie jetzt los! Ihrem
Lesevergnügen steht nichts im Wege. Nutzen Sie die Vorteile Ihre Bücher online zu kaufen und bekommen Sie die
bestellten Bücher schnell und bequem zugestellt. Nehmen Sie sich die Zeit, online die Bücher Ihrer Wahl anzulesen,
Buchempfehlungen und Rezensionen zu studieren, Informationen zu Autoren zu lesen. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
das Team von Buchfindr.