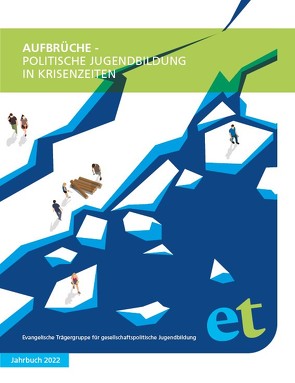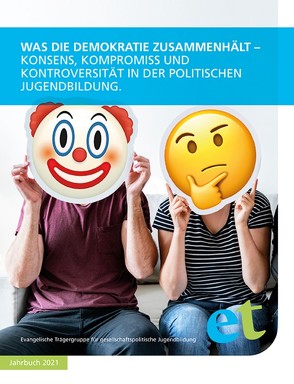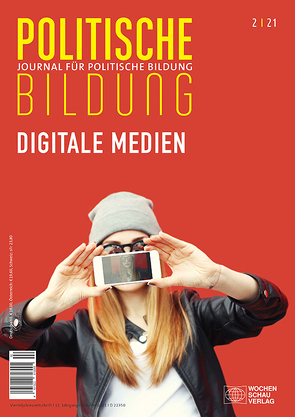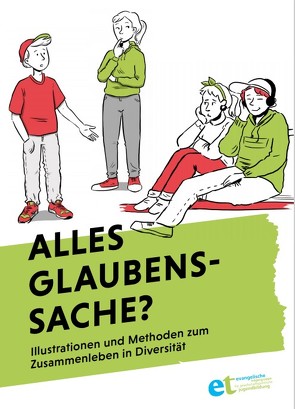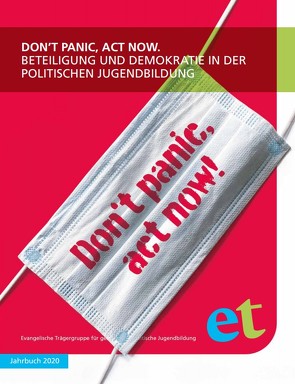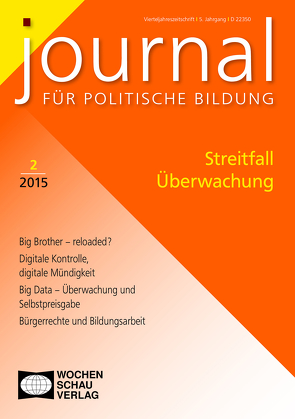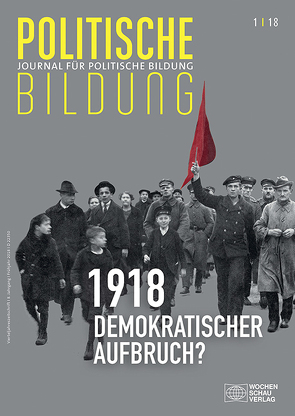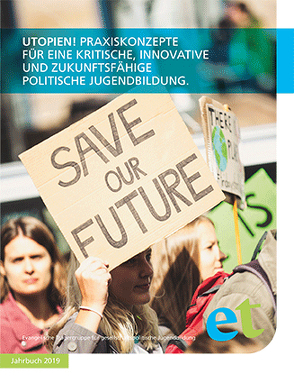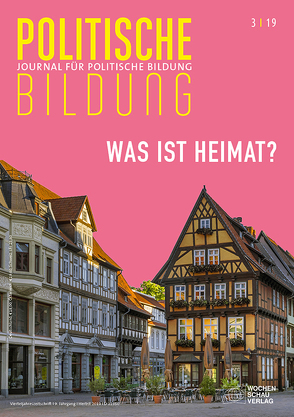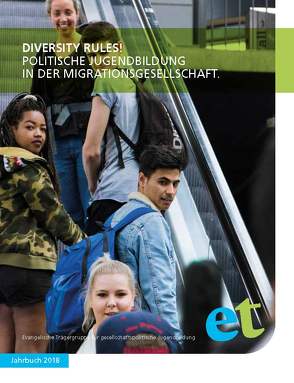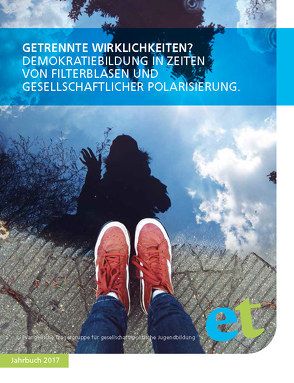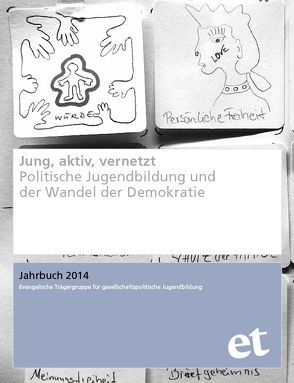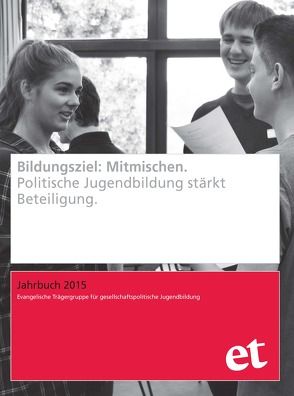Mit diesem Jahrbuch will die et Lust darauf machen, sich allen Widrigkeiten und besorgniserregenden Entwicklungen zum Trotz auf die Suche nach neuen Wegen in der politischen Jugendbildung zu machen. Mit dem zentralen Begriff der „Aufbrüche“ im Titel verbindet sich der Anspruch, grundlegende Herausforderungen nicht aus dem Blick zu verlieren und konkrete Anregungen für eine Weiterentwicklung der Praxis zu geben.
Aktualisiert: 2023-04-11
> findR *
Konsens, Kompromiss und Kontroversität sind drei Schlüsselbegriffe des Jahrbuchs der politischen Jugendbildung. Es versammelt Beiträge aus dem Netzwerk der et, die Erfahrungen aus der Praxis der politischen Jugendbildung vor Ort mit einer Reflexion von aktuellen gesellschaftspolitischen Herausforderungen verbinden. Die Beiträge behandeln in diesem Jahr Praxiskonzepte zum Umgang mit Verschwörungsideologien, Rassismus, gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und Populismus. Sie zeigen Wege auf, wie politische Jugendbildung diversitätssensible Bildungsräume gestalten und neue Kooperationsfelder, beispielsweise im Zusammenspiel mit Schule und Jugendsozialarbeit, erschließen kann.
Aktualisiert: 2023-04-11
> findR *
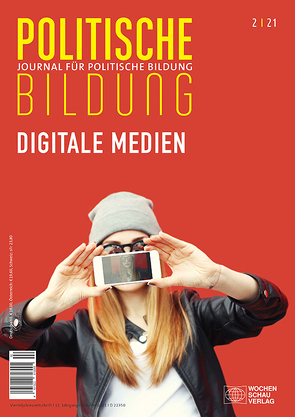
2021 ist ein Superwahljahr, ein Anlass zu fragen, wie sich Menschen über politische und gesellschaftliche Entwicklungen informieren und welche Medien zur Meinungsbildung und damit auch zu Wahlentscheidungen beitragen. In dieser Ausgabe fragen wir nach der Relevanz digitaler Medien für Information und Entwicklung politischer Einstellungen. Social Media dienen zunehmend nicht nur dazu, sich mit anderen zu vernetzen oder sich auf Plattformen wie Facebook, Instagram oder TikTok selbst darzustellen, sondern dass sie immer häufiger auch zur Information genutzt werden. Um sich zu informieren, setzen Jugendliche Suchmaschinen ein, sehen sich Videos auf YouTube an, recherchieren in Wikis oder frequentieren aktuelle Informationen bei Facebook und Twitter. Junge Menschen bewegen sich souverän in diesen Medienwelten. Gemeinsam mit den Nachrichtenportalen von Tages- und Wochenzeitungen, den Websites von Verbänden und Initiativen, den Blogs vielfältiger Akteure bilden diese Plattformen eine digitale Öffentlichkeit, die sich jedoch in unterschiedliche Bubbles aufteilt. Kennzeichnend ist der Einsatz digitaler Kommunikationstechnologien, die die Option eröffnen, mit einem potenziell unbegrenzten Adressatenkreis zu kommunizieren und das bei relativ geringen Transaktionskosten. Der besondere Reiz der digitalen Kommunikation besteht darin, unmittelbar, ohne den Filter traditioneller Medien passieren zu müssen, miteinander zu kommunizieren. Man benötigt lediglich einen Zugang zum Internet. Diese Struktur ist offensichtlich auch attraktiv für Parteien, die eigene Medienzentren einrichten, um ihre Botschaften zu verbreiten, ohne dass diese den Weg durch Redaktionen nehmen müssen. Mit der Erweiterung des Repertoires digitaler Kommunikation hat das digitale Zeitalter auch eine neue Sozialfigur hervorgebracht: die Influencerin oder den Influencer, also Personen, die es in den Social Media zu einer gewissen Bekanntheit gebracht haben. Üblicherweise gelten Influencer*innen als jemand, der/die für bestimmte Produkte wirbt und/oder Tipps für die Alltagsbewältigung gibt. Doch zunehmend treten Akteur*innen auf, die sich für gesellschaftspolitische Anliegen engagieren, oder es werden kurze Erklärfilme zu Begriffen aus politischen Debatten oder über gesellschaftlichen Protest produziert.
Social Media sind einflussreiche Instrumente der politischen Meinungsbildung, insbesondere für Jugendliche. Gerade für den Alltag von Jugendlichen hat sich die Trennung zwischen digitaler und analoger Welt überholt. Darauf muss sich die politische Bildung einstellen. Eine kritische, politische Medienbildung ist gefragt, die Kompetenzen vermittelt sowie Prozesse und Aktivitäten begleitet.
Aktualisiert: 2021-06-02
> findR *
“Klamottenkiste – ein Planspiel zu Respekt im Klassenchat” ist ein neues Angebot der Evangelischen Trägergruppe. Das Besondere: “Klamottenkiste” ist ein Videoplanspiel. Das heißt, das Szenario und die Rollen werden in kurzen Videos vorgestellt. Dadurch ist es für die Spieler*innen leichter, sich in die Rollen hineinzuversetzen, und wird die Hürde umgangen, die eine rein textbasierte Rollenbeschreibung für Viele darstellt.
Das Planspiel wurde explizit mit Blick auf die Kooperation mit Respekt Coaches und Schulen entwickelt und eignet sich hervorragend als Gruppenangebot in diesem Kontext. Idealerweise kann durch weitere Angebote der Respekt Coaches zum Thema eine Einbettung in die Schule und eine nachhaltige Bearbeitung des Themas sichergestellt werden.
Aktualisiert: 2023-04-11
> findR *
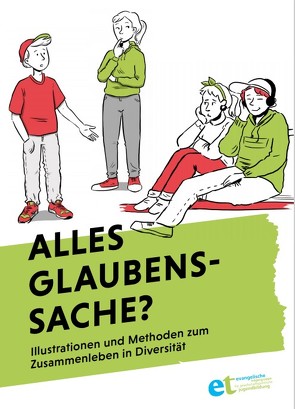
Mit dieser Handreichung stellen wir Illustrationen vor, die im Projekt „Alles Glaubenssache?“ der Evangelischen Trägergruppe für gesellschaftspolitische Jugendbildung (et) gemeinsam mit der Zeichnerin Soufeina Hamed entwickelt wurden. Darüber hinaus möchten wir Anregungen und konkrete Methoden weitergeben, wie diese Illustrationen in der pädagogischen Praxis zum Einsatz kommen können. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Bildern, die es Jugendlichen ermöglichen, über die Bedeutung von Religion und Religiosität in ihrem eigenen Leben und über das Zusammenleben unterschiedlicher Religionsgemeinschaften in unserer Demokratie ins Gespräch zu kommen. Unser Anliegen ist es, mit den Materialien potentiell alle Jugendlichen anzusprechen — ob sie nun ihre Religion bewusst praktizieren, sich eher als religiös sozialisiert bezeichnen oder sich keiner Religionsgemeinschaft zugehörig fühlen.
Darüber hinaus behandeln die Illustrationen und Methodenvorschläge eine Vielzahl weiterer Themen wie Demokratische Aushandlungs- und Entscheidungsprozesse, Gleichberechtigte Teilhabe, Herkunft, Diskriminierungserfahrungen und Vorurteile. Ziel ist es, durch die Illustrationen einen niedrigschwelligen Einstieg in diese schwierigen, komplexen Themen zu ermöglichen und die vielfältigen Erfahrungen und Perspektiven der Jugendlichen in den Mittelpunkt der pädagogischen Angebote zu stellen. Bilder sind immer mehrdeutig und eröffnen einen Assoziations- und Denkraum. Die Richtung des pädagogischen Prozesses kann sich daher besonders gut an den Wahrnehmungen, Themen und Anliegen der Teilnehmer*innen orientieren.
Aktualisiert: 2023-04-11
> findR *
Mit dem Jahrbuch 2020 nimmt die Evangelische Trägergruppe für gesellschaftspolitische Jugendbildung die Förderung demokratischer Bildung und Beteiligung junger Menschen in den Blick. Der Titel „Don’t panic – act now“ beschreibt dabei eine Grundhaltung: Unsere Gesellschaft muss komplexe Herausforderungen bewältigen, die gerade auch von Jugendlichen wahrgenommen werden und ihre Zukunft betreffen. Die existentielle Bedrohung durch den Klimawandel oder die Verletzlichkeit einer global vernetzten Welt durch die Corona-Pandemie lösen Ängste und Ohnmachtsgefühle aus. Gerade in einer solchen gesellschaftlichen Gemengelage möchte politische Jugendbildung dazu ermutigen, im Austausch zu bleiben, Entwicklungen besser zu verstehen, sich eigene Handlungsmöglichkeiten zu erschließen und gemeinsam mit anderen aktiv zu werden.
Aktualisiert: 2023-04-11
> findR *

Schwerpunkt dieser Ausgabe des JOURNALs ist die Frage nach Räumen und Orten der politischen Bildung. Als wir dieses Heft geplant haben, war die Vorstellung undenkbar, dass ein Virus demnächst das öffentliche Leben in diesem Land weitgehend stilllegen könnte. Oder dass Bildungsstätten für einen längeren Zeitraum geschlossen werden müssen, um einen Beitrag zur Eindämmung einer Pandemie zu leisten. Die Idee war, die Entwicklung neuer Formate, die sich verstärkende Vernetzung und die zunehmenden Kooperationen in der politischen Bildung zum Anlass zu nehmen, über Orte und Räume der politischen Bildung neu nachzudenken.
Von der politischen Bildung sind in der jüngeren Vergangenheit eine Vielzahl neuer Formate entwickelt, andere Orte des Lernens entdeckt und neue Informations- und Kommunikationskanäle erschlossen worden. Wie können Grundlagen demokratischen Verhaltens wirkungsvoller vermittelt werden? Wie kann zur Prävention von Extremismus beigetragen, der Einsatz digitaler Medien ausgebaut, das wachsende Interesses an gesellschaftlicher und politischer Partizipation gestärkt werden? Wie gelingt es, einen besseren Zugang zu schwierig erreichbaren Zielgruppen aufzubauen? Wie kann die zunehmende Bereitschaft, sich für öffentliche Angelegenheiten zu engagieren, gestärkt werden?
Von diesen Fragen sind die Innovationen geleitet. Dabei ist auch deutlich geworden, dass die Relevanz von Orten und Räumen für die Praxis politischer Bildung genauer zu reflektieren ist und die vielschichtigen Prozesse zur Gestaltung von Räumen und der Wirkung von Orten für Bildungsprozesse bewusster zu machen sind. Räume sind nicht nur
physisch vorhandene, eventuell mit Einrichtungsgegenständen gestaltete Einheiten, sie werden von Akteuren angeeignet und durch die jeweilige Nutzung in ihrer Bedeutung geprägt. Sie können z.B. die Zugänge zur Bildung erleichtern oder erschweren, sie können Bildungsprozesse fördern oder blockieren, sie können Motivation anregen oder auch
lähmen, auf jeden Fall sind sie pädagogisch wirksam. In den Beiträgen dieses Heftes werden diese Aspekte aufgenommen.
Aktualisiert: 2020-05-27
> findR *
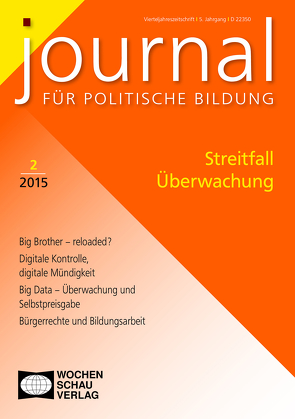
Wie weit darf Sicherheit auf Kosten der Freiheit gehen? Dieser Widerstreit, der unsere Gesellschaft sowie die politische Bildung seit vielen Jahren beschäftigt, dreht sich letzten Endes darum, wie wir beides miteinander in Einklang bringen können. Nicht erst seit den Enthüllungen Edward Snowdens ist bekannt, dass unsere Freiheit im digitalen Zeitalter massiv angegriffen wird. Die Formulierung „aus Sicherheitsgründen“ ist zu einem staatstragenden Autoritätsargument geworden, das jede Diskussion abwürgt und Maßnahmen durchzusetzen erlaubt, die sonst nicht akzeptiert würden. Der italienische Philosoph Giorgio Agamben bemerkte im Kontext staatlicher Sicherheitspolitik unlängst: „In gewisser Hinsicht sind die heute geltenden Sicherheitsgesetze in den europäischen Ländern deutlich strenger als in den faschistischen Regimen des 20. Jahrhunderts“. Neben Facetten staatlicher Überwachung nimmt die vorliegende Ausgabe des Journals auch die Erfassung unserer Privatheit für wirtschaftliche Zwecke in den Blick. George Orwells düsterer Zukunftsroman „1984“ wurde zur Chiffre für den Überwachungsstaat, und mittlerweile kann man sich das Orwellsche Überwachungsgerät „Televisor“ freiwillig ins Wohnzimmer holen: Im Februar 2015 warnte ein südkoreanischer Hersteller von Fernsehgeräten vor den Eigenschaften des eigenen Produkts. „Wenn Sie die Spracherkennung aktivieren“, so das Unternehmen, „können Sie mithilfe Ihrer Stimme mit Ihrem Smart-TV interagieren. Bitte beachten Sie, dass sämtliche gesprochenen Worte, auch persönliche oder sensible Informationen, bei Ihrer Nutzung der Spracherkennung erhoben und an einen Drittanbieter übertragen werden.“ Womit die Brücke zum dritten Schwerpunkt des Heftes geschlagen wäre, nämlich der bewussten Preisgabe sensibler persönlicher Daten, etwa über Facebook, Self-Monitoring und eben Smart-TVs: Wir sind Komplizen unserer Überwachung. Doch die Daten, die bewusst geteilt werden, sind nur die Spitze des Eisbergs. Die mittel- und langfristige Gefahr droht dort, wo Metadaten erfasst, Nutzungsverhalten gespeichert und Informationen in nicht nachvollziehbarer Weise zu Profilen für Überwachungsmaßnahmen aggregiert werden. Der digitalen Herausforderung unseres noch weitgehend analog verfassten, demokratischen Gemeinwesens zu begegnen stellt sicherlich eine der großen Aufgaben politischer Bildung in den kommenden Jahren dar. Die vorliegende Ausgabe des Journals widmet sich eben diesen Diskussionsfeldern aus dem Blickwinkel von Theorie und Praxis der politischen Bildung.
Aktualisiert: 2020-03-29
Autor:
Jochen Butt-Posnik,
Alexander Filipovic,
Uwe Findeisen,
Gereon Flümann,
Mario Foerster,
Rolf Gössner,
Ole Jantschek,
Martin Langebach,
Gernot Meier,
Cornelius Strobel,
Thilo Weichert,
Hanne Wurzel
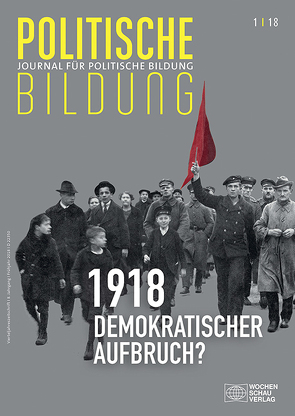
Ob der Erste Weltkrieg nun als „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ oder Auftakt zur „Weltkriegsepoche“ interpretiert wird, ist weiterhin umstritten. Weniger sind es Fakten und Auswirkungen: Der Erste Weltkrieg kostete knapp 20 Millionen Menschen das Leben, führte zur Auflösung mehrerer Großmächte und zur Bildung zahlreicher neuer Staaten – nun als Demokratien. Im Zentrum der oft auch nach Kriegsende anhaltenden Auseinandersetzungen stand oftmals der Streit um die Form der Demokratie (parlamentarische, Rätedemokratie oder kommunistisches System), der vor allem aus dem Interesse am Fortbestand oder am (Wieder-)Aufstieg der eigenen Nation gespeist wurde. Es entstanden post-monarchische politische Systeme, von republikanischen Ideen geprägte Demokratien, jedoch keineswegs das von demokratischen Gesellschaften erhoffte friedliche Miteinander der Völker der Welt. Im Angesicht der drohenden militärischen Niederlage wurde am 28. Oktober 1918 für Deutschland der Übergang von einer konstitutionellen zu einer parlamentarischen Demokratie beschlossen. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg in die Demokratie war die Einführung des Wahlrechts für alle Frauen und Männer ab 20 Jahre. Diese Entscheidung war noch während des Krieges immer wieder angekündigt, jedoch erst danach umgesetzt worden, auch um die Motivation für den Kriegseinsatz aufrecht zu erhalten, denn zum ersten Mal wurde die gesamte Bevölkerung in neuer Qualität in den Ablauf eines Kriegs einbezogen. Die politische Kultur in Deutschland war 1918 in unterschiedliche sozial-moralische Milieus gespalten: in das höfisch-aristokratische, das bürgerlich-liberale, das katholischkleinbürgerlich-bäuerliche und das sozialdemokratisch-proletarische. Diese vier Milieus identifizierten sich in unterschiedlicher Weise mit dem neuen Staat und der neuen Gesellschaft. Grundsätzlich kann von einer gespaltenen politischen Kultur gesprochen werden, die auch von übersteigerten Erwartungen an die Politik geprägt war: die nationale Ehre sollte wiederhergestellt, die ökonomische Lage stabilisiert, die soziale Frage entschärft werden. Nach innen sollten die gesellschaftlichen Gruppen miteinander versöhnt und nach außen die Nation glanzvoll repräsentiert werden. Gerade für die historisch-politische Bildung lohnt es sich, den Weg in die Demokratie und die folgenden Krisen genauer in den Blick zu nehmen. Welche Errungenschaften bringt die Demokratie als Staatsform mit sich? Welche Prinzipien begleiten die Neuordnung der Staaten sowie die Bildung von Nationen? Wie entwickeln sich die Auseinandersetzungen zwischen Befürwortern und Gegnern der Demokratie? Weshalb konnten die neuen demokratischen Gesellschaften die mit ihnen verbundenen Hoffnungen nicht einlösen? Welche Entwicklungen führten dazu, dass die Skepsis gegenüber der Demokratie wuchs und autoritäre Systeme politisch immer mehr Bedeutung erlangten? In diesem Heft wird das Ende des Ersten Weltkriegs im November 1918 zum Anlass genommen, an die daraus folgende Neuordnung der Welt zu erinnern und sich mit den Auswirkungen dieses Ereignisses zu beschäftigen. Die politischen Entscheidungen nach dem Waffenstillstand, in den Friedensverträgen, bei der Gründung des Völkerbunds haben bis in die Gegenwart für die politischen Debatten in Europa eine hohe Relevanz. Deshalb ist die Beschäftigung damit für die politische Bildung und ihre Auseinandersetzung mit aktuellen Entwicklungen wichtig – insbesondere, wenn im Jahr 2018 neurechte Vordenker und prominente Regierungspolitiker eine „konservative Revolution“ für Deutschland einfordern und damit direkt – wenn auch vielleicht aus historischem Unwissen – auf die Abschaffung der Demokratie in der Weimarer Republik rekurrieren.
Aktualisiert: 2020-03-29
Autor:
Aleida Assmann,
Michele Barricelli,
Wiltrud Gieseke,
Ulrike Guérot,
Antia Haviv-Horiner,
Patricia Hladschik,
Ole Jantschek,
Miriam Menzel,
Nausikaa Schirilla,
Sigrid Steininger,
Volker Weiß
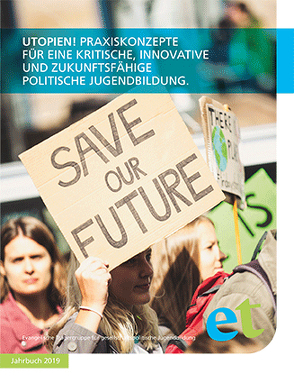
In den aktuellen politischen Debatten kann mitunter der Eindruck entstehen, dass unsere Gesellschaft den Glauben an die Gestaltbarkeit gesellschaftlicher Verhältnisse verloren hat. Ob „Krise der liberalen Demokratie“, „Klimakatastrophe“, „digitale Diktatur“ oder „globale Migrationskrise“ – Erzählungen von der nahen Zukunft klingen oft wenig optimistisch. Wo die Krise in aller Munde ist, sind Fatalismus und Ohnmachtsgefühle oft nicht weit. Politische Bildung will demgegenüber Jugendliche in ihrer Kritik- und Handlungsfähigkeit stärken. Dabei gilt es, eine Balance zu finden zwischen der berechtigten Unzufriedenheit mit gesellschaftlichen Missständen und dem nötigen Optimismus, dass sich diese zum Besseren ändern lassen. Die Beiträge im Jahrbuch 2019 haben daher die praktische Arbeit an der Utopie einer besseren Gesellschaft zum Thema: Sie behandeln Umbruchprozesse und Herausforderungen, auf die unsere Gesellschaften neue Antworten finden müssen – wie den Systemwechsel hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft, das Zusammenleben in wachsender Vielfalt oder die Gestaltung der Digitalisierung. Und sie zeigen Wege für eine kritische, innovative und zukunftsfähige politische Jugendbildung auf. Eine besondere Rolle spielen dabei offene, kreative und partizipative Formate und Methoden, in denen Teilnehmer*innen miteinander über Alternativen und Möglichkeiten der Verantwortungsübernahme in ihrem Lebensalltag nachdenken.
Aktualisiert: 2023-04-11
> findR *
Dieter Bohlen wollte im November 2018 in der RTL-Castingshow „Das Supertalent“ der fünfjährigen Melissa nicht glauben, dass sie und ihre Eltern aus Herne kommen … Journalisten kritisierten Bohlens Verhalten, denn durch die Fragen nach der Herkunft werde man schon als Kind „fremdgemacht“. Dieses Phänomen nennt sich „Othering“ und ist eine Abgrenzungspraxis, die die „Anderen“ in Differenz zu den „Eigenen“ konstruiert. Betroffene empfinden das oft als Rassismus. Der Begriff „Heimat“ spielt hier eine große Rolle. In diesem Kontext hat in den vergangenen Monaten ein Buch die Diskussionen in Deutschland geprägt: „Eure Heimat ist unser Albtraum“, das das Thema aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Heimat als Traum oder Albtraum? Diese Ausgabe des "Journal" geht dem Begriff in seinen verschiedenen Facetten und aus unterschiedlichen Perspektiven auf den Grund.
Aktualisiert: 2020-03-29
> findR *
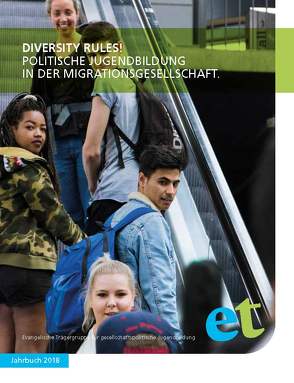
„Diversity rules!“ – Diversität bestimmt unsere Gesellschaft und das nicht erst seit gestern. Deutschland ist seit Jahrzehnten Einwanderungsland. Menschen mit Migrationserfahrung oder -hintergrund, mit und ohne deutschen Pass leben in unserer Gesellschaft zusammen. Jede*r fünfte Bürger*in in Deutschland hat einen Migrationsbezug. In jüngster Zeit haben insbesondere die Binnenmigration innerhalb der Europäischen Union und der Zuzug von Geflüchteten, die in Deutschland und Europa Schutz vor Krieg, Verfolgung und Hunger suchten, zugenommen. Auch darüber hinaus ist die deutsche Gesellschaft durch eine lebendige Pluralität gekennzeichnet. Politische Jugendbildung muss für diese Diversität, aber auch für Diskriminierungen sensibel sein und jungen Menschen unabhängig von Herkunft, Alter, Gender, sexueller Orientierung, Religion, Weltanschauungen und anderen Merkmalen eine gleichberechtigte Teilhabe ermöglichen.
Zugleich stellt eine zunehmende Polarisierung in der Diskussion um den Umgang mit Migration und gesellschaftlicher Diversität eine Herausforderung für den Zusammenhalt in der Gesellschaft dar. Angesichts dieser Entwicklungen muss auch die politische Jugendbildung Fragen nach Zugehörigkeit, nach Spielregeln des Zusammenlebens sowie nach gesellschaftlicher und politischer Teilhabe aktiv aufgreifen. „Diversity rules!“ ließe sich daher auch als “Regeln für den Umgang mit Diversität” übersetzen: Wie wollen wir in einer Gesellschaft, die immer vielfältiger wird, zukünftig zusammenleben?
Wie politische Jugendbildung in der Migrationsgesellschaft gelingt, verdeutlich das Jahrbuch 2018 mit zahlreichen Praxisbeispielen. Es zeigt Wege auf, wie sich politische Bildungspraxis selbst verändern, qualifizieren und weitentwickeln kann, um in der Migrationsgesellschaft Wirkung zu entfalten.
Aktualisiert: 2023-04-11
> findR *
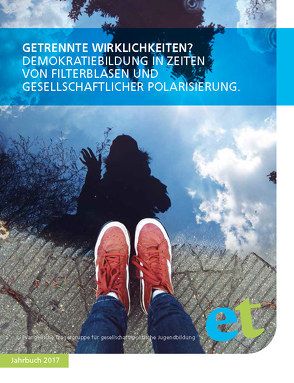
Die repräsentative Demokratie ist mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Demokratiefeindliche Kräfte stellen die Legitimität des politischen Systems und der etablierten Medien in Frage. Die gesellschaftliche Polarisierung nimmt zu und die Auseinandersetzung wird lauter. Ein zentrales Handlungsfeld sind dabei digitale Kommunikationsräume. Doch Menschen scheinen nicht nur zunehmend in getrennten Medienwelten zu leben – als unüberbrückbar empfundene Differenzen in den Wertvorstellungen und Bewertungen zentraler gesellschaftlicher Fragen zeigen sich auch im Alltag. Damit droht der Demokratie der gemeinsame Raum verloren zu gehen, in dem Konflikte ausgetragen, unterschiedliche Positionen miteinander verhandelt und gemeinsame Lösungen gefunden werden können.
Das Jahrbuch 2017 gibt Einblicke, wie die Evangelische Trägergruppe auf diese komplexe Gemengelage mit Angeboten der politischen Jugendbildung reagiert. Die Beiträge vermitteln einen lebendigen Eindruck von vielfältigen Projekten, Seminaren und Tagungen. Sie zielen darauf, demokratiefeindlichen Tendenzen zu begegnen, die kritische Medienkompetenz im Umgang mit Falschmeldungen und Verschwörungstheorien zu schulen und demokratische Aushandlungs- und Teilhabeprozesse zu fördern.
Aktualisiert: 2023-04-11
> findR *
Das Jahrbuch 2016 fragt angesichts der Krise Europas, welchen Beitrag politische Bildung leisten kann, wirft einen Blick auf die jugendpolitische Agenda der kommenden Jahre und versammelt konkrete Beispiele aus der Praxis. Die Evangelische Trägergruppe lädt Jugendliche ein, sich mit ihren Lebensperspektiven in Europa auseinanderzusetzen und ihre Ideen für die Zukunft der europäischen Demokratie zu formulieren. Die Beiträge im Jahrbuch berichten von vielfältigen Erfahrungen, wie dies gelingt, z. B. durch innovative Planspiele zu den Baustellen der EU, Workshops mit jungen Geflüchteten zur Asyl- und Flüchtlingspolitik oder eine transnationale Spurensuche zu Erinnerungskulturen in Ostmitteleuropa.
Aktualisiert: 2023-04-11
> findR *
Welche Chancen ergeben sich aus der Entwicklung des Internets zum Mitmachnetz und durch die rasante Verbreitung von sozialen Medien unter Jugendlichen für die politische Jugendbildung? Die Beiträge dieses Bandes geben anregende Einblicke in vielfältige Praxisprojekte: Neue Formate wurden erprobt und digitale Medien zur Erkundung der Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen, zur Visualisierung von Wünschen, zur Artikulation von Interessen, zur Präsentation von Forderungen und zur Kommunikation mit Entscheidungsträgern eingesetzt. Im Vordergrund standen die Ideen, Online- und Offline-Medien in der Praxis zu verknüpfen, die Tools des Web 2.0 anzuwenden, mit digitalen Medien kreativ zu arbeiten und Ansätze der Partizipation zu stärken. Weiter werden Anregungen für eine zukünftige Praxis im dynamischen Feld der außerschulischen politischen Bildung formuliert.
Aktualisiert: 2022-11-29
> findR *
Der Band reflektiert aktuelle politikwissenschaftliche Debatten zum Wandel der Demokratie und stellt Praxisbeispiele der politischen Jugendbildung vor.
Aktualisiert: 2023-04-11
> findR *
Mit dem Fokusthema «Demokratische Mitwirkung» fragt die Evangelische Trägergruppe im Jahr 2015 nach Formen der Partizipationen von Jugendlichen im Alltag und bei Themen, die sie betreffen. Dabei steht die Übernahme von Verantwortung im sozialen Umfeld, in Schule, Kommune und Arbeitswelt, das Engagement in Projekten und Initiativen im Vordergrund. Das Jahrbuch versammelt dazu vielfältige Praxiserfahrungen: Beispiele für gelungene Jugendpartizipation auf der kommunalen Ebene, methodisch innovative Ansätze mit dem Computerspiel Minecraft, gelungenes Empowerment für «benachteiligte Jugendliche» und Erkenntnisse aus regionalen und europäischen Netzwerken. Weitere Beiträge reflektieren die jugendpolitischen Rahmenbedingungen dieser Arbeit und geben Impulse für eine jugendgerechte Netzpolitik.
Aktualisiert: 2023-04-11
> findR *
MEHR ANZEIGEN
Bücher von Jantschek, Ole
Sie suchen ein Buch oder Publikation vonJantschek, Ole ? Bei Buch findr finden Sie alle Bücher Jantschek, Ole.
Entdecken Sie neue Bücher oder Klassiker für Sie selbst oder zum Verschenken. Buch findr hat zahlreiche Bücher
von Jantschek, Ole im Sortiment. Nehmen Sie sich Zeit zum Stöbern und finden Sie das passende Buch oder die
Publiketion für Ihr Lesevergnügen oder Ihr Interessensgebiet. Stöbern Sie durch unser Angebot und finden Sie aus
unserer großen Auswahl das Buch, das Ihnen zusagt. Bei Buch findr finden Sie Romane, Ratgeber, wissenschaftliche und
populärwissenschaftliche Bücher uvm. Bestellen Sie Ihr Buch zu Ihrem Thema einfach online und lassen Sie es sich
bequem nach Hause schicken. Wir wünschen Ihnen schöne und entspannte Lesemomente mit Ihrem Buch
von Jantschek, Ole .
Jantschek, Ole - Große Auswahl an Publikationen bei Buch findr
Bei uns finden Sie Bücher aller beliebter Autoren, Neuerscheinungen, Bestseller genauso wie alte Schätze. Bücher
von Jantschek, Ole die Ihre Fantasie anregen und Bücher, die Sie weiterbilden und Ihnen wissenschaftliche Fakten
vermitteln. Ganz nach Ihrem Geschmack ist das passende Buch für Sie dabei. Finden Sie eine große Auswahl Bücher
verschiedenster Genres, Verlage, Schlagworte Genre bei Buchfindr:
Unser Repertoire umfasst Bücher von
- Jantscher, Anna
- Jantscher, Christine
- Jantscher, Elke
- Jantscher, Heidrun
- Jantscher, Lothar
- Jantscher, Markus
- Jantscher, Reinhard
- Jantschgi, Gerit Katrin
- Jantschgi, Gottfried
- Jäntschi, Katharina
Sie haben viele Möglichkeiten bei Buch findr die passenden Bücher für Ihr Lesevergnügen zu entdecken. Nutzen Sie
unsere Suchfunktionen, um zu stöbern und für Sie interessante Bücher in den unterschiedlichen Genres und Kategorien
zu finden. Neben Büchern von Jantschek, Ole und Büchern aus verschiedenen Kategorien finden Sie schnell und
einfach auch eine Auflistung thematisch passender Publikationen. Probieren Sie es aus, legen Sie jetzt los! Ihrem
Lesevergnügen steht nichts im Wege. Nutzen Sie die Vorteile Ihre Bücher online zu kaufen und bekommen Sie die
bestellten Bücher schnell und bequem zugestellt. Nehmen Sie sich die Zeit, online die Bücher Ihrer Wahl anzulesen,
Buchempfehlungen und Rezensionen zu studieren, Informationen zu Autoren zu lesen. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
das Team von Buchfindr.