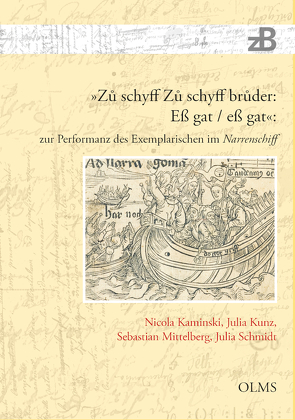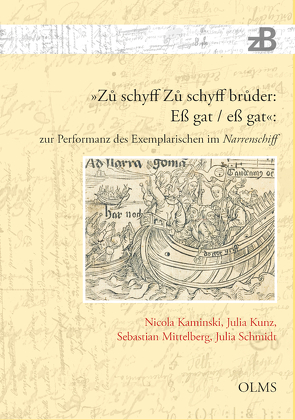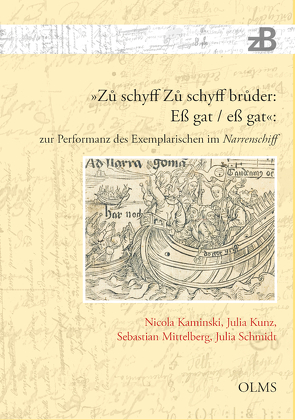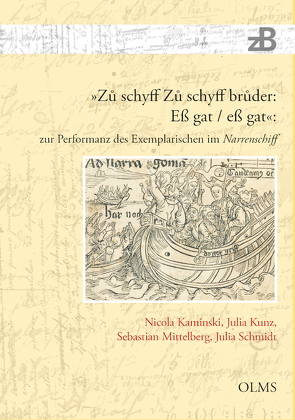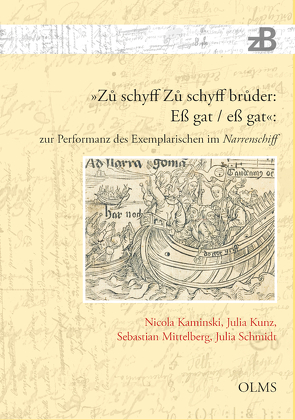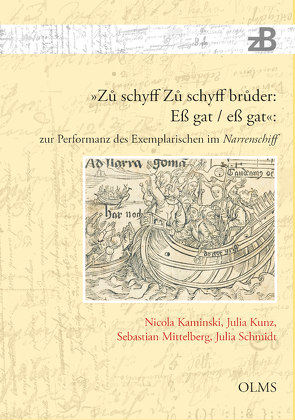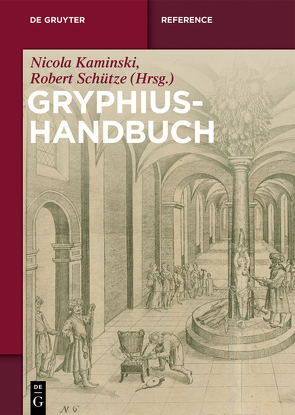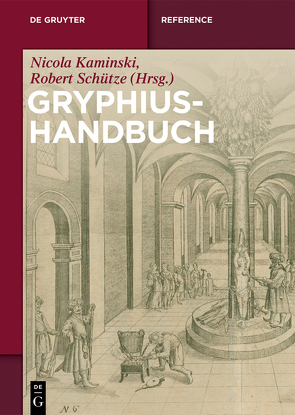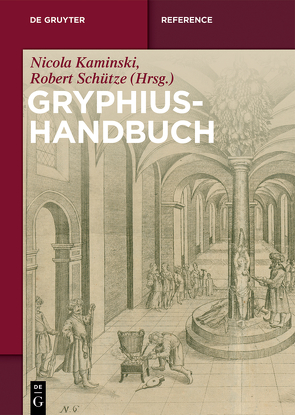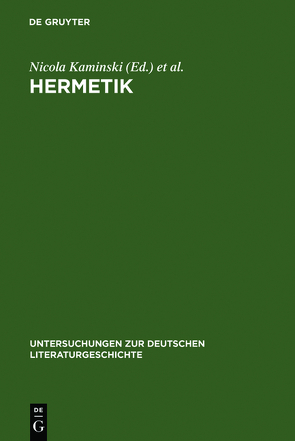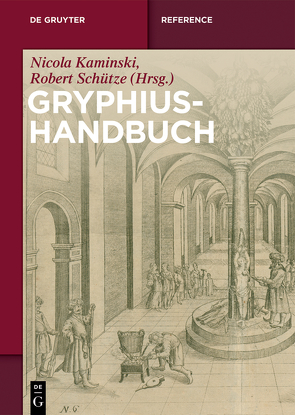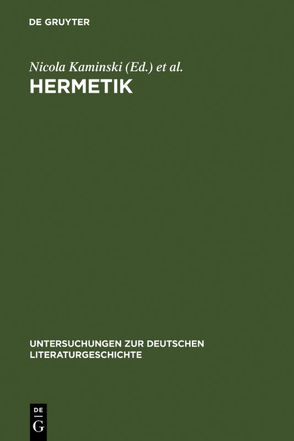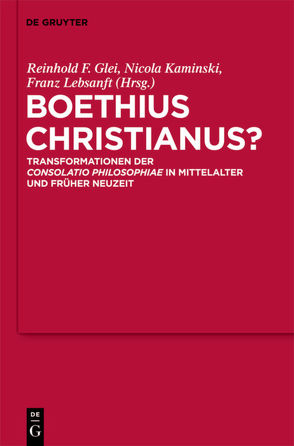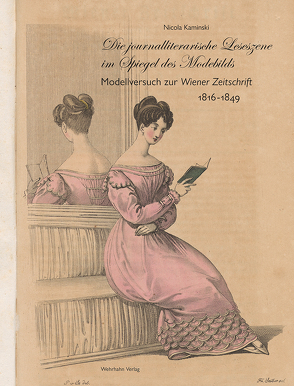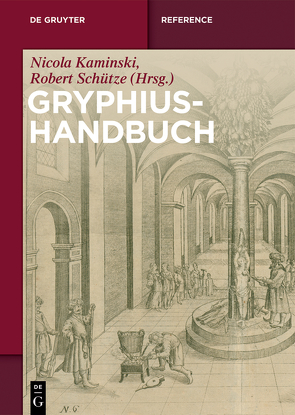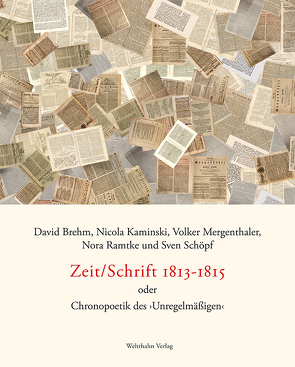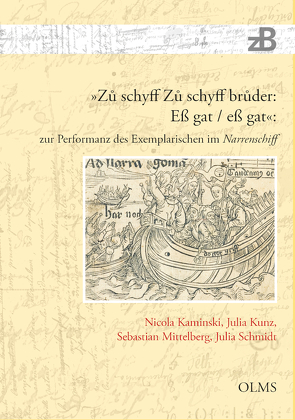
Fragt man, aus was für einem Material 1494 Sebastian Brant »diß schiff gezymberet« hat, so wird die Antwort lauten müssen: aus Exempeln. Das Narrenschiff zählt nicht weniger als 471 Exempel. Dennoch hat die Forschung diesem ›Baumaterial‹ bislang wenig systematische Aufmerksamkeit geschenkt. Beispiele, exempla, sind für Texte, die rhetorisch etwas bewirken wollen (belehren, appellieren, warnen), unverzichtbare Bestandteile der Argumentation. Gleichzeitig haben sie aber die Tendenz, sich in der Veranschaulichung eines Allgemeinen unter der Hand zu verselbständigen. Was nun aber, wenn ein programmatisch moraldidaktischer Text seine Rede zum aus Beispielen gezimmerten Schiff formt, die Rezeption als Fahrt darauf inszeniert – und dann die exemplarischen Planken zu arbeiten beginnen, in Spannung zueinander treten, aus den Fugen gehen?
Eine solche Lektürefahrt auf dem Narrenschiff unternimmt der erste Sonderband der »z.B. Zeitschrift zum Beispiel«: im Kielwasser des Irrfahrers Odysseus, hin und her geworfen zwischen Schrift und vexierend sich wiederholenden Bildern, genarrt von der Weisheit an Bord und zuletzt gar dem in den Bordüren zu findenden Autor »Sebastianus Brant« – und immer und immer wieder konfrontiert mit dem Eigensinn der Exempel.
Aktualisiert: 2023-06-30
> findR *
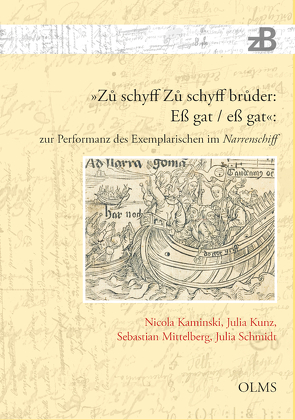
Fragt man, aus was für einem Material 1494 Sebastian Brant »diß schiff gezymberet« hat, so wird die Antwort lauten müssen: aus Exempeln. Das Narrenschiff zählt nicht weniger als 471 Exempel. Dennoch hat die Forschung diesem ›Baumaterial‹ bislang wenig systematische Aufmerksamkeit geschenkt. Beispiele, exempla, sind für Texte, die rhetorisch etwas bewirken wollen (belehren, appellieren, warnen), unverzichtbare Bestandteile der Argumentation. Gleichzeitig haben sie aber die Tendenz, sich in der Veranschaulichung eines Allgemeinen unter der Hand zu verselbständigen. Was nun aber, wenn ein programmatisch moraldidaktischer Text seine Rede zum aus Beispielen gezimmerten Schiff formt, die Rezeption als Fahrt darauf inszeniert – und dann die exemplarischen Planken zu arbeiten beginnen, in Spannung zueinander treten, aus den Fugen gehen?
Eine solche Lektürefahrt auf dem Narrenschiff unternimmt der erste Sonderband der »z.B. Zeitschrift zum Beispiel«: im Kielwasser des Irrfahrers Odysseus, hin und her geworfen zwischen Schrift und vexierend sich wiederholenden Bildern, genarrt von der Weisheit an Bord und zuletzt gar dem in den Bordüren zu findenden Autor »Sebastianus Brant« – und immer und immer wieder konfrontiert mit dem Eigensinn der Exempel.
Aktualisiert: 2023-06-30
> findR *
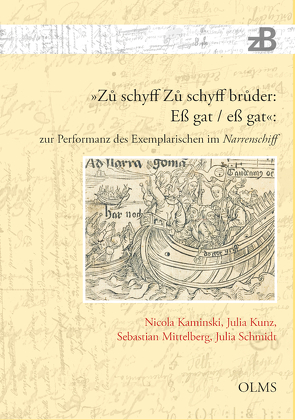
Fragt man, aus was für einem Material 1494 Sebastian Brant »diß schiff gezymberet« hat, so wird die Antwort lauten müssen: aus Exempeln. Das Narrenschiff zählt nicht weniger als 471 Exempel. Dennoch hat die Forschung diesem ›Baumaterial‹ bislang wenig systematische Aufmerksamkeit geschenkt. Beispiele, exempla, sind für Texte, die rhetorisch etwas bewirken wollen (belehren, appellieren, warnen), unverzichtbare Bestandteile der Argumentation. Gleichzeitig haben sie aber die Tendenz, sich in der Veranschaulichung eines Allgemeinen unter der Hand zu verselbständigen. Was nun aber, wenn ein programmatisch moraldidaktischer Text seine Rede zum aus Beispielen gezimmerten Schiff formt, die Rezeption als Fahrt darauf inszeniert – und dann die exemplarischen Planken zu arbeiten beginnen, in Spannung zueinander treten, aus den Fugen gehen?
Eine solche Lektürefahrt auf dem Narrenschiff unternimmt der erste Sonderband der »z.B. Zeitschrift zum Beispiel«: im Kielwasser des Irrfahrers Odysseus, hin und her geworfen zwischen Schrift und vexierend sich wiederholenden Bildern, genarrt von der Weisheit an Bord und zuletzt gar dem in den Bordüren zu findenden Autor »Sebastianus Brant« – und immer und immer wieder konfrontiert mit dem Eigensinn der Exempel.
Aktualisiert: 2023-06-30
> findR *
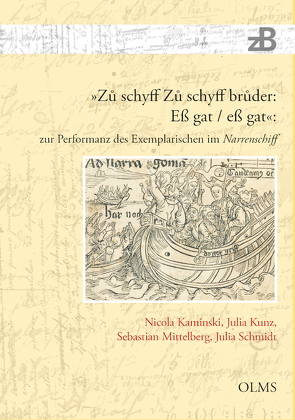
Fragt man, aus was für einem Material 1494 Sebastian Brant »diß schiff gezymberet« hat, so wird die Antwort lauten müssen: aus Exempeln. Das Narrenschiff zählt nicht weniger als 471 Exempel. Dennoch hat die Forschung diesem ›Baumaterial‹ bislang wenig systematische Aufmerksamkeit geschenkt. Beispiele, exempla, sind für Texte, die rhetorisch etwas bewirken wollen (belehren, appellieren, warnen), unverzichtbare Bestandteile der Argumentation. Gleichzeitig haben sie aber die Tendenz, sich in der Veranschaulichung eines Allgemeinen unter der Hand zu verselbständigen. Was nun aber, wenn ein programmatisch moraldidaktischer Text seine Rede zum aus Beispielen gezimmerten Schiff formt, die Rezeption als Fahrt darauf inszeniert – und dann die exemplarischen Planken zu arbeiten beginnen, in Spannung zueinander treten, aus den Fugen gehen?
Eine solche Lektürefahrt auf dem Narrenschiff unternimmt der erste Sonderband der »z.B. Zeitschrift zum Beispiel«: im Kielwasser des Irrfahrers Odysseus, hin und her geworfen zwischen Schrift und vexierend sich wiederholenden Bildern, genarrt von der Weisheit an Bord und zuletzt gar dem in den Bordüren zu findenden Autor »Sebastianus Brant« – und immer und immer wieder konfrontiert mit dem Eigensinn der Exempel.
Aktualisiert: 2023-06-29
> findR *
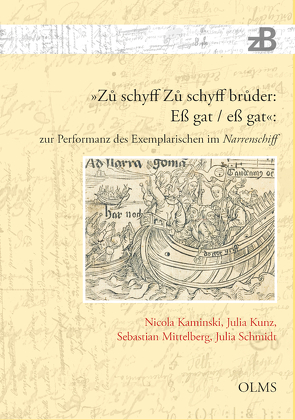
Fragt man, aus was für einem Material 1494 Sebastian Brant »diß schiff gezymberet« hat, so wird die Antwort lauten müssen: aus Exempeln. Das Narrenschiff zählt nicht weniger als 471 Exempel. Dennoch hat die Forschung diesem ›Baumaterial‹ bislang wenig systematische Aufmerksamkeit geschenkt. Beispiele, exempla, sind für Texte, die rhetorisch etwas bewirken wollen (belehren, appellieren, warnen), unverzichtbare Bestandteile der Argumentation. Gleichzeitig haben sie aber die Tendenz, sich in der Veranschaulichung eines Allgemeinen unter der Hand zu verselbständigen. Was nun aber, wenn ein programmatisch moraldidaktischer Text seine Rede zum aus Beispielen gezimmerten Schiff formt, die Rezeption als Fahrt darauf inszeniert – und dann die exemplarischen Planken zu arbeiten beginnen, in Spannung zueinander treten, aus den Fugen gehen?
Eine solche Lektürefahrt auf dem Narrenschiff unternimmt der erste Sonderband der »z.B. Zeitschrift zum Beispiel«: im Kielwasser des Irrfahrers Odysseus, hin und her geworfen zwischen Schrift und vexierend sich wiederholenden Bildern, genarrt von der Weisheit an Bord und zuletzt gar dem in den Bordüren zu findenden Autor »Sebastianus Brant« – und immer und immer wieder konfrontiert mit dem Eigensinn der Exempel.
Aktualisiert: 2023-06-29
> findR *
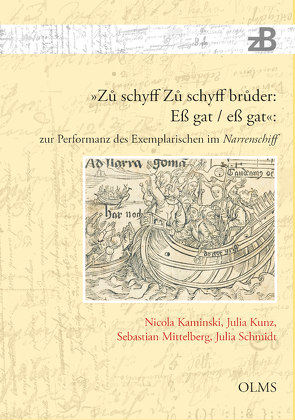
Fragt man, aus was für einem Material 1494 Sebastian Brant »diß schiff gezymberet« hat, so wird die Antwort lauten müssen: aus Exempeln. Das Narrenschiff zählt nicht weniger als 471 Exempel. Dennoch hat die Forschung diesem ›Baumaterial‹ bislang wenig systematische Aufmerksamkeit geschenkt. Beispiele, exempla, sind für Texte, die rhetorisch etwas bewirken wollen (belehren, appellieren, warnen), unverzichtbare Bestandteile der Argumentation. Gleichzeitig haben sie aber die Tendenz, sich in der Veranschaulichung eines Allgemeinen unter der Hand zu verselbständigen. Was nun aber, wenn ein programmatisch moraldidaktischer Text seine Rede zum aus Beispielen gezimmerten Schiff formt, die Rezeption als Fahrt darauf inszeniert – und dann die exemplarischen Planken zu arbeiten beginnen, in Spannung zueinander treten, aus den Fugen gehen?
Eine solche Lektürefahrt auf dem Narrenschiff unternimmt der erste Sonderband der »z.B. Zeitschrift zum Beispiel«: im Kielwasser des Irrfahrers Odysseus, hin und her geworfen zwischen Schrift und vexierend sich wiederholenden Bildern, genarrt von der Weisheit an Bord und zuletzt gar dem in den Bordüren zu findenden Autor »Sebastianus Brant« – und immer und immer wieder konfrontiert mit dem Eigensinn der Exempel.
Aktualisiert: 2023-06-29
> findR *
Fünfzehn Beiträge, die zwischen 1999 und 2002 auf vier Akademie-Tagungen vorgetragen wurden.
Aktualisiert: 2023-06-28
Autor:
Doris Carl,
Ludger Grenzmann,
Klaus Grubmüller,
Bodo Guthmüller,
Christian Hannick,
Ulrike Heinrichs-Schreiber,
Johannes Helmrath,
Nicola Kaminski,
Bernd Moeller,
Ulrich Muhlack,
Wilfried Nippel,
Fidel Rädle,
Volker Reinhardt,
Johannes Schilling,
Peter Schreiner,
Martin Staehelin,
Gregor Vogt-Spira,
Franz Josef Worstbrock
Fünfzehn Beiträge, die zwischen 1999 und 2002 auf vier Akademie-Tagungen vorgetragen wurden.
Aktualisiert: 2023-06-28
Autor:
Doris Carl,
Ludger Grenzmann,
Klaus Grubmüller,
Bodo Guthmüller,
Christian Hannick,
Ulrike Heinrichs-Schreiber,
Johannes Helmrath,
Nicola Kaminski,
Bernd Moeller,
Ulrich Muhlack,
Wilfried Nippel,
Fidel Rädle,
Volker Reinhardt,
Johannes Schilling,
Peter Schreiner,
Martin Staehelin,
Gregor Vogt-Spira,
Franz Josef Worstbrock
Aktualisiert: 2023-05-29
> findR *

Die Trostschrift an sich selbst, die der Politiker und Philosoph Boethius (ca. 480‑524 n.Chr.) kurz vor seiner Hinrichtung verfasste, gilt neben den Bekenntnissen des Augustinus als das berühmteste Werk der christlichen Spätantike. Weil Boethius als christlicher Märtyrer kanonisiert wurde, erfuhr auch sein Werk, die Consolatio Philosophiae, im Mittelalter eine christliche Umdeutung und führte zu einer außerordentlich intensiven Rezeption, die nicht nur durch die eindrucksvolle Zahl von über 400 Handschriften und ca. 20, zum Teil sehr umfangreiche lateinische Kommentare belegt ist, sondern auch durch Übersetzungen in verschiedene Volkssprachen. Mit einer erstaunlichen religiösen ‚Wandlungsfähigkeit‘ meisterte der Text dann die am Beginn der Renaissance einsetzende Krise der als ‚mittelalterlich‘ geltenden Literatur, wurde aber durch den ent-christianisierenden und re-antikisierenden Kommentar des Josse Bade (1498) für die Humanisten salonfähig gemacht. Im 17. Jahrhundert wurde Boethius dann erneut ‚christianisiert‘, genauer: konfessionalisiert, d.h. für den Diskurs des konfessionellen Zeitalters funktionalisiert. Die vielfältigen Aspekte dieser mittelalterlich-christlichen, humanistischen und konfessionellen Vereinnahmung werden in den Beiträgen des Sammelbandes analysiert und eröffnen eine diachrone, epochenübergreifende Perspektive.
Aktualisiert: 2023-05-29
> findR *
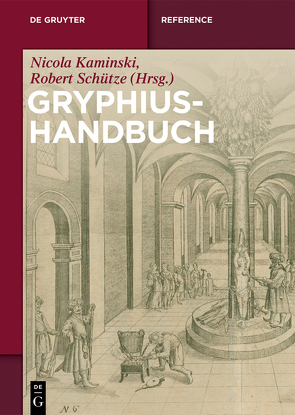
Unter den Autoren des 17. Jahrhunderts gehört Andreas Gryphius zweifellos zu den am besten erforschten. Seit der großen Konjunktur der Barockforschung in den 1960er und 70er Jahren hat sich monographisch und in Aufsätzen eine facettenreiche Forschungslandschaft entwickelt. Die Anstrengung einer umfassenden Gesamtdarstellung zu Leben und Werk ist hingegen nicht mehr unternommen worden. Auf dieses Desiderat reagiert das Gryphius-Handbuch in mehrfacher Hinsicht: Als autonom benutzbarer Überblick informiert es, forschungsgeschichtlich perspektiviert, auf dem Stand der aktuellen Forschungsdiskussion zu Autor und Werk sowie zu deren zeitgenössischer wie nachfolgender Rezeption. Zugleich erproben die 38 textzentrierten Kapitel des plural angelegten Handbuchs das Erschließungspotential auch neuerer literatur- und diskurstheoretischer Ansätze. Strukturgebend ist die Kombination von Textzentriertheit und systematischer Verstrebung: Komplementär zu den Lektüren einzelner Werke oder Werkgruppen eröffnet das umfangreiche alphabetisch organisierte Kapitel »Systematische Aspekte« in zwölf Einträgen Perspektiven zu poetologischen Konzepten und historischen Rahmenbedingungen, wie sie für Gryphius’ Schreiben maßgeblich sind. Gegenüber der älteren Forschungstradition, sich auf wenige kanonische Sonette, Trauer- und Lustspiele zu konzentrieren, erweitern Artikel zu den Leichabdankungen, Oden, Übersetzungen und Bearbeitungen das Referenzcorpus beträchtlich. Dabei zeigt sich: auch diesen Texten ist eine eigene Ästhetik zuzutrauen, die sich gegenüber geschlossenen Deutungssystemen als durchaus widerständig erweist.
Aktualisiert: 2023-05-29
> findR *
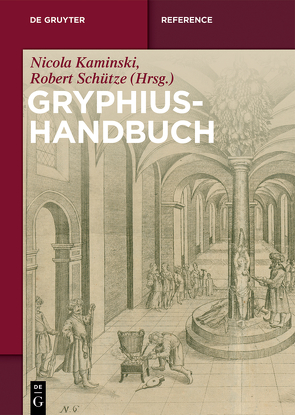
Unter den Autoren des 17. Jahrhunderts gehört Andreas Gryphius zweifellos zu den am besten erforschten. Seit der großen Konjunktur der Barockforschung in den 1960er und 70er Jahren hat sich monographisch und in Aufsätzen eine facettenreiche Forschungslandschaft entwickelt. Die Anstrengung einer umfassenden Gesamtdarstellung zu Leben und Werk ist hingegen nicht mehr unternommen worden. Auf dieses Desiderat reagiert das Gryphius-Handbuch in mehrfacher Hinsicht: Als autonom benutzbarer Überblick informiert es, forschungsgeschichtlich perspektiviert, auf dem Stand der aktuellen Forschungsdiskussion zu Autor und Werk sowie zu deren zeitgenössischer wie nachfolgender Rezeption. Zugleich erproben die 38 textzentrierten Kapitel des plural angelegten Handbuchs das Erschließungspotential auch neuerer literatur- und diskurstheoretischer Ansätze. Strukturgebend ist die Kombination von Textzentriertheit und systematischer Verstrebung: Komplementär zu den Lektüren einzelner Werke oder Werkgruppen eröffnet das umfangreiche alphabetisch organisierte Kapitel »Systematische Aspekte« in zwölf Einträgen Perspektiven zu poetologischen Konzepten und historischen Rahmenbedingungen, wie sie für Gryphius’ Schreiben maßgeblich sind. Gegenüber der älteren Forschungstradition, sich auf wenige kanonische Sonette, Trauer- und Lustspiele zu konzentrieren, erweitern Artikel zu den Leichabdankungen, Oden, Übersetzungen und Bearbeitungen das Referenzcorpus beträchtlich. Dabei zeigt sich: auch diesen Texten ist eine eigene Ästhetik zuzutrauen, die sich gegenüber geschlossenen Deutungssystemen als durchaus widerständig erweist.
Aktualisiert: 2023-05-29
> findR *
Die Buchreihe Untersuchungen zur deutschen Literaturgeschichte deckt das gesamte Spektrum der germanistischen Literaturforschung ab und umfasst Monographien und Sammelbände über einzelne Epochen vom ausgehenden Mittelalter bis zur Gegenwart. Sie versammelt Beiträge zur Erklärung zentraler Begriffe der Literaturgeschichte, zu einzelnen Autoren und Werken.
Aktualisiert: 2023-05-29
> findR *
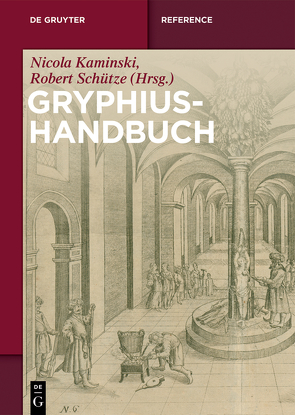
Unter den Autoren des 17. Jahrhunderts gehört Andreas Gryphius zweifellos zu den am besten erforschten. Seit der großen Konjunktur der Barockforschung in den 1960er und 70er Jahren hat sich monographisch und in Aufsätzen eine facettenreiche Forschungslandschaft entwickelt. Die Anstrengung einer umfassenden Gesamtdarstellung zu Leben und Werk ist hingegen nicht mehr unternommen worden. Auf dieses Desiderat reagiert das Gryphius-Handbuch in mehrfacher Hinsicht: Als autonom benutzbarer Überblick informiert es, forschungsgeschichtlich perspektiviert, auf dem Stand der aktuellen Forschungsdiskussion zu Autor und Werk sowie zu deren zeitgenössischer wie nachfolgender Rezeption. Zugleich erproben die 38 textzentrierten Kapitel des plural angelegten Handbuchs das Erschließungspotential auch neuerer literatur- und diskurstheoretischer Ansätze. Strukturgebend ist die Kombination von Textzentriertheit und systematischer Verstrebung: Komplementär zu den Lektüren einzelner Werke oder Werkgruppen eröffnet das umfangreiche alphabetisch organisierte Kapitel »Systematische Aspekte« in zwölf Einträgen Perspektiven zu poetologischen Konzepten und historischen Rahmenbedingungen, wie sie für Gryphius’ Schreiben maßgeblich sind. Gegenüber der älteren Forschungstradition, sich auf wenige kanonische Sonette, Trauer- und Lustspiele zu konzentrieren, erweitern Artikel zu den Leichabdankungen, Oden, Übersetzungen und Bearbeitungen das Referenzcorpus beträchtlich. Dabei zeigt sich: auch diesen Texten ist eine eigene Ästhetik zuzutrauen, die sich gegenüber geschlossenen Deutungssystemen als durchaus widerständig erweist.
Aktualisiert: 2023-05-29
> findR *
Die Buchreihe Untersuchungen zur deutschen Literaturgeschichte deckt das gesamte Spektrum der germanistischen Literaturforschung ab und umfasst Monographien und Sammelbände über einzelne Epochen vom ausgehenden Mittelalter bis zur Gegenwart. Sie versammelt Beiträge zur Erklärung zentraler Begriffe der Literaturgeschichte, zu einzelnen Autoren und Werken.
Aktualisiert: 2023-05-29
> findR *
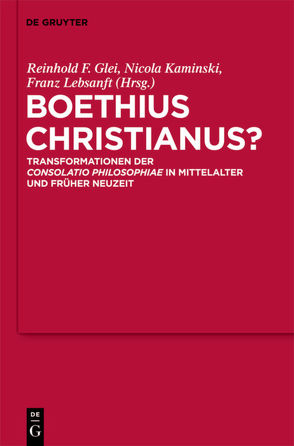
Die Trostschrift an sich selbst, die der Politiker und Philosoph Boethius (ca. 480‑524 n.Chr.) kurz vor seiner Hinrichtung verfasste, gilt neben den Bekenntnissen des Augustinus als das berühmteste Werk der christlichen Spätantike. Weil Boethius als christlicher Märtyrer kanonisiert wurde, erfuhr auch sein Werk, die Consolatio Philosophiae, im Mittelalter eine christliche Umdeutung und führte zu einer außerordentlich intensiven Rezeption, die nicht nur durch die eindrucksvolle Zahl von über 400 Handschriften und ca. 20, zum Teil sehr umfangreiche lateinische Kommentare belegt ist, sondern auch durch Übersetzungen in verschiedene Volkssprachen. Mit einer erstaunlichen religiösen ‚Wandlungsfähigkeit‘ meisterte der Text dann die am Beginn der Renaissance einsetzende Krise der als ‚mittelalterlich‘ geltenden Literatur, wurde aber durch den ent-christianisierenden und re-antikisierenden Kommentar des Josse Bade (1498) für die Humanisten salonfähig gemacht. Im 17. Jahrhundert wurde Boethius dann erneut ‚christianisiert‘, genauer: konfessionalisiert, d.h. für den Diskurs des konfessionellen Zeitalters funktionalisiert. Die vielfältigen Aspekte dieser mittelalterlich-christlichen, humanistischen und konfessionellen Vereinnahmung werden in den Beiträgen des Sammelbandes analysiert und eröffnen eine diachrone, epochenübergreifende Perspektive.
Aktualisiert: 2023-05-29
> findR *
Fünfzehn Beiträge, die zwischen 1999 und 2002 auf vier Akademie-Tagungen vorgetragen wurden.
Aktualisiert: 2023-05-28
Autor:
Doris Carl,
Ludger Grenzmann,
Klaus Grubmüller,
Bodo Guthmüller,
Christian Hannick,
Ulrike Heinrichs-Schreiber,
Johannes Helmrath,
Nicola Kaminski,
Bernd Moeller,
Ulrich Muhlack,
Wilfried Nippel,
Fidel Rädle,
Volker Reinhardt,
Johannes Schilling,
Peter Schreiner,
Martin Staehelin,
Gregor Vogt-Spira,
Franz Josef Worstbrock
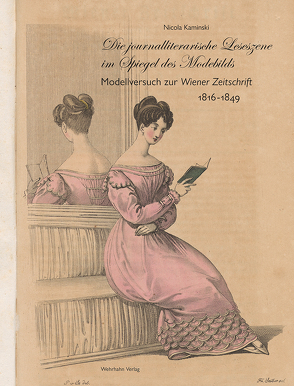
Klappentext
Wie läßt etwas so Flüchtiges, als der Blick des Lesers, der Leserin aufs bedruckte Papier ist, sich einfangen? Und wohl gar analysieren? — Das vorliegende Buch behauptet, daß er (wie das Licht) sich material an etwas brechen muß, um reflektiert werden zu können, und daß die (im Wortsinn) ephemere Druckmaterialität journalförmiger Publikationsmedien mit ihren geregelten Unterbrechungsrhythmen ihm eher zum Spiegel werden kann als das (in der Regel) gebunden auf einmal ausgelieferte Werkdruckkontinuum des Buchs. Gerade die im Journal nicht selten den Rezeptionsmodus unterbrechende Differenz zwischen Schrift und Bild(beilagen) öffnet den reflexiven Spielraum für Leseszenen, die den Leser zu involvieren suchen: lesend, schauend, durch mediale Handhabung.
Das ist, in wenigen Strichen angedeutet, der systematische Horizont, vor dem dies Buch seine Protagonistin, die Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode (1816-1849), auftreten läßt, um am Beispiel zu erproben, wohin solche Fragen führen (ob sie wohin führen). Die Bühne ist das publizistische Umfeld der Wiener Zeitschrift und ihrer wöchentlichen Modekupfer, in Wien, aber auch in Graz, in Leipzig, in Frankfurt, in Paris und vor allem in Ofen und Pesth. Zur Bühne wird es, weil die Wiener Zeitschrift den zeitgenössisch gängigen wortlosen Kommunikationsmodus unrechtmäßigen Nachstichs ihrer Kupfer ein ums andere Mal aufbricht: ihre Leserinnen und Leser implizit und explizit, in Bild und Schrift in mediale Konstellationen verwickelt, sie zu vergleichendem Lesen und Schauen provoziert – und sie dabei der eigenen Lektüre gewahr werden läßt.
Aktualisiert: 2023-05-04
> findR *
Aktualisiert: 2023-03-28
> findR *
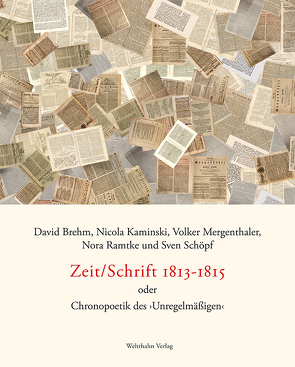
Als von Frühjahr 1813 an, beginnend mit Preußen, die deutschen Territorien sich sukzessive von der französischen Herrschaft befreien und bis zum Sommer und Herbst des Jahres allmählich sich eine politisch-militärische Allianz gegen Napoleon formiert, wird all dies vielerorts publizistisch begleitet: in Berlin, in Altenburg und Leipzig, in Freiburg im Breisgau, in Koblenz, in Wien, ja die preußische Feldbuchdruckerei folgt der Armee der Alliierten nach dem Rheinübergang im Dezember 1813 sogar nach Frankreich bis zum Einzug in Paris. Gemeinsam ist diesen neu entstehenden, zwischen Zeitung und Zeitschrift changierenden deutschsprachigen Blättern, daß sie in den Freiräumen, die sich zeitweilig in den machtpolitisch unübersichtlichen Verhältnissen 1813–1815 gegenüber der Normalität von Zensur eröffnen, relativ spontan und meist kurzlebig diskontinuierliche Zeiterfahrung zu verschriften suchen und dabei mit der seriellen Normalität von Journal experimentieren. Was daraus für die typographische Materialität, die textuelle Kohärenz und für die Periodizität von Journal resultiert, läßt sich auf den Begriff einer Chronopoetik des ›Unregelmäßigen‹ bringen.
Solchen Inszenierungen von als unregelmäßig erfahrener Zeit durch performative Regelverstöße im Druckmedium selbst läßt sich analytisch adäquat nicht mit der Systematik einer wissenschaftlichen Abhandlung begegnen, ohne daß Wesentliches auf der Strecke bliebe. Die Konsequenz ist die Entscheidung für ein experimentelles: ein ›zeitungsförmiges‹ Buch.
Aktualisiert: 2022-09-15
> findR *
MEHR ANZEIGEN
Bücher von Kaminski, Nicola
Sie suchen ein Buch oder Publikation vonKaminski, Nicola ? Bei Buch findr finden Sie alle Bücher Kaminski, Nicola.
Entdecken Sie neue Bücher oder Klassiker für Sie selbst oder zum Verschenken. Buch findr hat zahlreiche Bücher
von Kaminski, Nicola im Sortiment. Nehmen Sie sich Zeit zum Stöbern und finden Sie das passende Buch oder die
Publiketion für Ihr Lesevergnügen oder Ihr Interessensgebiet. Stöbern Sie durch unser Angebot und finden Sie aus
unserer großen Auswahl das Buch, das Ihnen zusagt. Bei Buch findr finden Sie Romane, Ratgeber, wissenschaftliche und
populärwissenschaftliche Bücher uvm. Bestellen Sie Ihr Buch zu Ihrem Thema einfach online und lassen Sie es sich
bequem nach Hause schicken. Wir wünschen Ihnen schöne und entspannte Lesemomente mit Ihrem Buch
von Kaminski, Nicola .
Kaminski, Nicola - Große Auswahl an Publikationen bei Buch findr
Bei uns finden Sie Bücher aller beliebter Autoren, Neuerscheinungen, Bestseller genauso wie alte Schätze. Bücher
von Kaminski, Nicola die Ihre Fantasie anregen und Bücher, die Sie weiterbilden und Ihnen wissenschaftliche Fakten
vermitteln. Ganz nach Ihrem Geschmack ist das passende Buch für Sie dabei. Finden Sie eine große Auswahl Bücher
verschiedenster Genres, Verlage, Schlagworte Genre bei Buchfindr:
Unser Repertoire umfasst Bücher von
- Kaminskij, Herausgegeben von Konstantin
- Kaminskij, Konstantin
- Kaminskin, Anna
- Kaminskiy, Vitaliy
- Kaminsky, Anke
- Kaminsky, Anna
- Kaminsky, Anne
- Kaminsky, Annette
- Kaminsky, B.
- Kaminsky, Bianca
Sie haben viele Möglichkeiten bei Buch findr die passenden Bücher für Ihr Lesevergnügen zu entdecken. Nutzen Sie
unsere Suchfunktionen, um zu stöbern und für Sie interessante Bücher in den unterschiedlichen Genres und Kategorien
zu finden. Neben Büchern von Kaminski, Nicola und Büchern aus verschiedenen Kategorien finden Sie schnell und
einfach auch eine Auflistung thematisch passender Publikationen. Probieren Sie es aus, legen Sie jetzt los! Ihrem
Lesevergnügen steht nichts im Wege. Nutzen Sie die Vorteile Ihre Bücher online zu kaufen und bekommen Sie die
bestellten Bücher schnell und bequem zugestellt. Nehmen Sie sich die Zeit, online die Bücher Ihrer Wahl anzulesen,
Buchempfehlungen und Rezensionen zu studieren, Informationen zu Autoren zu lesen. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
das Team von Buchfindr.