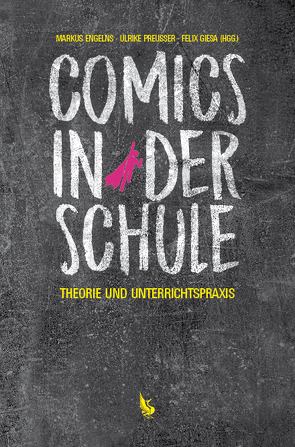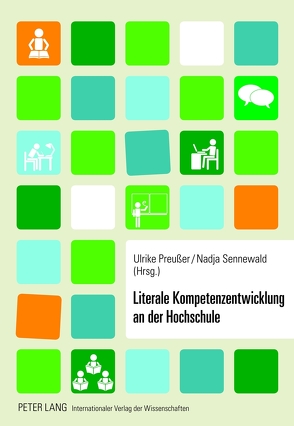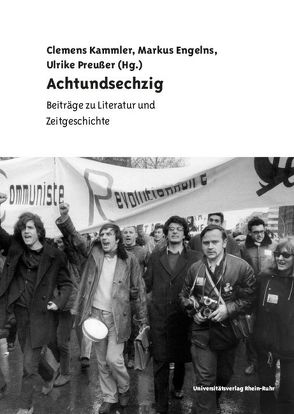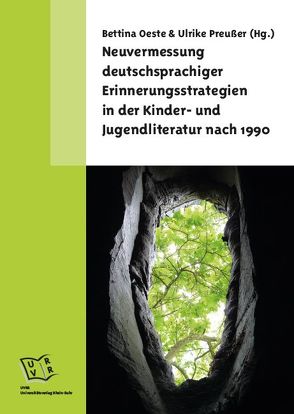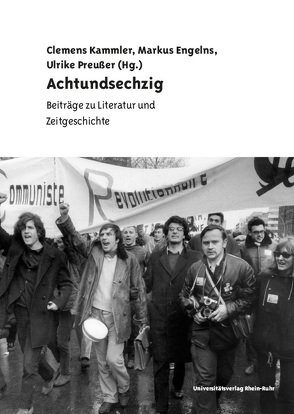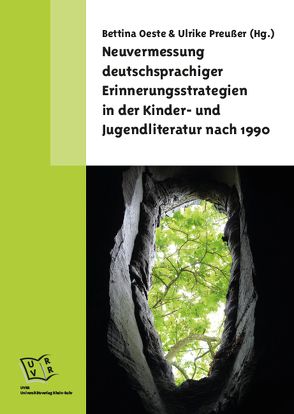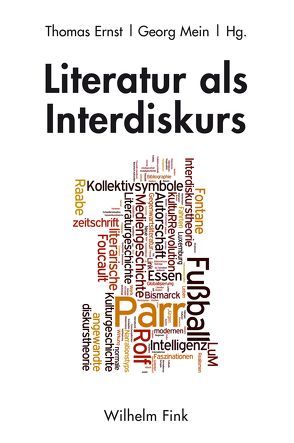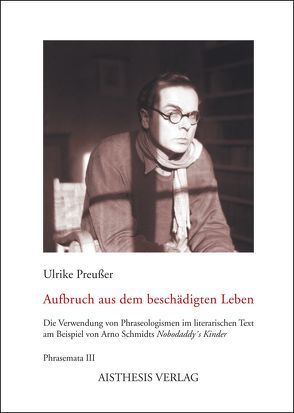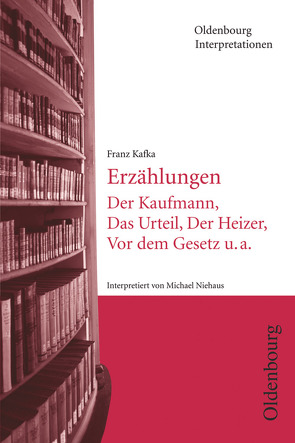Der Austausch zwischen Medienwissenschaft und Mediendidaktik ist zumindest in einer Richtung recht selbstverständlich. MediendidaktikerInnen wie -pädagogInnen nehmen natürlich zur Kenntnis, worüber die Medienwissenschaft forscht. Keine Einführung in die Mediendidaktik kann ohne Ausführungen zum Medienbegriff im Allgemeinen, zur Mediengeschichte oder zu Fragen der Medienkritik auskommen.
Umgekehrt besteht jedoch der begründete Verdacht, dass es weniger selbstverständlich ist, dass sich die Medienwissenschaft auf die Mediendidaktik bezieht. Dies ist insbesondere verwunderlich, da sich die Medienwissenschaft doch eigentlich für Vermittlungsfragen aller Art zuständig halten müsste und daher gerade auch für diejenigen, mit denen es die Mediendidaktik zu tun hat. Diesen Austausch soll der vorliegende Band intensivieren, indem er medienwissenschaftliche und mediendidaktische Aufsätze sowie Stimmen aus der schulischen Praxis versammelt, die aus unterschiedlichen Perspektiven über die Zukunft des Deutschunterrichts reflektieren.
Aktualisiert: 2023-06-24
Autor:
Achim Barsch,
Christian Dawidowski,
Till Dembeck,
Markus Engelns,
Hendrick Heimböckel,
Nathalie Jacoby,
Magdalena Kißling,
Georg Mein,
Christoph Müller,
Jennifer Pavlik,
Ulrike Preußer,
Camille Weyrich

Der Austausch zwischen Medienwissenschaft und Mediendidaktik ist zumindest in einer Richtung recht selbstverständlich. MediendidaktikerInnen wie -pädagogInnen nehmen natürlich zur Kenntnis, worüber die Medienwissenschaft forscht. Keine Einführung in die Mediendidaktik kann ohne Ausführungen zum Medienbegriff im Allgemeinen, zur Mediengeschichte oder zu Fragen der Medienkritik auskommen.
Umgekehrt besteht jedoch der begründete Verdacht, dass es weniger selbstverständlich ist, dass sich die Medienwissenschaft auf die Mediendidaktik bezieht. Dies ist insbesondere verwunderlich, da sich die Medienwissenschaft doch eigentlich für Vermittlungsfragen aller Art zuständig halten müsste und daher gerade auch für diejenigen, mit denen es die Mediendidaktik zu tun hat. Diesen Austausch soll der vorliegende Band intensivieren, indem er medienwissenschaftliche und mediendidaktische Aufsätze sowie Stimmen aus der schulischen Praxis versammelt, die aus unterschiedlichen Perspektiven über die Zukunft des Deutschunterrichts reflektieren.
Aktualisiert: 2023-06-24
Autor:
Achim Barsch,
Christian Dawidowski,
Till Dembeck,
Markus Engelns,
Hendrick Heimböckel,
Nathalie Jacoby,
Magdalena Kißling,
Georg Mein,
Christoph Müller,
Jennifer Pavlik,
Ulrike Preußer,
Camille Weyrich

Der Austausch zwischen Medienwissenschaft und Mediendidaktik ist zumindest in einer Richtung recht selbstverständlich. MediendidaktikerInnen wie -pädagogInnen nehmen natürlich zur Kenntnis, worüber die Medienwissenschaft forscht. Keine Einführung in die Mediendidaktik kann ohne Ausführungen zum Medienbegriff im Allgemeinen, zur Mediengeschichte oder zu Fragen der Medienkritik auskommen.
Umgekehrt besteht jedoch der begründete Verdacht, dass es weniger selbstverständlich ist, dass sich die Medienwissenschaft auf die Mediendidaktik bezieht. Dies ist insbesondere verwunderlich, da sich die Medienwissenschaft doch eigentlich für Vermittlungsfragen aller Art zuständig halten müsste und daher gerade auch für diejenigen, mit denen es die Mediendidaktik zu tun hat. Diesen Austausch soll der vorliegende Band intensivieren, indem er medienwissenschaftliche und mediendidaktische Aufsätze sowie Stimmen aus der schulischen Praxis versammelt, die aus unterschiedlichen Perspektiven über die Zukunft des Deutschunterrichts reflektieren.
Aktualisiert: 2023-06-24
Autor:
Achim Barsch,
Christian Dawidowski,
Till Dembeck,
Markus Engelns,
Hendrick Heimböckel,
Nathalie Jacoby,
Magdalena Kißling,
Georg Mein,
Christoph Müller,
Jennifer Pavlik,
Ulrike Preußer,
Camille Weyrich

Der Austausch zwischen Medienwissenschaft und Mediendidaktik ist zumindest in einer Richtung recht selbstverständlich. MediendidaktikerInnen wie -pädagogInnen nehmen natürlich zur Kenntnis, worüber die Medienwissenschaft forscht. Keine Einführung in die Mediendidaktik kann ohne Ausführungen zum Medienbegriff im Allgemeinen, zur Mediengeschichte oder zu Fragen der Medienkritik auskommen.
Umgekehrt besteht jedoch der begründete Verdacht, dass es weniger selbstverständlich ist, dass sich die Medienwissenschaft auf die Mediendidaktik bezieht. Dies ist insbesondere verwunderlich, da sich die Medienwissenschaft doch eigentlich für Vermittlungsfragen aller Art zuständig halten müsste und daher gerade auch für diejenigen, mit denen es die Mediendidaktik zu tun hat. Diesen Austausch soll der vorliegende Band intensivieren, indem er medienwissenschaftliche und mediendidaktische Aufsätze sowie Stimmen aus der schulischen Praxis versammelt, die aus unterschiedlichen Perspektiven über die Zukunft des Deutschunterrichts reflektieren.
Aktualisiert: 2023-06-24
Autor:
Achim Barsch,
Christian Dawidowski,
Till Dembeck,
Markus Engelns,
Hendrick Heimböckel,
Nathalie Jacoby,
Magdalena Kißling,
Georg Mein,
Christoph Müller,
Jennifer Pavlik,
Ulrike Preußer,
Camille Weyrich

Der Austausch zwischen Medienwissenschaft und Mediendidaktik ist zumindest in einer Richtung recht selbstverständlich. MediendidaktikerInnen wie -pädagogInnen nehmen natürlich zur Kenntnis, worüber die Medienwissenschaft forscht. Keine Einführung in die Mediendidaktik kann ohne Ausführungen zum Medienbegriff im Allgemeinen, zur Mediengeschichte oder zu Fragen der Medienkritik auskommen.
Umgekehrt besteht jedoch der begründete Verdacht, dass es weniger selbstverständlich ist, dass sich die Medienwissenschaft auf die Mediendidaktik bezieht. Dies ist insbesondere verwunderlich, da sich die Medienwissenschaft doch eigentlich für Vermittlungsfragen aller Art zuständig halten müsste und daher gerade auch für diejenigen, mit denen es die Mediendidaktik zu tun hat. Diesen Austausch soll der vorliegende Band intensivieren, indem er medienwissenschaftliche und mediendidaktische Aufsätze sowie Stimmen aus der schulischen Praxis versammelt, die aus unterschiedlichen Perspektiven über die Zukunft des Deutschunterrichts reflektieren.
Aktualisiert: 2023-06-24
Autor:
Achim Barsch,
Christian Dawidowski,
Till Dembeck,
Markus Engelns,
Hendrick Heimböckel,
Nathalie Jacoby,
Magdalena Kißling,
Georg Mein,
Christoph Müller,
Jennifer Pavlik,
Ulrike Preußer,
Camille Weyrich

Der Austausch zwischen Medienwissenschaft und Mediendidaktik ist zumindest in einer Richtung recht selbstverständlich. MediendidaktikerInnen wie -pädagogInnen nehmen natürlich zur Kenntnis, worüber die Medienwissenschaft forscht. Keine Einführung in die Mediendidaktik kann ohne Ausführungen zum Medienbegriff im Allgemeinen, zur Mediengeschichte oder zu Fragen der Medienkritik auskommen.
Umgekehrt besteht jedoch der begründete Verdacht, dass es weniger selbstverständlich ist, dass sich die Medienwissenschaft auf die Mediendidaktik bezieht. Dies ist insbesondere verwunderlich, da sich die Medienwissenschaft doch eigentlich für Vermittlungsfragen aller Art zuständig halten müsste und daher gerade auch für diejenigen, mit denen es die Mediendidaktik zu tun hat. Diesen Austausch soll der vorliegende Band intensivieren, indem er medienwissenschaftliche und mediendidaktische Aufsätze sowie Stimmen aus der schulischen Praxis versammelt, die aus unterschiedlichen Perspektiven über die Zukunft des Deutschunterrichts reflektieren.
Aktualisiert: 2023-06-24
Autor:
Achim Barsch,
Christian Dawidowski,
Till Dembeck,
Markus Engelns,
Hendrick Heimböckel,
Nathalie Jacoby,
Magdalena Kißling,
Georg Mein,
Christoph Müller,
Jennifer Pavlik,
Ulrike Preußer,
Camille Weyrich

Der Austausch zwischen Medienwissenschaft und Mediendidaktik ist zumindest in einer Richtung recht selbstverständlich. MediendidaktikerInnen wie -pädagogInnen nehmen natürlich zur Kenntnis, worüber die Medienwissenschaft forscht. Keine Einführung in die Mediendidaktik kann ohne Ausführungen zum Medienbegriff im Allgemeinen, zur Mediengeschichte oder zu Fragen der Medienkritik auskommen.
Umgekehrt besteht jedoch der begründete Verdacht, dass es weniger selbstverständlich ist, dass sich die Medienwissenschaft auf die Mediendidaktik bezieht. Dies ist insbesondere verwunderlich, da sich die Medienwissenschaft doch eigentlich für Vermittlungsfragen aller Art zuständig halten müsste und daher gerade auch für diejenigen, mit denen es die Mediendidaktik zu tun hat. Diesen Austausch soll der vorliegende Band intensivieren, indem er medienwissenschaftliche und mediendidaktische Aufsätze sowie Stimmen aus der schulischen Praxis versammelt, die aus unterschiedlichen Perspektiven über die Zukunft des Deutschunterrichts reflektieren.
Aktualisiert: 2023-05-24
Autor:
Achim Barsch,
Christian Dawidowski,
Till Dembeck,
Markus Engelns,
Hendrick Heimböckel,
Nathalie Jacoby,
Magdalena Kißling,
Georg Mein,
Christoph Müller,
Jennifer Pavlik,
Ulrike Preußer,
Camille Weyrich

Der Austausch zwischen Medienwissenschaft und Mediendidaktik ist zumindest in einer Richtung recht selbstverständlich. MediendidaktikerInnen wie -pädagogInnen nehmen natürlich zur Kenntnis, worüber die Medienwissenschaft forscht. Keine Einführung in die Mediendidaktik kann ohne Ausführungen zum Medienbegriff im Allgemeinen, zur Mediengeschichte oder zu Fragen der Medienkritik auskommen.
Umgekehrt besteht jedoch der begründete Verdacht, dass es weniger selbstverständlich ist, dass sich die Medienwissenschaft auf die Mediendidaktik bezieht. Dies ist insbesondere verwunderlich, da sich die Medienwissenschaft doch eigentlich für Vermittlungsfragen aller Art zuständig halten müsste und daher gerade auch für diejenigen, mit denen es die Mediendidaktik zu tun hat. Diesen Austausch soll der vorliegende Band intensivieren, indem er medienwissenschaftliche und mediendidaktische Aufsätze sowie Stimmen aus der schulischen Praxis versammelt, die aus unterschiedlichen Perspektiven über die Zukunft des Deutschunterrichts reflektieren.
Aktualisiert: 2023-05-24
Autor:
Achim Barsch,
Christian Dawidowski,
Till Dembeck,
Markus Engelns,
Hendrick Heimböckel,
Nathalie Jacoby,
Magdalena Kißling,
Georg Mein,
Christoph Müller,
Jennifer Pavlik,
Ulrike Preußer,
Camille Weyrich
Comics erleben in Deutschland derzeit kulturell, fachwissenschaftlich und didaktisch eine Renaissance. Das hat auch zur Folge, dass sie vermehrt in der universitären und schulischen Lehre eingebunden werden. Galten Comics über Jahrzehnte hinweg als »Schmutz- und Schundliteratur«, gegen die sich die »höherwertige« Literatur und sogar der Film absetzen konnten, so dient der Comic in Zeiten einer immer stärker zunehmenden Medienpluralität als Brücke zwischen Bild und Text, zwischen analoger und digitaler Medienwelt sowie zwischen Pop- und Hochkultur. Als solche ermöglicht er die Erweiterung bekannter Diskurse zum literarisch-medialen Unterricht, während er zugleich eigene Wege der Darstellung, wie auch der Wissens- und Kompetenzvermittlung vorschlägt.
Aktualisiert: 2022-03-24
> findR *

Der Austausch zwischen Medienwissenschaft und Mediendidaktik ist zumindest in einer Richtung recht selbstverständlich. MediendidaktikerInnen wie -pädagogInnen nehmen natürlich zur Kenntnis, worüber die Medienwissenschaft forscht. Keine Einführung in die Mediendidaktik kann ohne Ausführungen zum Medienbegriff im Allgemeinen, zur Mediengeschichte oder zu Fragen der Medienkritik auskommen.
Umgekehrt besteht jedoch der begründete Verdacht, dass es weniger selbstverständlich ist, dass sich die Medienwissenschaft auf die Mediendidaktik bezieht. Dies ist insbesondere verwunderlich, da sich die Medienwissenschaft doch eigentlich für Vermittlungsfragen aller Art zuständig halten müsste und daher gerade auch für diejenigen, mit denen es die Mediendidaktik zu tun hat. Diesen Austausch soll der vorliegende Band intensivieren, indem er medienwissenschaftliche und mediendidaktische Aufsätze sowie Stimmen aus der schulischen Praxis versammelt, die aus unterschiedlichen Perspektiven über die Zukunft des Deutschunterrichts reflektieren.
Aktualisiert: 2023-04-24
Autor:
Achim Barsch,
Christian Dawidowski,
Till Dembeck,
Markus Engelns,
Hendrick Heimböckel,
Nathalie Jacoby,
Magdalena Kißling,
Georg Mein,
Christoph Müller,
Jennifer Pavlik,
Ulrike Preußer,
Camille Weyrich

Der Austausch zwischen Medienwissenschaft und Mediendidaktik ist zumindest in einer Richtung recht selbstverständlich. MediendidaktikerInnen wie -pädagogInnen nehmen natürlich zur Kenntnis, worüber die Medienwissenschaft forscht. Keine Einführung in die Mediendidaktik kann ohne Ausführungen zum Medienbegriff im Allgemeinen, zur Mediengeschichte oder zu Fragen der Medienkritik auskommen.
Umgekehrt besteht jedoch der begründete Verdacht, dass es weniger selbstverständlich ist, dass sich die Medienwissenschaft auf die Mediendidaktik bezieht. Dies ist insbesondere verwunderlich, da sich die Medienwissenschaft doch eigentlich für Vermittlungsfragen aller Art zuständig halten müsste und daher gerade auch für diejenigen, mit denen es die Mediendidaktik zu tun hat. Diesen Austausch soll der vorliegende Band intensivieren, indem er medienwissenschaftliche und mediendidaktische Aufsätze sowie Stimmen aus der schulischen Praxis versammelt, die aus unterschiedlichen Perspektiven über die Zukunft des Deutschunterrichts reflektieren.
Aktualisiert: 2023-04-24
Autor:
Achim Barsch,
Christian Dawidowski,
Till Dembeck,
Markus Engelns,
Hendrick Heimböckel,
Nathalie Jacoby,
Magdalena Kißling,
Georg Mein,
Christoph Müller,
Jennifer Pavlik,
Ulrike Preußer,
Camille Weyrich
Literale Kompetenzen gelten als Basis für den Erwerb weiterführender Kompetenzen und damit als Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Hochschulstudium. Der Band versammelt aktuelle empirische Studien, die sich mit der Entwicklung von Lese-, Schreib- und sprachreflexiven Kompetenzen von Studierenden befassen. Aus den Befunden werden jeweils Interventionsvorschläge abgeleitet, die eine Optimierung des hochschuldidaktischen Vorgehens in Bezug auf den literalen Kompetenzausbau im Blick haben. Die Beiträge befassen sich u. a. mit den Fragen: Mit welchem Kompetenzstand kommen Schulabgänger/innen an die Hochschule? Bei welchen Teilkompetenzen kommt es zu Schwierigkeiten? Welche domänenspezifischen Kompetenzen entwickeln die Studierenden im Laufe des Studiums?
Aktualisiert: 2020-09-01
> findR *
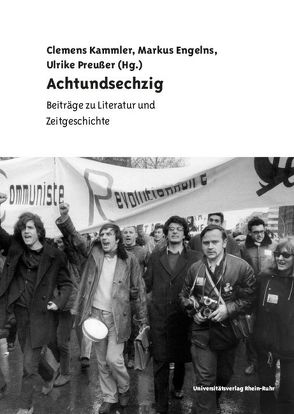
Die Zahl 1968 steht nicht nur für die historischen Tatsachen eines besonderen Jahres, sie steht auch für die kulturellen Entwicklungen, die ihm vorausgingen und die in seiner Folge stattfanden. Der Band "Achtundsechzig" untersucht diese Entwicklungen in literatur- und kulturwissenschaftlicher Perspektive. Er setzt sich mit zentralen literarischen Werken, bedeutsamen medialen Umsetzungen sowie einflussreichen theoretischen Reflexionen aus dem Kontext der 68er-Bewegung auseinander. Auf eine Rekonstruktion des internationalen Zusammenhangs, in dem die bundesdeutsche 68er-Bewegung steht, folgen Beiträge zu Autoren wie Uwe Timm, Bernward Vesper, Hans Magnus Enzensberger und anderen, die die literarische und kulturelle Debatte der damaligen Zeit entscheidend geprägt haben. Weitere Aufsätze widmen sich dem Einfluss der Bewegung auf die Kinder- und Jugendliteratur und der Aufarbeitung des Themas 1968 im Medium Film.
Inhalt:
Zur Einleitung in diesen Band
Ingrid Gilcher-Holtey:
‚1968‘ aus heutiger Sicht. Leitideen, Mobilisierungsdynamik und Wirkungsmacht
Rolf Parr:
1968 – Ein Initialereignis und sein Fortleben bei Uwe Timm und der AutorenEdition
Gerhard RuppBernward Vespers „Die Reise“ – Authentisches Schreiben als ästhetische Revolte?
Tilman von Brand:
Poet des Protestes: Erich Fried
Peter Bekes:
„Bleib erschütterbar und widersteh.“ Peter Rühmkorfs Erinnerungen an die 68er
Clemens Kammler:
„Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin.“ Bezüge zu 1968 bei Thomas Brasch
Christian Lüffe:
1968 und der deutsche Film – eine essayistische Bestandsaufnahme
Ulrike Preußer:
Zwischen „Anti-Struwwelpeter“ und „Papa Löwe“. Antiautoritäres in Text-Bildgeschichten (nicht nur) für Kinder
Klaus-Michael Bogdal:
„Herrschaft, ihres mythischen Mantels entkleidet“: Kritik als Leitmotiv der Essays Enzensbergers vor und nach 1968
Aktualisiert: 2021-12-30
> findR *
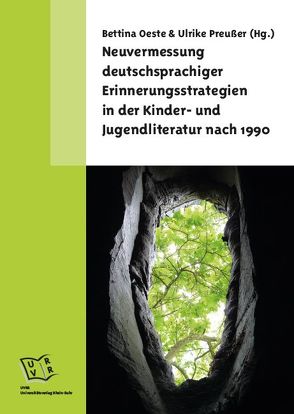
Die kinder- und jugendliterarische Verarbeitung von Nationalsozialismus und Holocaust stellt seit jeher eine große Herausforderung dar. In der KJL-Forschung sowie aus geschichtswissenschaftlicher und -didaktischer Perspektive sind die zur Gattung gehörenden Werke deutschsprachiger Autorinnen und Autoren (aber auch Übersetzungen aus dem Ausland) bis Ende der 1980er Jahre intensiv beforscht und kritisch hinterfragt worden. Neben der literarischen Qualität stellt vor allem die von der israelischen Literaturwissenschaftlerin Zohar Shavit formulierte Kritik an der deutschsprachigen KJL zum Thema einen wichtigen Bezugspunkt für die Auseinandersetzung dar: Demnach erfolge die Literarisierung der Holocaustthematik überwiegend auf der Basis verharmlosender Stereotype. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob und inwiefern sich seit den 1990er Jahren ein Wandel vollzogen hat.
Welche literarischen Erinnerungsstrategien sind in den geschichtserzählenden Texten der letzten Jahre und Jahrzehnte erkennbar? Und welche Möglichkeiten des literarischen und historischen Lernens bieten sie an?
Der Band stellt insofern eine „Neuvermessung“ deutschsprachiger Kinder- und Jugendliteratur zu diesem Themenkomplex dar, als dass er das breite Spektrum gattungstheoretischer und literarästhetischer Besonderheiten neuerer Werke abbildet und dabei die Notwendigkeit innovativer methodischer wie didaktischer Herangehensweisen nahelegt.
Aus dem Inhalt:
Clemens Kammler: Wahrheit als Kriterium der Wertung von Kinder- und Jugendliteratur zu Nationalsozialismus und Holocaust;
Bettina Oeste: Zur Genderfrage in zeitgeschichtlicher Kinder- und Jugendliteratur;
Michael Reichelt: Auto- und heterostereotype Beschreibungen jüdischer Figuren in der zeitgenössischen deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur;
Maciej Jędrzejewski: (Re-)konstruierte NS-Vergangenheit in den popliterarischen Werken ‚Das Große Grover Buch‘ von Andreas Mand, ‚Faserland‘ von Christian Kracht und ‚Generation Golf‘ von Florian Illies;
Cornelius Herz: Erzählen vom Erinnern. Filmische Narration in Robert Thalheims ‚Am Ende kommen Touristen‘ (2007) aus Perspektive der Forschung zur zeitgeschichtlichen Kinder- und Jugendliteratur;
Gabriele von Glasenapp: „Nicht mich will ich retten“. Kinder- und jugendliterarische Repräsentationen von Janusz Korczak;
Torsten Mergen: Fiktion – Narration – Kompetenz. Aktuelle zeitgeschichtliche Jugendromane und ihr didaktisches Potenzial;
Monika Rox-Helmer: „Sie alle hatten dafür gesorgt, dass in diesem Krieg die Hoffnung nicht untergegangen war“ – Historisches Lernen im Lektüreprozess am Beispiel der Romane ‚Die Edelweißpiraten“ von Dirk Reinhardt und ‚Wir tanzen nicht nach Führers Pfeife“ von Elisabeth Zöller
Aktualisiert: 2021-12-30
> findR *
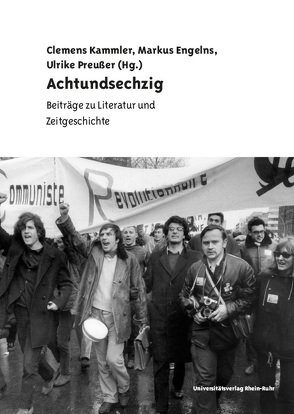
Die Zahl 1968 steht nicht nur für die historischen Tatsachen eines besonderen Jahres, sie steht auch für die kulturellen Entwicklungen, die ihm vorausgingen und die in seiner Folge stattfanden. Der Band "Achtundsechzig" untersucht diese Entwicklungen in literatur- und kulturwissenschaftlicher Perspektive. Er setzt sich mit zentralen literarischen Werken, bedeutsamen medialen Umsetzungen sowie einflussreichen theoretischen Reflexionen aus dem Kontext der 68er-Bewegung auseinander. Auf eine Rekonstruktion des internationalen Zusammenhangs, in dem die bundesdeutsche 68er-Bewegung steht, folgen Beiträge zu Autoren wie Uwe Timm, Bernward Vesper, Hans Magnus Enzensberger und anderen, die die literarische und kulturelle Debatte der damaligen Zeit entscheidend geprägt haben. Weitere Aufsätze widmen sich dem Einfluss der Bewegung auf die Kinder- und Jugendliteratur und der Aufarbeitung des Themas 1968 im Medium Film.
Inhalt:
Zur Einleitung in diesen Band
Ingrid Gilcher-Holtey:
‚1968‘ aus heutiger Sicht. Leitideen, Mobilisierungsdynamik und Wirkungsmacht
Rolf Parr:
1968 – Ein Initialereignis und sein Fortleben bei Uwe Timm und der AutorenEdition
Gerhard RuppBernward Vespers „Die Reise“ – Authentisches Schreiben als ästhetische Revolte?
Tilman von Brand:
Poet des Protestes: Erich Fried
Peter Bekes:
„Bleib erschütterbar und widersteh.“ Peter Rühmkorfs Erinnerungen an die 68er
Clemens Kammler:
„Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin.“ Bezüge zu 1968 bei Thomas Brasch
Christian Lüffe:
1968 und der deutsche Film – eine essayistische Bestandsaufnahme
Ulrike Preußer:
Zwischen „Anti-Struwwelpeter“ und „Papa Löwe“. Antiautoritäres in Text-Bildgeschichten (nicht nur) für Kinder
Klaus-Michael Bogdal:
„Herrschaft, ihres mythischen Mantels entkleidet“: Kritik als Leitmotiv der Essays Enzensbergers vor und nach 1968
Aktualisiert: 2021-12-30
> findR *
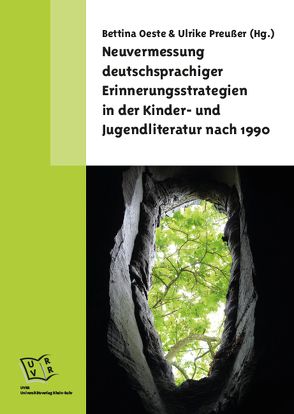
Die kinder- und jugendliterarische Verarbeitung von Nationalsozialismus und Holocaust stellt seit jeher eine große Herausforderung dar. In der KJL-Forschung sowie aus geschichtswissenschaftlicher und -didaktischer Perspektive sind die zur Gattung gehörenden Werke deutschsprachiger Autorinnen und Autoren (aber auch Übersetzungen aus dem Ausland) bis Ende der 1980er Jahre intensiv beforscht und kritisch hinterfragt worden. Neben der literarischen Qualität stellt vor allem die von der israelischen Literaturwissenschaftlerin Zohar Shavit formulierte Kritik an der deutschsprachigen KJL zum Thema einen wichtigen Bezugspunkt für die Auseinandersetzung dar: Demnach erfolge die Literarisierung der Holocaustthematik überwiegend auf der Basis verharmlosender Stereotype. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob und inwiefern sich seit den 1990er Jahren ein Wandel vollzogen hat.
Welche literarischen Erinnerungsstrategien sind in den geschichtserzählenden Texten der letzten Jahre und Jahrzehnte erkennbar? Und welche Möglichkeiten des literarischen und historischen Lernens bieten sie an?
Der Band stellt insofern eine „Neuvermessung“ deutschsprachiger Kinder- und Jugendliteratur zu diesem Themenkomplex dar, als dass er das breite Spektrum gattungstheoretischer und literarästhetischer Besonderheiten neuerer Werke abbildet und dabei die Notwendigkeit innovativer methodischer wie didaktischer Herangehensweisen nahelegt.
Aus dem Inhalt:
Clemens Kammler: Wahrheit als Kriterium der Wertung von Kinder- und Jugendliteratur zu Nationalsozialismus und Holocaust;
Bettina Oeste: Zur Genderfrage in zeitgeschichtlicher Kinder- und Jugendliteratur;
Michael Reichelt: Auto- und heterostereotype Beschreibungen jüdischer Figuren in der zeitgenössischen deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur;
Maciej Jędrzejewski: (Re-)konstruierte NS-Vergangenheit in den popliterarischen Werken ‚Das Große Grover Buch‘ von Andreas Mand, ‚Faserland‘ von Christian Kracht und ‚Generation Golf‘ von Florian Illies;
Cornelius Herz: Erzählen vom Erinnern. Filmische Narration in Robert Thalheims ‚Am Ende kommen Touristen‘ (2007) aus Perspektive der Forschung zur zeitgeschichtlichen Kinder- und Jugendliteratur;
Gabriele von Glasenapp: „Nicht mich will ich retten“. Kinder- und jugendliterarische Repräsentationen von Janusz Korczak;
Torsten Mergen: Fiktion – Narration – Kompetenz. Aktuelle zeitgeschichtliche Jugendromane und ihr didaktisches Potenzial;
Monika Rox-Helmer: „Sie alle hatten dafür gesorgt, dass in diesem Krieg die Hoffnung nicht untergegangen war“ – Historisches Lernen im Lektüreprozess am Beispiel der Romane ‚Die Edelweißpiraten“ von Dirk Reinhardt und ‚Wir tanzen nicht nach Führers Pfeife“ von Elisabeth Zöller
Aktualisiert: 2021-12-30
> findR *
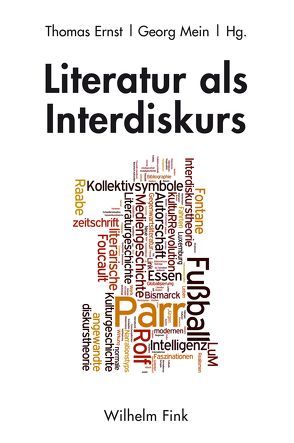
In dem vorliegenden Band, der dem Literatur- und Medienwissenschaftler Rolf Parr als Festschrift zu seinem 60. Geburtstag zugeeignet ist, zeigen knapp fünfzig Kolleginnen und Kollegen die vielfältigen theoretischen, methodologischen und analytischen Anschlüsse an sein umfangreiches Oeuvre. Eindrucksvoll arbeiten die Autoren das hermeneutische Potential der von Rolf Parr maßgeblich entwickelten Interdiskurstheorie für die Analyse literarischer Texte heraus. In diesem Zusammenhang werden vor allem Fragen des literarischen Realismus diskutiert – insbesondere in Auseinandersetzung mit dem Werk von Theodor Fontane und Wilhelm Raabe. Darüber hinaus analysieren die Beiträger Phänomene der Interkulturalität, indem sie sich transitorischen Räumen in der Literatur sowie kulturellen Austausch- und Übersetzungsprozessen zuwenden. Schließlich setzen sich Beiträge mit intermedialen Literaturen und den digitalen Medien der Gegenwart auseinander.
Aktualisiert: 2023-04-24
Autor:
Frank Almai,
Wilhelm Amann,
Iuditha Balint,
Isabell Baumann,
Roland Berbig,
Julia Bertschik,
Klaus-Michael Bogdal,
Evelin Brosi,
Nicole Colin,
Claude D. Conter,
Ralf Georg Czapla,
Arne de Winde,
Till Dembeck,
William Collins Donahue,
Heinz Eickmans,
Peter Ellenbruch,
Andreas Erb,
Thomas Ernst,
Richard Faber,
Soeren R. Fauth,
Peter Friedrich,
Achim Geisenhanslüke,
Dirk Göttsche,
Christof Hamann,
Dieter Heimböckel,
Alexander Honold,
Werner Jung,
Clemens Kammler,
Gerd Katthage,
Jürgen Link,
Georg Mein,
Tanja Nusser,
Nia Perivolaropoulou,
Alexandra Pontzen,
Heinz-Peter Preußer,
Ulrike Preußer,
Elke Reinhardt-Becker,
Andrea Schäfer,
Corinna Schlicht,
Walter Schmitz,
Liane Schüller,
Erhard Schütz,
Heinz Sieburg,
Boris Van den Eynden,
Jochen Vogt,
Jörg Wesche,
Eva Wiegmann,
Mirna Zeman

Wissenschaftliche Erkenntnisse bleiben für den Nicht-Experten häufig unzugänglich, weil sie in Fachsprache vermittelt werden. Um dem interessierten Laien dennoch einen Zugang zur Wissenschaft zu ermöglichen, gibt es populärwissenschaftliche Literatur: sie vermittelt in vereinfachter, adressatenorientierter Gestalt die wesentlichen Fakten und Zusammenhänge. Somit ist die populärwissenschaftliche Literatur als ÜberSetzung von Fachsprache in (Fachsprache erläuternde) Gemeinsprache zu verstehen.
In diesem Translationsprozeß spielen Phraseologismen eine wichtige Rolle: sie fassen Abläufe zusammen, wirken vereinfachend, aber auch sinnerweiternd, sie haben eine schmückende Funktion und motivieren den Leser zur AuseinanderSetzung mit der jeweiligen Wissenschaft. Wie im Speziellen die populärwissenschaftliche Literatur der Verhaltensforschung gestaltet ist und welche besondere Bedeutung den darin verwendeten Phraseologismen zukommt, soll im vorliegenden Band anhand eines umfangreichen Textkorpus vorgestellt und analysiert werden.
Aktualisiert: 2020-01-30
> findR *
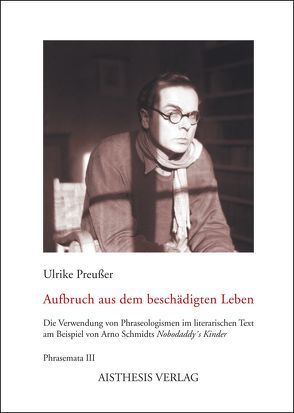
Obwohl oder gerade weil sein Werk von einzigartigem sprachlichen und erzählerischen Innovationsreichtum zeugt, ist Arno Schmidts (1914-1979) Literatur offensichtlich nur einem kleineren Lesepublikum bekannt und zugänglich: Seine Texte gelten als schwierig und erwarten vom Rezipienten ein hohes Maß an Belesenheit und Geduld, um den verschlungenen, einer subjektiven Realität entspringenden Gedanken und Assoziationen folgen zu können.
Auch wenn sich die Forschung bereits zahlreichen Facetten des Schmidtschen Werks zugewandt und die Dechiffrierung vieler Textstellen und Assoziationsketten hervorgebracht hat, wird ein wesentlicher Aspekt in den meisten Auseinandersetzungen erstaunlicher Weise vernachlässigt: Die Sprachverwendung des Autors und ihre Implikationen für Interpretation und Analyse.
In diesem Buch wird mit Hilfe des linguistischen Instrumentariums der Phraseologie der Frage nachgegangen, inwieweit sprachliche Formelhaftigkeit Schmidts basale Anliegen wie u.a. die Wiedergabe von authentisch wirkender Mündlichkeit und die Archivierung und Vernetzung von Kultur im Allgemeinen und Literatur im Besonderen befördert.
Anhand der Romantrilogie Nobodaddy’s Kinder wird veranschaulicht, wie bereits die Betrachtung eines Teilaspekts der sprachlichen Gestaltung des Schmidtschen Werks Aufschluss über das stilistische Vorgehen und insbesondere über die Zusammenhänge zwischen subjektiver und objektiver Realität geben kann.
Aktualisiert: 2021-06-30
> findR *
Die erfolgreiche Reihe Oldenbourg Interpretationen umfasst alle Epochen und Gattungen.Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf aktuellen Titeln der Gegenwartsliteratur, die für den Deutschunterricht entdeckt werden.Fundierte InterpretationAbwechslungsreiche, methodenorientierte UnterrichtshilfenSchnell und mühelos umzusetzende Stundenvorschläge, Klausurvorschläge und eine Fülle von weiteren Materialien]
Aktualisiert: 2022-03-04
> findR *
MEHR ANZEIGEN
Bücher von Preußer, Ulrike
Sie suchen ein Buch oder Publikation vonPreußer, Ulrike ? Bei Buch findr finden Sie alle Bücher Preußer, Ulrike.
Entdecken Sie neue Bücher oder Klassiker für Sie selbst oder zum Verschenken. Buch findr hat zahlreiche Bücher
von Preußer, Ulrike im Sortiment. Nehmen Sie sich Zeit zum Stöbern und finden Sie das passende Buch oder die
Publiketion für Ihr Lesevergnügen oder Ihr Interessensgebiet. Stöbern Sie durch unser Angebot und finden Sie aus
unserer großen Auswahl das Buch, das Ihnen zusagt. Bei Buch findr finden Sie Romane, Ratgeber, wissenschaftliche und
populärwissenschaftliche Bücher uvm. Bestellen Sie Ihr Buch zu Ihrem Thema einfach online und lassen Sie es sich
bequem nach Hause schicken. Wir wünschen Ihnen schöne und entspannte Lesemomente mit Ihrem Buch
von Preußer, Ulrike .
Preußer, Ulrike - Große Auswahl an Publikationen bei Buch findr
Bei uns finden Sie Bücher aller beliebter Autoren, Neuerscheinungen, Bestseller genauso wie alte Schätze. Bücher
von Preußer, Ulrike die Ihre Fantasie anregen und Bücher, die Sie weiterbilden und Ihnen wissenschaftliche Fakten
vermitteln. Ganz nach Ihrem Geschmack ist das passende Buch für Sie dabei. Finden Sie eine große Auswahl Bücher
verschiedenster Genres, Verlage, Schlagworte Genre bei Buchfindr:
Unser Repertoire umfasst Bücher von
Sie haben viele Möglichkeiten bei Buch findr die passenden Bücher für Ihr Lesevergnügen zu entdecken. Nutzen Sie
unsere Suchfunktionen, um zu stöbern und für Sie interessante Bücher in den unterschiedlichen Genres und Kategorien
zu finden. Neben Büchern von Preußer, Ulrike und Büchern aus verschiedenen Kategorien finden Sie schnell und
einfach auch eine Auflistung thematisch passender Publikationen. Probieren Sie es aus, legen Sie jetzt los! Ihrem
Lesevergnügen steht nichts im Wege. Nutzen Sie die Vorteile Ihre Bücher online zu kaufen und bekommen Sie die
bestellten Bücher schnell und bequem zugestellt. Nehmen Sie sich die Zeit, online die Bücher Ihrer Wahl anzulesen,
Buchempfehlungen und Rezensionen zu studieren, Informationen zu Autoren zu lesen. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
das Team von Buchfindr.